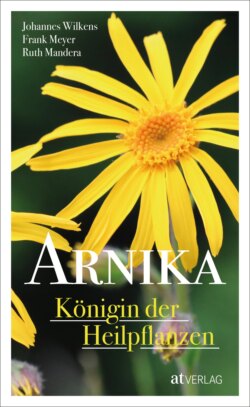Читать книгу Arnika - Königin der Heilpflanzen - eBook - Frank Nicholas Meyer - Страница 17
ОглавлениеDas Wesentliche der Arnika
»Im vergnüglichen Erinnern mag ich zum Beispiel gern gedenken, mit wie frohem Erstaunen wir die Arnica montana nach erstiegenen vogtländischen Berghöhen erst zerstreut, dann aber an sanften sonnigen abhängigen Waldwiesen, feuchten aber nicht sumpfigen, herrschend und man dürfte sagen wüthend erblickten.« So beschrieb Goethe die Arnika (in MAYER/CZYGAN 2000, S. 31). Wie kann man all die Einzelheiten zu einem Wesensbild der Arnica montana verdichten? Wieso erlebte Goethe sie »herrschend« und »wüthend«?
Um diese Fragen zu beantworten, muss ein wenig ausgeholt werden. 1831, ein Jahr vor seinem Tod, verfasste Goethe, 82-jährig, den Text »Über die Spiraltendenz der Vegetation«. Damit knüpfte er an seine 41 Jahre früher erschienene Schrift an, in der er die Blattverwandlung beschrieb und die er »Versuch, die Metamorphose der Pflanzen zu erklären« genannt hatte (erschienen 1790). Nun fügte er zu dem »Spiralsystem« der Pflanzen (dem Blättrigen) das »Vertikalsystem« (die Achsenorganisation) und machte dadurch auf die größte Polarität im Pflanzenreich aufmerksam. Treu seiner Erkenntnis, dass zu jeder Polarität ihre Steigerung gehöre, erklärte er: »Keines der beiden Systeme kann allein gedacht werden; sie sind immer und ewig beisammen; aber im völligen Gleichgewicht bringen sie das Vollkommenste der Vegetation hervor.« Die vertikale Tendenz »ist anzusehen wie ein geistiger Stab, welcher das Dasein begründet und solches auf lange Zeit zu erhalten fähig ist« (Goethes Naturwissenschaftliche Schriften, S. 218).
Rudolf Steiner (1861–1925) lebte nach seinem Studium ab 1890 für sieben Jahre in Weimar und gab während dieser Zeit die naturwissenschaftlichen Schriften von Goethe heraus, versehen mit eigenen Kommentaren. Später griff er Goethes Spiraltendenz und Vertikaltendenz der Pflanzen auf und »weitete« sie, indem er den Kosmos mit einbezog. Steiner zufolge entwickelt sich jede Pflanze zwischen Erde und Himmel mithilfe von irdischen und kosmischen Kräften. Durchzogen von Lebendigkeit, bildet sie nacheinander viele grüne Blätter am grünen Stängel – bis ihr von oben, vom Kosmos, ihr »Seelisches« entgegenkommt. Durch diese »seelische Berührung« kann die Pflanze anstelle von grünen Blättern Kelchblätter, Blütenblätter, Staubblätter und Fruchtblätter bilden, also die Organe des Spiralsystems verwandeln (Steiner, Vortrag vom 21. 10. 1908, S. 29). So entstehen die Blüten; anschließend, im Zusammenwirken mit der Achse nach der Befruchtung, auch Früchte und Samen, also all das, was man in der Botanik als »generative Organe« bezeichnet.
Wir wissen alle, dass Pflanzen ohne Sonnenlicht nicht leben können. Ihre Blätter richten sich in ihrer Stellung nach der realen Sonneneinstrahlung, ihr Vertikalsystem, der »geistige Stab« Goethes, orientiert sich jedoch zum Zenith, zur »geistigen Sonne«. Die von dort kommenden Sonnenstrahlen gehen durch die Pflanze hindurch zum Mittelpunkt der Erde. »In dieser Tätigkeit des geistigen Inhalts des Sonnenstrahls, der durch die Pflanze hindurch zum Mittelpunkt der Erde geht, drückt sich die Tätigkeit des Ichs der Pflanze aus« (Steiner, Vortrag vom 6. 8. 1908, S. 58). Die Fähigkeit der Pflanzen, sich mit ihrem Vertikalsystem aufrecht in den Raum zu stellen, kann man demzufolge – behutsam – als eine »Ich-Qualität« bezeichnen. Angesichts von Bäumen mit ihren eindrucksvollen Stämmen ist das unmittelbar zu erleben.
Mit der Blüten- und Fruchtbildung sind selbstverständlich besondere Substanzen verbunden, die sogenannten Sekundärstoffe, die für jede Pflanzenart spezifisch und meist therapeutisch wirksam sind. Ätherische Öle gehören typischerweise zu den Blütenorganen. Sind sie, wie bei den Lippenblütlern oder unserer Arnika, auch in anderen Organen vorhanden, deutet die goetheanistische Naturbetrachtung dies als eine Verlagerung einer »seelisch berührten« Substanz in den aufbauenden Bereich der lebendigen, vegetativen Prozesse.
Polarität …
Bezogen auf die Arnika wird hierunter die gegenseitige Durchdringung von polaren Aspekten – Vitalität einerseits und »seelische Berührung« andererseits – verstanden.
Arnica montana ist fähig, in allen ihren Organen »seelisch berührte« Substanz (ätherisches Öl) zu bilden, sowohl zur Umwelt gerichtet in ihren unzähligen Drüsenhaaren als auch ganz im Inneren, in ihren Ölgängen. Diese gewaltige Syntheseleistung bedarf einer enormen Lebensaktivität, die man der Pflanze zunächst gar nicht ansieht, da oberirdisch Blattwerk und Verzweigungen im Vergleich mit anderen Arnikaarten so reduziert sind. Tief beeindruckend ist, dass diese Vitalität sich gerade nicht aus einem reichhaltigen Nährstoffangebot des Bodens speist! Auf gedüngten Wiesen verschwindet sie, weil sie einen mageren, nicht triebigen Boden zum Überleben braucht.
Bei Arnica montana ist die Vitalität geheimnisvoll mit der Achse verbunden – also mit dem »Ich-Aspekt« –, obwohl sie als Rhizom und Stängel physisch wenig massig erscheint. Indem die Arnika ihre in Knoten und Internodien gegliederte Hauptachse als Rhizom in die Erde verlegt, entzieht sie sie den abbauenden Kräften: Es blühen, fruchten und verdorren ja immer nur die Seitenzweige, die von der horizontalen Grund- und Hauptachse aus vertikal ins Licht streben. Das Rhizom selbst bleibt lebendig und verzweigt sich kraftvoll weiter, innerlich angefüllt mit »seelisch berührter« Substanz. Auch an den aufstrebenden Blütentrieben findet man in jedem Bereich eine ungewöhnlich intensive Verbindung von vegetativen und blütenartigen Prozessen. So sind die gegenständigen, sitzenden und – von der Blattmetamorphose her gesehen – blütennahen Laubblätter groß, breit, ja nahezu grob und außerdem borstig behaart. Wie beschrieben, sind sie gerade nicht symmetrisch, obwohl man dies von blütennahen Blättern erwarten würde. Eine Asymmetrie bei Laubblättern weist immer auf starke vegetative Kräfte hin, wie man zum Beispiel bei Tomatenpflanzen oder auch beim Löwenzahn sehen kann.
Auch die Blütenköpfe von Arnika zeugen von Vitalität: Sie werden nämlich in den Bergen gern von Bohrfliegen als wohlgefüllte Vorratskammer für den Nachwuchs gewählt. Die in der älteren Arnikaliteratur stets genannte Bohrfliege Trypeta arnicivora wurde in Tephritis arnicae »zurückbenannt«. Diesen Namen hatte ihr Linne bereits 1758 verliehen. Sie gehört zu den Frucht- oder Bohrfliegen (Familie der Tephritidae, früher Trypetidae), deren Maden sich von Pflanzengewebe ernähren. Olivenfruchtfliegen oder Kirschfruchtfliegen sind bei Anbauern gefürchtet. Die Fruchtfliege/Bohrfliege Tephritis arnicae nun ist vollständig an den Lebenszyklus der Arnica montana angepasst. Die Fliegenmütter legen im Mai oder Juni ihre Eier in die ganz jungen, noch verschlossenen Blütenkörbe. Die zahlreichen weißen kleinen Maden ernähren sich zuerst von den Knospen der Röhrenblüten mitsamt den jungen Fruchtknoten, dann fressen sie sich durch den Körbchenboden bis in den Stängel hinein. Im Pflanzenlabor der WALA Heilmittel GmbH, dem Herstellungsbereich der pflanzlichen, wässrigen Urtinkturen, wird daher nach der Ernte jedes Blütenköpfchen der Arnika geöffnet und genauestens angeschaut. Etwaige Maden oder angefressene Gebiete werden sorgfältig entfernt.
Vergleicht man innerlich das Blütenkörbchen einer Echten Kamille, das sich im Laufe des Aufblühens hebt und ganz durchlüftet, mit dem Körbchen einer Arnika, in dem Fliegenmaden leben können, dann ist nachvollziehbar, dass bei der Arnika »seelische Berührungen« auf verschiedenen Ebenen stattfinden und verknüpft mit nahrhaften, lebendigen Aufbauprozessen sind.
Ebenso ist die »wirbelige« Dynamik der Zungenblüten, ihre Unregelmäßigkeit, ein Zeichen von Plastizität und überbordender Lebendigkeit, die hier über die Formkraft siegt, die sonst im Blütenbereich vorherrscht. Wenn Goethe die Arnika im Vogtland »herrschend« nennt, dann meinte er wahrscheinlich ihre Fähigkeit, sich in einer ihr gemäßen Landschaft wirklich flächendeckend auszubreiten. Dazu verhilft ihr das vitale Rhizom. »Wüthend« beschreibt jedoch eine andere Ebene. Nahm der geniale Pflanzenkenner dabei womöglich die geballte, aber gebändigte Vitalität wahr – dieselbe, welche die Arnika mit dem Wolf verbindet?
Torsten Arncken und Ulrike Ortin unternahmen 1994 eine Forschungsreise in die USA, um einige amerikanische Arnikaarten zu studieren. Anschließend bauten sie in Dornach/Schweiz vier dieser Arten an, um sie mit Arnica montana zu vergleichen. In ihrem Abschlussbericht charakterisieren sie die nordamerikanischen Arten folgendermaßen: »Die vier von uns angebauten Arnika-Arten sind alle deutlich wüchsiger als Arnica montana. Sie bilden im zweiten Jahr schnellwüchsige Ausläufer, die noch im selben Jahr zur Blüte kommen und dichte Horste bilden. (…) Die nordamerikanischen Arten bilden kein verdicktes Rhizom und kaum Geschmack oder Geruch in der Wurzel« (ARNCKEN und ORTIN 1996, S. 42 und 46). Sie beschreiben, dass der Blattbereich stärker betont wird als die Blütenregion, die Blätter also zahlreicher sind und am Stängel weit mit hinaufgenommen werden. Die Blätter sind nicht so zäh und ledrig wie bei Arnica montana, sie duften sehr stark und sind klebrig-ölig. Die Stängel sind weitaus dünner und zarter, und es werden mehr Seitentriebe gebildet. Die Blüten sind kleiner als die von Arnica montana, und sie duften kaum.
Dies alles bestätigt, dass bei den anderen Arnikas die vegetative, blättrige Seite überwiegt und die Verinnerlichung von ätherischen Ölen bis in Rhizome und Wurzeln nicht so ausgeprägt ist. Die polaren Bildeprinzipien sind zwar auch »im Gespräch« miteinander, aber sie sind nicht gleich stark, nicht ebenbürtig, und sie durchdringen sich auch nicht so innig. Bei unserer Arnika kommt aber noch ein weiterer Aspekt dazu.
Arnica latfolia, eine blattreiche nordamerikanische Art, hier im Mount Rainier National Park im US-Bundesstaat Washington.
… und Steigerung
Bezogen auf die Arnika wird hierunter verstanden, dass Arnica montana durch Zurückhaltung im Äußeren geistige Prinzipien sichtbar werden lässt.
Die aus Mexiko stammenden Zinnien mit ihren leuchtend roten, kräftigen, endständigen Blütenkörben haben ebenfalls große, gegenständige, sitzende Blätter. Bei ihnen weisen die Blattpaare wegen ihrer gleichmäßigen Verteilung entlang dem Stängel keck in vier verschiedene Richtungen. Vergleicht man hiermit blühende Arnikatriebe am natürlichen Standort, wird die »Eigenwilligkeit« der Arnika deutlich: Sie reduziert die Blattpaare am aufrechten Stängel auf zwei (bis drei) und dehnt gleichzeitig die zwischen ihnen liegenden Internodien. Der pflanzentypische Rhythmus von Ausdehnung und Zusammenziehung wird dadurch so verändert, dass Arnica montana klare, urbildhafte Zahlengebärden im Raum sichtbar werden lassen kann: Die »Vier« erscheint unübersehbar in der Jugendrosette im Kreuz, das dem Boden dicht anliegt, am Stängel ist sie abgeschwächt. Die »Drei« zeigt sich in dem dreizähligen Blütenköpfchen-Stand, der sich weit in den Lichtraum streckt (siehe Bilder Seite 18/19, 91, 98/99). Der mittlere Bereich, an dem sich bei anderen Arnikas die Fülle der gegenständigen Blätter entfaltet, bleibt bei ihr nahezu blattfrei und präsentiert unverfälscht das Wichtigste: die elastisch schwingende Aufrichte, das Organ der Ich-Qualität.
»Wer Großes will, muß sich zusammenraffen;In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister,Und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben.«
Diese Zeilen, mit denen Goethe ein 1807 veröffentlichtes Sonett enden lässt, weisen auf das Geheimnis der Arnica montana: Durch die Zurückhaltung in der äußeren Gestalt und die Verinnerlichung ihrer Seelenhaftigkeit wird sie zur Königin. Eine Königin kennt und verkörpert das Gesetz – aber sie prägt es individuell.