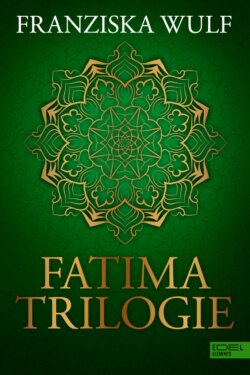Читать книгу Fatima Trilogie Gesamtausgabe - Franziska Wulf - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
V
ОглавлениеMirwats Genesung wurde mit einem rauschenden Fest gefeiert. Drei Tage lang waren die Dächer des Palastes und der Häuser in Buchara mit grünen Fahnen geschmückt. Blumengirlanden hingen vor den Fenstern, abends schwammen Talglichter in den Brunnen der Stadt, und von den Zinnen der Palastmauer regnete es Blumen und Münzen. Die Stimmen der Muezzin, die Allah für Mirwats Gesundung und die Großzügigkeit des Emirs dankten, hallten laut über die Dächer der Stadt hinweg.
Doch sosehr Mirwats unerwartete Genesung die Menschen in Buchara freute, so sehr wurde auch über die Hintergründe gerätselt. Von allen Seiten wurde Mirwat mit Fragen bestürmt. Jeder wollte wissen, wie Ali al-Hussein sie geheilt hatte, welche Arzneien und Kniffe er angewandt hatte, um sie vor dem sicheren Tod zu bewahren. Aber Mirwat schwieg hartnäckig und verriet mit keinem Wort, was wirklich in ihren Gemächern passiert war und wem sie ihre Heilung zu verdanken hatte. Natürlich hütete sich auch Ali al-Hussein, die Wahrheit preiszugeben. Zum Dank für Mirwats Rettung hatte er nämlich vom Emir ein Landgut vor den Toren Bucharas erhalten. Es war fruchtbares Land, mit ausgedehnten Obst- und Gemüseplantagen und einem herrlichen Haus. Und Ali dachte nicht daran, dieses Landgut und seinen Ruf zu verlieren.
Beatrice hingegen betrachtete die Ereignisse amüsiert aus der Distanz. Niemand dachte daran, sie zu fragen, und sie hatte kein Verlangen danach, die Dinge richtig zu stellen. Im Gegenteil, sie fand das allgemeine Rätselraten sogar überaus unterhaltsam. Bei ihrem täglichen Arabischunterricht erzählte Mirwat ihr von den neuesten Gerüchten, die im Palast die Runde machten. Noch Wochen später, als Beatrice bereits den meisten Unterhaltungen auch ohne Mirwats Hilfe mühelos folgen konnte, hörte sie, wie Diener, Soldaten, Beamte und sogar der Emir mit seinen Freunden darüber sprachen. Natürlich konnte sie diesen Unterhaltungen nur heimlich von der Galerie im Harem aus lauschen, durch die geschnitzten Fenstergitter vor Entdeckung geschützt. Schließlich war sie eine Frau, und die Teilnahme an den Gesprächen des anderen Geschlechts wäre einem Sakrileg gleichgekommen. Die Männer sprachen voller Ehrfurcht und Anerkennung von den außergewöhnlichen Fähigkeiten des Ali al-Hussein. Sie vermuteten hohe indische Heilkunst, geheimnisvolle Arzneien aus Ägypten, rätselhafte abessinische Rituale. Einige wenige erwähnten sogar Zauberei, aber das nur ganz leise und hinter vorgehaltener Hand, denn einen mächtigen und viel geachteten Mann wie Ali al-Hussein zu beleidigen, das wagten nicht einmal die höchsten Beamten des Emirs. Jedes Mal, wenn Beatrice von diesen wilden Vermutungen hörte, musste sie aufpassen, sich nicht durch lautes Gelächter zu verraten. Diese Einfaltspinsel! Was hätten sie wohl gedacht, wenn sie erfahren hätten, dass in Wirklichkeit nicht ihr weiser, hoch geschätzter Ali al-Hussein, sondern eine Frau Mirwat das Leben gerettet hatte? Wahrscheinlich hätte sie der Schlag getroffen.
Doch obwohl alle Beteiligten beharrlich schwiegen und selbst die hartnäckigsten Fragen nur mit einem Kopfschütteln oder einem milden Lächeln beantworteten, schien sich die Wahrheit irgendwie herumzusprechen. Wie Mirwat immer sagte: »Im Palast haben die Decken Augen, die Wände Ohren und die Teppiche einen Mund.«
Zuerst nahm Beatrice es gar nicht bewusst wahr. Als Nirman, Mirwats persönliche Dienerin, zu ihr kam, dachte sie nicht über den Grund nach. Das junge Mädchen hatte sich in den Finger geschnitten und bat Beatrice, sich die Wunde anzusehen. Der Finger war an der Kuppe hochrot und geschwollen, die Wunde hatte sich infiziert. Heimlich in der Nacht unter dem schwachen Licht einer einzelnen Öllampe schnitt Beatrice die Wundränder aus, wusch die Wunde mit heißem Wasser und desinfizierte sie mit Myrrhenöl, das sie auf in kochendem Wasser sterilisierte Baumwolllappen träufelte. Beatrice musste alles improvisieren, vom Skalpell – einem Obstmesser – bis hin zum Verbandsmaterial. Sie erklärte Nirman, dass sie die Hand für zwei Tage ruhig stellen müsste, wenn sie keine Infektion riskieren wollte, die sie töten oder sie zumindest den Finger kosten konnte. Nirman schien sie zwar kaum zu verstehen, denn wie die meisten Dienerinnen sprach auch sie so gut wie gar kein Latein, und Beatrices Arabisch war zu dem Zeitpunkt noch ziemlich lückenhaft, dennoch befolgte sie Beatrices Anweisungen. Schon nach zwei Tagen ging es dem jungen Mädchen viel besser. Sie war wieder in der Lage, ihre Arbeit zu verrichten, und nach weiteren drei Tagen war die Wunde so gut verheilt, dass Beatrice den Verband endgültig entfernen konnte.
Von diesem Zeitpunkt an suchten alle Frauen des Harems Beatrice auf. Zuerst kamen sie zögernd, heimlich am späten Abend oder in Begleitung von mehreren Freundinnen, als fürchteten sie sich vor der Fremden aus dem Norden. Doch schon nach kurzer Zeit verloren sie ihre Scheu. Die Frauen kamen mit Bauchschmerzen, Halsweh, tränenden Augen und schmerzenden Gelenken zu ihr. Manchmal hatte Beatrice so viel zu tun, dass sie sich an ihre Arbeit auf der Notaufnahme erinnert fühlte – mit der Ausnahme, dass sie hier Chirurgin, Gynäkologin, Kinderärztin und Allgemeinmedizinerin in einer Person war, und das ohne medizinische Hilfsmittel.
Eines Tages, es waren etwa zwei Monate seit Mirwats Heilung vergangen, wurde Beatrice durch lautes Klopfen geweckt. Verwundert setzte sie sich im Bett auf. Es war noch sehr früh am Morgen. Draußen war es dunkel, durch das Fenster konnte sie noch Sterne und die Sichel des Mondes sehen. Wer mochte sie zu so früher Stunde stören? Nicht einmal ihre Dienerin Yasmina, die sich sonst immer um alles kümmerte, schien aufgestanden zu sein. Das Klopfen an der Tür wurde ungeduldiger.
»Ich komme ja schon!«, rief Beatrice, schwang sich aus dem Bett und öffnete die Tür.
»Das wurde auch Zeit! Ich dachte schon, du würdest mich für den Rest der Nacht hier warten lassen!«
Sprachlos vor Überraschung sah Beatrice die alte Frau an, die sich auf einen Stock aus poliertem Ebenholz stützte und ohne eine Erlaubnis abzuwarten an ihr vorbei ins Zimmer humpelte. Es war Sekireh, die Mutter des Emirs. Die Frau war mindestens so alt wie die Welt, und im ganzen Palast gab es niemanden, der nicht vor ihr zitterte. Nicht einmal Mirwat traute sich, der Alten zu widersprechen.
»Ich grüße dich, Sekireh, der Friede sei mit dir!«, sagte Beatrice, verbeugte sich höflich vor der Alten und dankte im Stillen Mirwat für ihren Unterricht. Die Freundin hatte ihr nämlich während des Arabischunterrichts alles beigebracht, was sie über die Sitten, Bräuche und Umgangsformen im Palast wissen musste. »Was führt dich zu so ungewöhnlicher Stunde zu mir?«
Natürlich antwortete Sekireh nicht, obwohl Beatrice sicher war, dass die Alte sie nicht nur gehört, sondern auch verstanden hatte. Aber so war Sekireh. Wer sich nicht widerspruchslos ihrem Willen unterordnete, wurde bestenfalls ignoriert.
Schweigend sah Beatrice zu, wie sie durch das Zimmer humpelte, Möbel und Kleider genau betrachtete und sogar die Bettlaken zurückschlug, als vermutete sie darunter Geheimdokumente, die Beatrice als Spionin entlarven könnten. Dann humpelte sie zu Beatrice zurück und ließ abschätzend ihren strengen Blick über sie gleiten.
»Du siehst recht ordentlich aus für eine Barbarin«, sagte sie schließlich, und Beatrice beschloss diese Worte als Kompliment zu betrachten. Sie war nicht gewillt, sich von Sekireh provozieren zu lassen.
»Ich danke dir«, antwortete sie lächelnd und verbeugte sich wieder. »Aber du hast sicher nicht schon vor dem Morgengebet den Weg zu mir auf dich genommen, um mir das zu sagen?«
Sekireh neigte den Kopf zur Seite. »Du verlierst keine Zeit.« Sie tippte nervös mit ihrem Stock auf den Boden. »Man erzählt sich, dass du etwas von der Heilkunde verstündest. Entspricht das der Wahrheit?«
Beatrice nickte. »Das ist richtig. In meiner Heimat bin ich Ärztin.«
»Ärztin. So.« Sekireh sah sie mit ihren überraschend hellen Augen durchdringend an. Diese Augen waren nicht braun wie bei den meisten Männern und Frauen hier, sie waren gelb. Diese ungewöhnliche Farbe verlieh ihnen einen fast diabolischen Ausdruck. Beatrice konnte sich vorstellen, dass man unter diesem Blick schnell ins Zittern geriet. »Weshalb sollte ich dir das glauben?«
Beatrice schüttelte lächelnd den Kopf und zuckte mit den Schultern. Was sollte dieses Spiel? »Du brauchst mir nicht zu glauben, Sekireh.«
Trotzig stieß die Alte mit dem Stock auf den Boden. »Ich glaube dir aber. Ich habe Schmerzen. Kannst du mir helfen?«
Diese Worte klangen mehr nach einem Befehl als nach einer Bitte. Für einen Augenblick war Beatrice sprachlos.
»Du kannst es also doch nicht«, stellte Sekireh fest, und Beatrice war sich nicht sicher, ob Verachtung oder Enttäuschung aus dem Blick der Alten sprach.
»Nicht so schnell, Sekireh. Bevor ich etwas Genaues sagen kann, muss ich dich befragen und untersuchen. Wo hast du die Schmerzen und seit wann?«
»Seit einigen Wochen. Im Rücken und in der Hüfte. Sie werden von Tag zu Tag schlimmer.«
Beatrice nickte nachdenklich und ging bereits in Gedanken sämtliche Diagnosen durch, die passen konnten.
»Warst du schon bei einem anderen Arzt?«
»Bei wem denn? Etwa bei ibn Sina?« Sekireh stieß ein verächtliches Zischen aus. »Dieser junge Ali mag zwar schon in früher Kindheit all diese Bücher über die Heilkunde gelesen haben, doch ob er auch tatsächlich etwas davon versteht, weiß nur Allah. Aber so sind die Männer. Sie glauben ein Buch zu lesen bedeutet gleichzeitig zu wissen. In ihren Schulen unterrichten sie einander. Dabei weiß meine jüngste Urenkelin mehr über die Vorgänge des Lebens als einer von ihnen. Die Heilkunde gehört in die Hände von Frauen – die Männer wollen es nur nicht wahrhaben. Und jetzt frage ich dich, wie soll dieser ibn Sina meine Schmerzen lindern können, wenn mir nicht einmal warme Bäder und Samiras Kräuter helfen konnten?«
Beatrice unterdrückte ein Schmunzeln. Wie kam Ali al-Hussein nur zu seinem guten Ruf, wenn jeder, der über ihn sprach, ihn für einen Scharlatan zu halten schien?
»Gut«, sagte sie. »Ich muss dich untersuchen. Zieh dich aus.«
»Was fällt dir ein? Das werde ich nicht tun, auf gar keinen Fall!«, widersprach die Alte empört und stieß heftig mit dem Stock auf den Boden. »Ich werde mich nicht vor einer Barbarin ...«
»Ich bin keine Wahrsagerin, ich bin Ärztin, Sekireh«, unterbrach Beatrice die Alte und versuchte geduldig und freundlich zu bleiben. Manchmal fiel es ihr wirklich schwer, die Mentalität der Menschen hier zu verstehen. »Wenn du also möchtest, dass ich dir helfe, muss ich dich zuerst untersuchen. Dafür musst du dich ausziehen. Wenn du das nicht willst – in Ordnung, es ist deine Entscheidung. Dann kann ich aber auch nichts für dich tun.«
Die Alte runzelte die Stirn und dachte einen Augenblick nach. Ohne Beatrice anzusehen, begann sie schließlich langsam und umständlich ihre Kleider abzulegen. Als Sekireh dann endlich nackt vor ihr stand, musste Beatrice sich Mühe geben, ihr Entsetzen zu verbergen. Unter den weiten, knöchellangen arabischen Kleidern war nicht zu sehen gewesen, wie dünn Sekireh war. Dabei ging ihre Magerkeit über einen altersbedingten Gewichtsverlust hinaus. Die Frau sah aus wie ein Skelett. Beatrice konnte fast jeden einzelnen Knochen erkennen. Die Haut hing in großen Falten von den dünnen Armen und Beinen herab. Vermutlich hatte Sekireh erst vor kurzer Zeit so stark abgenommen.
Tumorkachexie!, dachte Beatrice und tastete und klopfte vorsichtig die Wirbelsäule und den Brustkorb ab. Aber wo mochte der Tumor sitzen? Im Darm? In der Lunge? In einer Brust? Es gab viele Möglichkeiten.
»Hast du noch an anderen Stellen Schmerzen?«, fragte sie, um die Diagnose einzugrenzen, während sie mit geübten Griffen die rechte Brust der Alten untersuchte.
»Manchmal«, antwortete Sekireh. Aus ihrer Stimme war jegliche Schroffheit und Überheblichkeit verschwunden. Sie war jetzt nicht mehr die Mutter des Emirs, die jeden im Palast mit ihren Launen tyrannisieren konnte. Sie war jetzt eine alte, kranke Frau. Und sie hatte Angst. »Ich fühle mich müde und schwach. Seit einiger Zeit schmeckt mir das Essen nicht. Manchmal habe ich Kopfschmerzen. Es kommt immer häufiger vor. Und an einigen Tagen kann ich nicht mehr richtig sehen.«
Beatrice nickte. Alles passte zusammen. Und als sie die linke Brust der Alten untersuchte, fand sie ihren Verdacht bestätigt. Unter ihren Fingern fühlte sie einen harten hühnereigroßen Knoten.
»Tut das weh?«, fragte sie Sekireh und fuhr mit den Fingern über die höckerige Oberfläche. Die Alte schüttelte den Kopf. »Hebe bitte deine Arme.«
Vorsichtig untersuchte Beatrice die Achseln. Auch hier, ebenso wie hinter dem linken Schlüsselbein, fand sie mehrere harte Knoten.
»Du kannst dich wieder anziehen, Sekireh.«
Langsam legte die alte Frau ihre Kleider an. Beatrice zögerte. Sie hatte sich noch nie davor gefürchtet, ihren Patienten die Wahrheit zu sagen. Aber dieser Fall lag anders. Immerhin war Sekireh die Mutter des Emirs und im ganzen Harem gefürchtet. Man munkelte sogar, dass auf ihren Wunsch hin mehr Menschen ihr Leben verloren hatten als durch Nuhs eigenen Willen. Sollte sie dieser Frau auf den Kopf zusagen, dass sie bald sterben würde, und dadurch womöglich riskieren, selbst unter dem Beil des Scharfrichters zu enden? Doch dann sah sie den ängstlichen, erwartungsvollen Blick der Alten, und sie brachte es nicht übers Herz, sie zu vertrösten oder gar anzuschwindeln. Mochte sich die ganze Welt vor ihr fürchten, Sekireh hatte wie jeder andere auch ein Recht darauf, die Wahrheit über ihren Zustand zu erfahren.
»Setz dich«, sagte Beatrice und bot der Alten einen Platz auf ihrem Bett an. Sie konnte verstehen, weshalb so viele Kollegen sich vor Gesprächen dieser Art scheuten, die hässlichsten Diagnosen in die schönsten Worte kleideten oder aber sich ganz verweigerten und den schwarzen Peter einem Kollegen zuschoben. Hierdurch änderten sich jedoch selten die Tatsachen. Beatrice stieß einen Seufzer aus und setzte sich neben die Alte.
»Was ist mit mir?«
»Du bist sehr krank, Sekireh«, begann Beatrice langsam und überlegte, wie sie der Alten, die vermutlich überhaupt kein medizinisches Vorwissen hatte, die Diagnose erklären sollte. Sie hielt nichts davon, sich hinter den Fachbegriffen zu verstecken, wie andere Kollegen es gern taten. Sie sah ihr offen ins Gesicht. »Du hast Brustkrebs in fortgeschrittenem Stadium. Selbst wenn mir die geeignete Ausrüstung zur Verfügung stehen würde, glaube ich nicht, dass ich noch viel für dich tun könnte. Der Tumor in deiner linken Brust ist bereits ziemlich groß. Wenn du deine linke Achselhöhle abtastest, kannst du die vom Krebs befallenen Lymphknoten spüren. Die Schmerzen in deiner Hüfte und deiner Wirbelsäule sind wahrscheinlich bereits die Folgen von Knochenabsiedlungen. Auch deine Kopfschmerzen und die Sehstörungen könnten auf die Geschwulst zurückzuführen sein. Ohne CT kann ich jedoch ...«
»Ich verstehe von diesen Dingen nichts«, unterbrach Sekireh sie. »Kannst du mir helfen?«
»Ich weiß es nicht. Nuh II. müsste dich in ein Krankenhaus bringen und dort ein CT und eine Szintigraphie machen lassen. Sollten sich tatsächlich in der Wirbelsäule Knochenmetastasen befinden, kann man sie bestrahlen. Aber mehr als eine Linderung der Schmerzen wird kaum zu erwarten sein.«
Sekireh runzelte die Stirn. »Ich werde also sterben. Richtig?«
Beatrice nickte.
Sekireh stieß langsam die Luft aus.
»Wann?«
»Das weiß niemand außer Allah.«
Die alte Frau saß auf dem Bett und starrte schweigend auf ihre im Schoß gefalteten Hände.
»Ich fürchte den Tod nicht«, sagte sie ruhig. »Aber ich fürchte die Schmerzen, die ihn begleiten könnten.«
»Das verstehe ich. Aber davor brauchst du keine Angst zu haben. In einem Krankenhaus kann man die Metastasen bestrahlen, und mit Morphium können die Schmerzen zusätzlich gelindert werden.«
Sekireh schüttelte den Kopf. »Wie ich schon sagte, von alldem verstehe ich nichts. Das gehört wohl zu der Heilkunde, die du in deiner Heimat erlernt hast. Ich möchte jedoch auf gar keinen Fall den Palast verlassen, zu keiner Zeit. Dies ist mein Zuhause, seit ich mit Nuhs Vater verheiratet wurde, und ich will hier sterben.«
»Ich respektiere diesen Wunsch. Dann werde ich eben mit Nuh II. reden. Er könnte einen Spezialisten hier in den Palast holen, der dir die geeigneten Schmerzmittel verschreibt. Vielleicht könnte man auch ...«
»Nein, du wirst mit niemandem darüber reden, auch nicht mit meinem Sohn!«, entgegnete Sekireh heftig. »Niemand soll von meiner Krankheit erfahren. Ich will weder Mitleid noch dass andere meine Schwäche ausnutzen.«
Beatrice nickte.
»Gut, wie du möchtest. Du kannst dich auf mich verlassen, Sekireh. Ich stehe unter Schweigepflicht.«
Sekireh nahm Beatrices Hand und drückte sie. »Ich danke dir. Ich danke dir auch für deine Offenheit. Ich kenne nur wenige Menschen in Buchara, die es gewagt hätten, mir die Wahrheit zu sagen. Das weiß ich zu schätzen.« Sie stützte sich auf ihren Stock und seufzte wieder. »Wenn es so weit ist, möchte ich, dass du für mich sorgst.«
Beatrice nickte wieder. »Ich werde tun, was ich kann.«
»Ich will jetzt gehen. Ich muss nachdenken.«
Beatrice half Sekireh beim Aufstehen und begleitete sie bis zur Tür.
»Du sprichst ausgezeichnet Arabisch», sagte Sekireh anerkennend. »Man könnte fast glauben, du seist hier aufgewachsen.«
»Vielen Dank für das Kompliment.« Natürlich übertrieb Sekireh ein bisschen. Beatrice fiel es selbst auf, wie schrecklich ihr Akzent manchmal klang und dass sie einige Worte immer wieder falsch aussprach, so dass sie einen anderen Sinn ergaben. Aber sie hatte in den knappen zwei Monaten so gut Arabisch gelernt, wie sie es selbst kaum für möglich gehalten hatte. Sie sprach zwar noch lange nicht fließend, aber sie konnte sich inzwischen gut unterhalten, und es gelang ihr sogar, einige Dialekte zu unterscheiden. »Ich habe eine ausgezeichnete Lehrerin. Mirwat hat sehr viel Zeit und Mühe für mich geopfert.«
»Nicht allein dem Lehrer, auch dem Schüler gebührt der Ruhm«, sagte Sekireh. »Zwei Monate sind keine lange Zeit, um eine fremde Sprache zu lernen.«
»Es fiel mir leicht. Arabisch ist eine so feine, wohlklingende Sprache. Je besser ich sie beherrsche, umso mehr lerne ich, sie zu lieben.«
»Du bist sehr bescheiden, meine Tochter, das gefällt mir«, erwiderte Sekireh und gab Beatrice überraschend einen Kuss auf die Wange. »Der Segen Allahs ruhe auf dir!«
Beatrice machte die Tür hinter Sekireh zu und trat ans offene Fenster. Die kühle, klare Morgenluft wehte ihr ins Gesicht, die Sterne begannen bereits zu verblassen. Sie war erstaunt, wie gefasst und ruhig Sekireh diese Hiobsbotschaft aufgenommen hatte. Sie hatte mit Tränen und lautem Wehklagen gerechnet, aber vielleicht hatte Sekireh bereits die Wahrheit geahnt. Was für eine starke Frau. Kein Wunder, dass sich die Männer, die nur bedingungslosen Gehorsam gewöhnt waren, vor ihr fürchteten.
Beatrice seufzte und schloss für einen Moment die Augen. Gespräche dieser Art nahmen sie immer mit. Trotz ihrer jahrelangen Erfahrung hatte sie sich nicht daran gewöhnt, und vermutlich würde sie sich auch niemals daran gewöhnen können. Es war nicht allein das Leid eines anderen Menschen, mit dem man konfrontiert wurde. Jedes Mal sah man dabei seinem eigenen Tod ins Gesicht. Niemand ist unsterblich. Auch Chirurgen nicht.
In diesem Augenblick begann der Muezzin mit seinem Morgengesang. Als Ungläubige brauchte sie an den Gebetszeiten nicht teilzunehmen, aber sie wusste, dass in allen anderen Zimmern die Frauen jetzt aufstanden, ihre Gebetsteppiche entrollten und in Richtung Mekka geneigt ihre Gebete sprachen. Wahrscheinlich auch Sekireh.
»Welch ein Start in den neuen Tag«, sagte Beatrice leise und spürte, wie ihr ein Schauer über den Rücken lief.
Am Abend gingen Beatrice und Mirwat im Garten spazieren – unverschleiert. Die »Stunde der Frauen« nannte Beatrice insgeheim diese zwei Stunden vor Sonnenuntergang, in denen sich jeden Abend die Frauen des Emirs im Garten aufhalten durften, ohne die nervtötende, zeitraubende Prozedur des Verschleierns auf sich nehmen zu müssen. Beatrice konnte sich jedes Mal wieder über die komplizierten Vorschriften ereifern, die den Umgang von Männern und Frauen regelten. In ihren Augen waren sie menschenverachtend. Sie vermochte nicht zu verstehen, wieso ihr, nur weil sie eine Frau war, in einigen Teilen des Palastes der Zugang strikt verboten war, oder weshalb sie andere, zu denen auch die traumhaft schöne Halle des Palastes gehörte, nur verschleiert und lediglich zu festen Zeiten betreten durfte. Jedes Mal, wenn Beatrice in die Halle wollte, musste sie sich verhüllen, bis nur noch die Augen sichtbar waren und sie sich vorkam wie ein Randalierer aus der Hausbesetzer-Szene. Es reichte nämlich nicht aus, sich einfach ein Tuch um den Kopf zu wickeln, um das Gesicht zu verhüllen; drei Lagen Stoff mussten genau nach Vorschrift angezogen werden. Immer wieder diskutierte sie mit Mirwat darüber und verlangte nach einer plausiblen Erklärung für diese Vorschriften. Mirwat antwortete stets mit Zitaten aus dem Koran. Obwohl Beatrice den Sinn dieser Antworten nicht immer verstand und versuchte Mirwat mit Argumenten zu widerlegen, verlor die Freundin nicht ihre Geduld. Mit der Zeit wurde Beatrice der ewig gleich lautenden Antworten müde und sie begann zu akzeptieren, dass es für religiöse Ansichten keine Argumente gab, über die man diskutieren konnte – entweder man glaubte daran oder eben nicht.
Die beiden Frauen schlenderten auf den Wegen des Gartens, vorbei an plätschernden Brunnen und blühenden Obstbäumen. Mirwat beschrieb ausführlich ein Kleid, das sie sich gerade anfertigen ließ. Nuh II. ibn Mansur wusste davon nichts, sie plante es als eine Überraschung für ihn zu seinem Sieg beim nächsten Pferderennen.
»Und wenn er nicht siegen sollte?«, fragte Beatrice. Manchmal ging ihr Mirwats zum größten Teil belangloses Geplauder auf die Nerven, aber heute ließ sie sich gern von der Freundin ablenken. Das Gespräch mit Sekireh am Morgen lastete noch schwer auf ihrem Gemüt. »Das ist doch immerhin möglich.«
»Dann werde ich in diesem Kleid dafür sorgen, dass er seinen Schmerz und seine Trauer vergisst«, antwortete Mirwat ohne zu zögern. »Aber er wird siegen, ich weiß es.«
Beatrice verdrehte die Augen und schüttelte verständnislos den Kopf. Wie konnte sich nur eine intelligente, hübsche Frau wie Mirwat in Nuh II. ibn Mansur verlieben? Aus wirtschaftlichen Gründen war diese Beziehung durchaus nachzuvollziehen. Nuh II. war schließlich der Emir von Buchara und damit nicht nur der mächtigste, sondern auch der reichste Mann in dieser Stadt. Er überhäufte die Frauen mit großzügigen Geschenken, kostbarem Schmuck, edlen Stoffen, Parfum. Natürlich profitierte besonders seine Lieblingsfrau Mirwat von diesen Gaben. Erst vor wenigen Tagen hatte Nuh II. ihr ein besonders wertvolles Geschenk gemacht – eine makellose schneeweiße Schimmelstute, deren Stammbaum sich angeblich direkt zu der Lieblingsstute des Propheten zurückverfolgen ließ. Dieses Pferd war so kostbar, dass Mirwat sich im Falle eines Verkaufs von dem Erlös einen eigenen kleinen Palast hätte bauen lassen können. Dabei konnte sie noch nicht einmal reiten. Im Gegenteil, sie hatte sogar Angst vor Pferden, wie sie Beatrice im Vertrauen erzählte. Aber reichte diese Großzügigkeit aus, um sich auf das nächtliche Zusammensein mit einem aufgedunsenen, schweinsäugigen Mann zu freuen, der mehr als doppelt so alt war wie sie selbst? Denn eines war Beatrice schnell klar geworden – so seltsam es klang, aber Mirwat liebte Nuh, diesen schwammigen, blutdruckkranken Choleriker, wirklich. Beatrice schüttelte sich bei dem bloßen Gedanken daran. Zum Glück hatte Nuh es bislang nicht gewagt sie anzurühren, ein Umstand, über den sich alle Frauen hier im Harem zu wundern schienen.
Mirwat fuhr fort, von der Goldstickerei am Saum ihres neuen Kleides zu schwärmen, und Beatrice ließ dabei ihren Blick durch den Garten schweifen.
Bei Tage legte sich eine träge Schläfrigkeit über den Palast und seine Bewohner; alles versank im Staub der nahen Wüste, die man die Rote Wüste nannte. In der gleißenden Sonne wirkte sogar der Garten fahl und grau. Selbst das fröhliche Zwitschern der Vögel und das beruhigende Plätschern der Brunnen verstummte unter den brennenden Sonnenstrahlen. Alles war still. Nur manchmal blökte irgendwo ein Schaf, das behäbig im Schatten eines Baums döste. Wer es sich leisten konnte, flüchtete vor der flirrenden Hitze in den Schutz kühler Mauern. Erst gegen Abend kam ein erfrischender Wind auf und brachte von den nahen Bergen die lang ersehnte Abkühlung für Menschen und Tiere. In diesen Stunden erwachte der Palast zu neuem Leben. Die Brunnen plätscherten leise, und der eigentümliche Schrei der Pfauen hallte durch den Garten. Dienerinnen eilten umher, zündeten zahllose Lampen an und brachten den Spaziergängern frisches Obst, Säfte und gezuckertes Zitronenwasser. Der ganze Garten glich einem hell erleuchteten Festplatz. Der betörende Duft der Blumen legte sich schwer über den Garten, und ihre satten Farben – alle Schattierungen von rot, violett, orange und gelb – leuchteten intensiv im schwindenden Tageslicht. Der Palast selbst mit seinen rosa schimmernden Mauern und den goldenen Kuppeln sah aus wie ein kostbares Juwel.
Beatrice liebte diese zwei Stunden. Schon allein aus klimatischen Gründen waren sie die schönsten Stunden des ganzen Tages. Vorher war es zu heiß, und nur kurze Zeit später, wenn die Frauen den Garten wieder verlassen hatten, wurde es so kühl, dass die Diener Kohlebecken aufstellen mussten und die Männer dicke wollene Umhänge bei ihren Spaziergängen trugen. Oft kam es Beatrice vor, als wäre sie mitten in einem orientalischen Märchen gelandet. Die Gedanken an eine Flucht hatte sie immer noch nicht aufgegeben. Mirwat beantwortete zwar nie ihre Fragen nach der Umgebung, nach Zug-, Flug- oder Busverbindungen. Meistens tat sie sogar, als wüsste sie nicht, wovon Beatrice überhaupt sprach. Dennoch war Beatrice sicher, dass es ihr irgendwann gelingen würde zu fliehen. Irgendjemand würde ihr eines Tages die Informationen liefern, die sie brauchte. Sie hatte Zeit. Aber wenn sie dann endlich wieder zu Hause war, würde sie sich immer an dieses Licht, diese Farben und diesen Duft erinnern, und sie wusste jetzt schon, dass sie »die Stunde der Frauen« im Garten des Palastes vermissen würde.
Beatrice beobachtete zwei alte Frauen, die ins Gespräch vertieft auf einer steinernen Bank saßen. Die beiden ließen sich nicht einmal von den kleinen Mädchen stören, an ihrer kostbaren Kleidung als Töchter des Emirs zu erkennen, die kreischend und lachend an ihnen vorbeiliefen. Dann hob die eine Frau ihren Kopf, und Beatrice erkannte Sekireh. Die Alte nickte ihr freundlich zu und setzte ihr Gespräch fort.
»Sekireh hat dich gegrüßt«, bemerkte Mirwat. »Du musst sie sehr beeindruckt haben.«
Beatrice sah Mirwat überrascht an. Hatte sie sich getäuscht, oder war die Freundin etwa eifersüchtig?
»Vielleicht hat sie auch dich gemeint?«
Mirwat lachte auf. »Mich? Bei allen Heiligen Allahs, Sekireh würde mich niemals so freundlich ansehen. Dabei kann ich froh sein, dass sie mich nur ignoriert. Als Fatma noch Nuhs Lieblingsfrau war, hatte sie mehr unter der alten Hexe zu leiden.«
Die Bitterkeit in Mirwats Stimme war deutlich. Und Beatrice hatte den Eindruck, dass diese Ignoranz Mirwat entgegen ihrer Behauptung mehr traf, als es Gemeinheiten und Bosheiten vermocht hätten.
»Ist es wahr, dass die Alte bald sterben muss?«
Beatrice erstarrte fast vor Schreck. Woher wusste Mirwat davon? Sie war doch mit Sekireh allein im Zimmer gewesen, als sie ihr die Diagnose eröffnet hatte.
»Sekireh war heute früh ziemlich lange bei dir«, fuhr Mirwat fort, ohne Beatrices Antwort abzuwarten. »Woher um alles in der Welt ...«, platzte Beatrice heraus.
Mirwat lachte wieder. »Du glaubst doch nicht, dass hier irgendein Geheimnis lange verborgen bleibt. Fatmas Dienerin hat Sekireh noch vor dem Morgengebet vor deiner Tür stehen sehen. Sie war gerade auf dem Weg zur Küche, um Fatma ein paar Datteln zu holen. Wahrscheinlich hat die Alte sie nicht bemerkt, denn sie ging zu dir ins Zimmer und kam erst nach fast einer Stunde wieder heraus.«
Beatrice schüttelte den Kopf. Vermutlich hatte also Fatmas Dienerin die ganze Zeit die Tür beobachtet. War denn hier wirklich gar nichts sicher? Gab es überhaupt keine Privatsphäre? Musste denn jeder dem anderen nachspionieren?
»Nun? Wann wird das alte Weib endlich sterben?«
»Woher willst du denn wissen, ob Sekireh überhaupt krank ist?«
»Komm schon, Beatrice, mach dich nicht lächerlich. Der ganze Palast weiß doch davon, dass Sekireh sich seit einiger Zeit immer schlechter fühlt. Die häufigen Bäder und ihre Besuche bei Samira sind niemandem verborgen geblieben. Und ihre Dienerin hat Nirman im Vertrauen erzählt, wie mager Sekireh in den letzten zwei Monaten geworden ist.«
»Ach, also ganz im Vertrauen!« Beatrice schüttelte erneut den Kopf. »Ich möchte nicht mit dir darüber sprechen, Mirwat. Sekireh hat sich mir anvertraut und ich ...«
Mirwat nickte langsam. »Also ist es wirklich wahr«, sagte sie leise und triumphierend. »Die Tage der Alten sind gezählt!«
»Selbst wenn du mit dieser Vermutung Recht hättest, geht es dich überhaupt nichts an!«, entgegnete Beatrice scharf. »Das ist allein Sekirehs Angelegenheit. Wenn du unbedingt mehr darüber wissen willst, frage sie selbst.«
Lächelnd legte Mirwat Beatrice eine Hand auf den Arm. »Rege dich nicht auf. Den meisten Menschen in Buchara tust du damit einen großen Gefallen. Es wird Zeit, dass die Alte endlich für immer die Augen schließt und ihren Platz freigibt. Doch ich bete zu Allah, dass er ihr in ihren letzten Tagen wenigstens einen Teil des Leids zurückzahlt, das sie anderen zugefügt hat.«
Keine Sorge, das hat er bereits getan, dachte Beatrice bitter. Am liebsten hätte sie Mirwat beim Kragen gepackt und sie geschüttelt. Am liebsten hätte sie ihr die ganze Wahrheit erzählt, ihr erklärt, welche Qualen der alten Frau noch bevorstanden. Aber selbst wenn sie nicht unter Schweigepflicht gestanden hätte, bezweifelte sie, dass diese Nachricht in Mirwat auch nur ein Fünkchen eines schlechten Gewissens ausgelöst hätte. Im Gegenteil. Vermutlich hätte Mirwat ihr Wissen nur ausgenutzt, um die arme Frau noch zusätzlich zu quälen.
Mirwat hakte sich wieder bei Beatrice ein. »Nun zerbrich dir darüber nicht den Kopf, Beatrice. Dies ist der Lauf des Lebens. Jedem von uns ist nur eine gewisse Lebensspanne gegeben, und allein Allah bestimmt, wann das Ende gekommen ist. Das einzig Traurige daran ist, da pflichte ich dir bei, dass Sekireh es in fast siebzig Lebensjahren nicht vermocht hat, sich einen Platz in den Herzen der Menschen zu erobern. Nicht einmal Nuh II. wird ehrlich um sie trauern. Vielleicht weiß sie es sogar.« Mirwat seufzte. »Möge Allah mich davor bewahren, mein eigenes Leben derart zu vergeuden.«
Beatrice sah Mirwat nachdenklich an. Wirklich, wenn dies das Ziel des Lebens sein sollte, dann hatte Mirwat es bereits erreicht. Jeder im Palast schien sie zu mögen. Die anderen Frauen unterhielten sich gern mit ihr und suchten ständig ihre Gesellschaft. Aber auch die Dienerinnen gehorchten ihr mehr als den anderen Frauen, sie lasen ihr förmlich jeden Wunsch von den Augen ab. Und das lag nicht allein an Mirwats Stellung im Harem als Lieblingsfrau des Emirs. Die Mädchen vergötterten sie geradezu. Von den anderen Frauen, die niemals zufrieden waren mit ihrer Arbeit, wurden die armen Dinger den ganzen Tag herumgescheucht. Sie waren die Rammböcke für Launen, die die Frauen sonst nirgendwo abreagieren konnten oder durften. Sie wurden beschimpft und manchmal sogar geschlagen. Mirwat hingegen hatte immer ein freundliches Wort, ein Lächeln oder ein offenes Ohr für die Dienerinnen. Tatsächlich war Mirwat in diesem Punkt fast das genaue Gegenteil von Sekireh.
»... muss sehr erfüllend sein oder sehe ich das falsch?«
Erst jetzt bemerkte Beatrice, dass Mirwat die ganze Zeit über mit ihr gesprochen hatte. »Entschuldige, aber ich habe nicht zugehört. Was hast du gerade gesagt?«
Mirwat lachte. »Wo bist du nur mit deinen Gedanken? Ich sagte gerade, die Heilkunst zu beherrschen, stelle ich mir sehr erfüllend vor. Du hast Macht über die Menschen. Sie vertrauen dir, sehen zu dir auf, achten dich. Schau dir nur Ali al-Hussein an. Er ist ein gut aussehender, wohlhabender Mann. Aber wenn er kein Arzt wäre, hätte er niemals solchen Ruhm erlangt.«
»Da magst du Recht haben. Doch wenn ich ehrlich bin, habe ich es noch nie von dieser Seite betrachtet. Ich habe aus anderen Gründen Medizin studiert.«
»Welche Gründe waren das?«
Tja, welche Gründe waren das? Gute Frage. Beatrice dachte nach. Natürlich konnte sie Mirwat von all den edlen Motiven erzählen, die mit dem Arztberuf verknüpft waren – anderen Menschen helfen, Leben retten, Leiden verhindern und so weiter. Sicher, auch dies war für ihre Berufswahl entscheidend gewesen. Aber eigentlich gab es keinen echten Grund, keinen Auslöser. Sie machte ihren Job gern, er war ein Teil ihrer Persönlichkeit. Warum, darüber hatte sie noch nie wirklich nachgedacht. Sie zuckte mit den Schultern.
»Keine Ahnung«, sagte sie wahrheitsgemäß. »Es hat sich so ergeben. Ebenso gut hätte ich wahrscheinlich Anwältin oder Architektin werden können.«
»Erzähle mir von deiner Heimat«, bat Mirwat, nahm auf einer Bank Platz und sah Beatrice mit den großen, erwartungsvollen Augen eines Kindes an, das auf eine spannende Geschichte hofft. »Ich möchte mehr erfahren über ein Land, in dem eine Frau wie ein Mann studieren kann. Es muss ein seltsames Land sein. Ich hoffe, du verzeihst mir meine Neugierde.«
»Selbstverständlich«, erwiderte Beatrice lächelnd.
Mirwat hatte ihr viel von sich erzählt, von ihrer Kindheit im Hause ihres Vaters, einem wohlhabenden Teppichhändler, von ihren Schwestern und Brüdern. Beatrice wusste fast alles über sie. Dennoch wurde sie manchmal aus Mirwat nicht schlau. Sie sprach zwar Latein und Altgriechisch, als hätte sie eine höhere Schule besucht, erzählte aber nie von ihren Lehrern oder Mitschülern; und manchmal wusste sie die einfachsten Dinge nicht. Nun, vermutlich hatte sie Buchara niemals verlassen, und der Rest der Welt hatte sie bislang nicht interessiert.
Beatrice setzte sich neben sie. Die Bank stand am Rande eines kleinen Teichs. Der Mond war bereits aufgegangen, und seine schmale, orientalisch-perfekte Sichel spiegelte sich in dem klaren, stillen Wasser. Zwischen den Obstbäumen, Rosenbüschen, Lilien und Malven am Ufer konnte man die Kuppeln und Türme des Palastes sehen. Die Luft war erfüllt vom Blütenduft. Mücken tanzten auf der Wasseroberfläche, und manchmal sprang ein Fisch nach den Insekten.
Wie ein Bild aus einem Katalog für Luxusreisen!, dachte Beatrice.
Leider war dies kein Urlaub. Der Palast war kein Fünfsternehotel. Und sie hatte sich nichts davon selbst ausgesucht. Mirwat hatte in ihrer Unbefangenheit wieder hervorgeholt, was Beatrice mühsam zu verdrängen versuchte – sie war eine Gefangene. Sie schloss einen Moment lang die Augen und schluckte den Kloß hinunter, der sich in ihrem Hals gebildet hatte. Aber ein bitterer Geschmack blieb. »Ich wohne in Hamburg. Das ist eine große Stadt in Nord...« Beatrice brach ab, als ihr bewusst wurde, dass sie noch kein arabisches Wort für Deutschland kannte. »Eine große Stadt im Norden von Germanien«, vollendete sie ihren Satz. Wenn ihr Arabisch nicht reichte, konnte sie sich wenigstens mit Latein helfen.
»Germanien? Wirklich?«, fragte Mirwat erstaunt. »Das überrascht mich aber. Nach allem, was man mir erzählt hat, scheint Germanien ein unzivilisiertes Land zu sein.«
»Na, das will ich aber überhört haben!«
»Verzeih, ich wollte dich nicht kränken. Bisher erzählte man mir jedoch nur von dichten Wäldern und wilden Tieren, nicht von großen Städten, Schulen und Universitäten. Ist es wahr, dass in Germanien die Menschen nur einmal in ihrem Leben baden, nämlich wenn sie geboren werden?«
Beatrice lachte laut auf. Mirwat lebte wirklich hinterm Mond. Sie schien tatsächlich zu glauben, dass die Deutschen noch Keulen schwingend durch die Wälder sprangen und Wölfe jagten.
»Nein. Auch bei uns sind die Regeln der Hygiene durchaus bekannt. Wir waschen und baden uns täglich.«
Wenigstens die meisten von uns, fügte Beatrice in Gedanken hinzu und dachte an die Obdachlosen, die bei ihnen in der Notaufnahme landeten und von denen viele monatelang keinen Kontakt mit Wasser und Seife hatten. Oft genug zogen die Schwestern und Pfleger sie nicht nur mit Handschuhen, sondern auch noch mit Mundschutz aus, und die schmutzigen, stinkenden Kleidungsstücke wanderten auf direktem Weg in blauen Säcken auf den Müll.
»Das ist ja interessant«, sagte Mirwat staunend. »Und es gibt sogar große Städte bei euch in Germanien? Sind sie etwa so groß wie Buchara?«
Wieder musste Beatrice lachen. Wenn sie sich nicht täuschte, hatte Buchara höchstens zwanzigtausend Einwohner.
»Selbstverständlich! Berlin, Frankfurt, Köln und Düsseldorf zum Beispiel, und natürlich Hamburg. Wir haben zwar nicht so große Städte wie die USA ...«
»USA?«
»Ja, die ...«
Komisch, dachte Beatrice. Wie heißen die Vereinigten Staaten auf Arabisch?
»Na, Amerika. Du weißt doch – New York, Chicago, San Francisco ...«
Mirwat schüttelte verständnislos den Kopf. »Ich weiß nicht, wovon du sprichst.«
Beatrice bekam langsam Zweifel. Vielleicht war ihr Arabisch doch nicht so gut, wie sie gedacht hatte.
»Gibt es hier einen Atlas oder eine Landkarte?«, fragte sie. »Dann zeige ich es dir.«
»Eigentlich dürfen wir das nicht«, sagte Mirwat zögernd. Sie dachte angestrengt nach. »Nuh II. ist heute den ganzen Tag auf der Jagd und wird nicht vor morgen zurückerwartet.« Plötzlich straffte sich ihr Körper, und ihre dunklen Augen begannen abenteuerlustig zu funkeln. »Ich werde uns eine Landkarte besorgen. Sei in drei Stunden, wenn sich alle anderen zur Ruhe begeben haben, bei mir.«
Drei Stunden später klopfte Beatrice an Mirwats Tür. Mirwat öffnete ihr persönlich.
»Komm schnell herein«, flüsterte sie, schaute rechts und links den Gang hinunter und zog die überraschte Beatrice hastig in ihr Zimmer. »Hat dich jemand gesehen?« »Nein, ich glaube nicht«, antwortete Beatrice und fing unwillkürlich an, ebenfalls zu flüstern. Sie kam sich vor, als wäre sie im Begriff, etwas überaus Verwerfliches zu tun. Dabei wollte sie doch nur Mirwat auf einer Landkarte etwas zeigen.
»Ich habe Nirman weggeschickt«, sagte Mirwat und schob so leise wie möglich den Riegel vor die Tür. »Wir sind allein. Komm.«
Sie zerrte Beatrice am Ärmel zu ihrem Bett. Im Zimmer war es ziemlich dunkel. Nur eine einzelne, winzige Öllampe, die Mirwat irgendwo hinter dem Vorhang ihres Betts aufgestellt hatte, spendete Licht. Die spärliche Beleuchtung reichte kaum aus, die Möbel zu unterscheiden. Beatrice fragte sich, was die Freundin vorhatte. Vorsichtig, um sich nicht an einer Tischkante zu verletzen oder über einen Teppich oder ein Kissen zu stolpern, tastete sie sich voran. Obwohl draußen finstere Nacht herrschte, waren die Fensterläden geschlossen. Mirwat hatte sogar die Vorhänge zugezogen, als fürchtete sie, dass jemand trotz der Dunkelheit von draußen hereinsehen konnte. Was um alles in der Welt hatte das zu bedeuten? Beatrice kam sich wie eine Verschwörerin vor, die eine Palastrevolte plante.
Doch bevor sie Mirwat fragen konnte, schob die Freundin sie auf ihr Bett, zog hastig die Vorhänge des Baldachins zu und stellte die Lampe zwischen sie. Dabei schien es Mirwat keineswegs zu beunruhigen, dass die Öllampe jederzeit auf den weichen Matratzen umfallen und das Bett in Brand stecken konnte.
»Hier ist die Karte«, flüsterte sie und kicherte vor Aufregung wie ein junges Mädchen.
Beatrice warf einen zweifelnden Blick auf die schwankende Lampe und nahm dann die Rolle. Sie fühlte sich seltsam fest an, als ob es sich um ölgetränktes Pergament oder gar Leder handelte, wie es vor Jahrhunderten zur Herstellung von Landkarten verwendet worden war. Sie öffnete die Schnur, entrollte die Karte – und von einer Sekunde zur nächsten war es ihr egal, ob das Bett Feuer fing. Mit angehaltenem Atem starrte sie auf die Karte.
Vor ihr lag die Welt, wie sie die arabischen Völker vor Jahrhunderten gesehen hatten. Da waren der vordere Orient, Euphrat und Tigris, ein Teil von Indien und Pakistan. Am Rande lagen Westeuropa, die Britischen Inseln waren nur eben angedeutet, ein seltsam geformtes Skandinavien beherrschte den Norden. Ehrfürchtig glitten ihre Finger über die Jahreszahl, die der Zeichner der Karte in die Ecke geschrieben hatte – 387. Wenn man die muslimische Zeitrechnung berücksichtigte, die mit dem Jahr 622 begann, war diese Karte fast eintausend Jahre alt. Es war die älteste Karte, die Beatrice jemals gesehen hatte. Dabei war sie in einem mehr als hervorragenden Zustand.
Beatrice erinnerte sich daran, dass ihre Tante auf einer Auktion einmal eine Landkarte ersteigert hatte. Die war nur fünfhundert Jahre alt und nicht einmal halb so gut erhalten gewesen wie diese hier. Das Leder war fleckig und an zwei Stellen eingerissen, die Farbe war vergilbt und die Tinte zum Teil kaum lesbar. Ihre Tante hatte zwanzigtausend Mark ausgegeben und den Handel damals sogar noch ein Schnäppchen genannt. Was mochte dann wohl diese Karte wert sein?
»Mirwat, woher hast du diese Karte?«, fragte Beatrice aufgeregt.
»Ich habe sie aus der Truhe in Nuhs Schreibzimmer genommen«, antwortete Mirwat. »Wieso? Stimmt etwas nicht?«
Beatrice starrte wieder die Karte an, Schauer liefen über ihren Rücken.
»Diese Karte ist uralt!«
»Nein, du irrst dich«, entgegnete Mirwat und schüttelte den Kopf. »Mein Vater hat sie Nuh II. letztes Jahr zu unserer Hochzeit geschenkt. Und er würde ihm doch keine alte Karte schenken!«
»Du verstehst mich falsch, Mirwat. Die Karte ist nicht veraltet. Ich meine, natürlich ist sie veraltet im modernen Sinne. Ich würde mich nicht nach dieser Karte richten, wenn ich unterwegs wäre. Viele Grenzen sind falsch, Amerika und Australien fehlen ganz. Aber sie ist alt, wirklich alt, eine Antiquität! Wenn die Jahreszahl tatsächlich stimmt, wovon ich ausgehe, ist sie sogar über tausend Jahre alt. Kannst du dir vorstellen, wie wertvoll so eine Karte ist?«
Mirwat schüttelte heftig den Kopf. »Tausend Jahre? Du verwirrst mich. Mein Vater hat sie vor zwei Jahren auf einer seiner Handelsreisen in Basra gekauft. Der Kartenschreiber hatte sie gerade erst nach den Angaben von Ahmad ibn Fadlan fertiggestellt und ...«
»Ach, dann ist es nur eine Kopie.« Beatrice konnte ihre Enttäuschung kaum verbergen. Dies war nur eine Replik, auch wenn sie erstklassig ausgeführt war. Aber warum hatte sie das nicht erkannt? Normalerweise hatte sie einen guten Blick dafür. Während Beatrice noch darüber nachdachte, breitete sich in ihrem Magen ein seltsames Gefühl aus. Irgendetwas an dem Namen, den Mirwat genannt hatte, stimmte nicht. Ahmad ibn Fadlan. Wo hatte sie diesen Namen schon mal gehört? Oder hatte sie diesen Namen gelesen? Aber wenn sie ihn gelesen hatte, musste es noch in Hamburg gewesen sein, denn seit sie hier war, hatte sie nichts Gedrucktes in den Händen gehabt, weder ein Buch noch eine Zeitung ...
»Diese Karte ist auf dem neuesten Stand!« Mirwat wirkte ziemlich erbost und vergaß sogar, leise zu sprechen.
»Mirwat, es tut mir Leid, ich wollte dich nicht ...«, versuchte Beatrice die Freundin zu beschwichtigen, doch Mirwat fiel ihr aufgebracht ins Wort.
»Mein Vater hat sogar mit dem Zeichner gesprochen. Die Angaben Ahmad ibn Fadlans gelten immer noch als die ausführlichsten und besten, was den Norden betrifft. Der Mann wird doch nicht lügen. Und außerdem, was verstehst du schon von Landkarten.«
»Ich gebe zu, ich verstehe wahrscheinlich wirklich nicht viel davon«, sagte Beatrice zerstreut. Das Gefühl im Magen verstärkte sich und wuchs zu einer Übelkeit heran. Da war dieser Name schon wieder. Woher kannte sie ihn bloß? Es hatte keinen Zweck, es wollte ihr einfach nicht einfallen. Aber vielleicht wusste Mirwat mehr? »Es tut mir wirklich Leid, Mirwat. Vergiss einfach, was ich zu dir gesagt habe. Erzähle mir stattdessen lieber von diesem Ahmad ibn Fadlan.«
»Du kennst ihn nicht?« Mirwat schüttelte ungläubig den Kopf. »Dabei kennt ihn hier jedes Kind. Meine Brüder haben die Geschichten über ihn geliebt. Ahmad ibn Fadlan ist schon seit einigen Jahren tot. Aber als er ein junger Mann war, wurde er vom Kalifen von Bagdad auf eine lange Reise geschickt, die ihn schließlich zu den Nordmännern führte. Er hat dort ...«
In diesem Augenblick fiel Beatrice wieder ein, woher sie diesen Namen kannte. Der dreizehnte Krieger, der Film von Michael Crichton. Sie liebte diesen Film und hatte den Roman mindestens schon dreimal gelesen. Beatrice wurde übel. Da stimmte doch etwas nicht! Mirwat wollte sie zum Narren halten.
»Aber Mirwat, das kann nicht sein. Du kannst doch nicht ernsthaft behaupten, dass sich eure Kartenzeichner immer noch nach seinen Angaben richten.«
»Warum denn nicht? Die Welt ändert sich nicht so schnell.«
Beatrice rang die Hände. »Nicht so schnell? Mirwat, dieser ibn Fadlan ist zwar eine historische Persönlichkeit, aber er hat irgendwann kurz vor der ersten Jahrtausendwende gelebt. Er ist schon seit fast tausend Jahren tot! Seit er die Nordmänner traf, wurden Amerika und Australien entdeckt. Das kann doch nicht an euch hier in Buchara vorübergegangen sein! Weißt du, welches Jahr wir gerade haben?«
»Natürlich! 389!«
Die erstaunte Antwort kam so prompt, dass Beatrice zusammenzuckte. Sie rechnete in Gedanken schnell nach. Offensichtlich war Mirwat davon überzeugt, dass sie sich in einem Jahr um die erste Jahrtausendwende herum befanden. Beatrice spürte, wie ihr Magen Purzelbäume schlug und ihr Dinge einfielen, auf die sie bislang kaum geachtet hatte. »Du irrst dich, Mirwat.« Keine Elektrizität. »Das stimmt nicht.« Keine modernen sanitären Anlagen. »Wir haben das Jahr 2001.« Keine Autos. »Hast du schon mal daran gedacht, zum Arzt zu gehen?« Kein Radio, kein Fernsehen, keine Bücher, keine Zeitschriften. »Du solltest dich untersuchen lassen.« Die antiquierten medizinischen Instrumente. »Vielleicht kann der Arzt ...«
Beatrice brach ab. Sie erinnerte sich an die Frauen im Kerker des Sklavenhändlers, ihre schiefen Zähne, das vereiterte Auge. Sie erinnerte sich auch an die Hilflosigkeit des Arztes anlässlich Mirwats Unfall. Im Mittelalter hatte man natürlich keine Antibiotika gehabt, Luftröhrenschnitte waren damals unbekannt. Aber das war doch ...
»Unmöglich!«, japste sie. Ihr Hals schnürte sich zu, sie bekam kaum noch Luft, der Herzschlag dröhnte in ihren Ohren. »Es ist das Jahr 2001!«
Dennoch – irgendwo in einem Winkel ihres Gehirns dämmerte die Erkenntnis, dass Mirwat, so unwahrscheinlich es auch klingen mochte, Recht hatte. Es passte alles zusammen, fügte sich aneinander wie die richtigen Puzzleteile – die Männer, die mit Federkielen schrieben; die Mädchen, die Waschschüsseln und Wasserkrüge heranschleppten, anstatt die Dusche anzustellen oder Badewasser einzulassen; das Fehlen jeglichen Motorenlärms; Mirwats Unkenntnis über Deutschland und Amerika; die veraltete Landkarte und ihr hervorragender Zustand. Natürlich konnte Buchara auch eine mittelalterliche Enklave sein, eine Ansammlung von Freaks, die rigoros jeden Fortschritt ablehnten, ähnlich den Amish-People in Amerika. Allerdings wussten die Amish, dass es Autos, Strom und Fernseher gab, sie kannten die aktuelle Jahreszahl und wussten von der modernen Welt außerhalb ihrer eigenen Dörfer. Hier hingegen hörte man nicht einmal ein Flugzeug, das in der Ferne an Buchara vorbeiflog. Blieb also nur noch eine Möglichkeit übrig ...
»Beatrice, was ist mit dir, du bist plötzlich so blass!«, rief Mirwat und ergriff besorgt ihre Hand. »Soll ich den Arzt holen?«
Beatrice schüttelte den Kopf und versuchte aufzustehen. Das Fenster! Ich brauche frische Luft!, dachte sie noch. Dann begann sich die Welt zu drehen und wurde schwarz.
Als Beatrice wieder zu sich kam, lag sie auf Mirwats Bett. Die Vorhänge des Baldachins waren zurückgezogen, die Fensterläden geöffnet. Ein frischer Luftzug wehte herein und vertrieb langsam den seltsamen Geruch nach verbranntem Stoff. Draußen war es immer noch dunkel, und Beatrice konnte die Sterne sehen. Es waren unendlich viele, mehr, als sie jemals gesehen hatte.
Mirwat beugte sich über sie und wischte ihr mit einem feuchten Tuch die Stirn ab.
»Was ist geschehen?«, fragte Beatrice leise.
»Du bist plötzlich ohnmächtig geworden. Dabei hast du die Lampe umgestoßen. Aber keine Angst«, beschwichtigte Mirwat sie sofort, »es ist nichts passiert. Die Landkarte ist unversehrt, und das kleine Brandloch in der Bettdecke wird niemandem auffallen.«
Natürlich! Die Landkarte und die Jahreszahl, die der Zeichner darauf vermerkt hatte. Als Beatrice alles wieder einfiel, wurde ihr erneut schwindlig. Konnte es sein, dass sie, eine moderne Frau Anfang dreißig, im Mittelalter gelandet war? Das klang nach Sciencefiction, nach Wurmloch, nach irgendeinem Fantasyroman oder einer verrückten Fernsehserie, aber doch nicht nach der Realität. Andererseits träumte sie nicht. Es war alles wirklich. Sie spürte die seidenen Laken, auf denen sie lag. Sie fühlte Mirwats Hand auf ihrer Wange. Sie roch sogar den Jasminduft, der von der Kleidung der Freundin ausging. Sie hatte zwei Monate lang jeden einzelnen Tag, jede einzelne Stunde erlebt. Sie hatte gegessen, geschlafen, geträumt ... Plötzlich liefen ihr Tränen über die Wangen, und sie begann hemmungslos zu schluchzen.
»Soll ich nicht lieber doch den Arzt rufen?«, fragte Mirwat und strich ihr das Haar aus dem Gesicht.
Doch Beatrice schüttelte heftig den Kopf. Der Arzt war der Letzte, den sie jetzt sehen wollte. Allein die Erinnerung an seine große lederne Tasche mit den Gerätschaften, die eher Folterwerkzeugen als chirurgischen Instrumenten glichen, jagte ihr Schauer über den Rücken. Unter Umständen käme er sogar auf den Gedanken, das eine oder andere davon an ihr auszuprobieren. Dass es sich möglicherweise bei den antiquierten Messern und Haken tatsächlich um die neuesten Errungenschaften der Medizin handeln mochte, versuchte sie vergeblich zu verdrängen. Ihr wurde übel.
»Das kann nicht wahr sein!«, stieß sie hervor. »Das ist doch völlig verrückt! Mirwat, bitte sage mir, dass du mich ärgern wolltest. Bitte sage mir, dass jetzt das Jahr 2001 ist!«
Mirwat sah sie traurig an und schüttelte langsam den Kopf. »Es tut mir wirklich Leid, aber ...«
»Nein!« Ihr Schrei gellte durch den Raum. »Du lügst! Das kann nicht wahr sein!« Sie warf die Decken ab und sprang auf.
»Wo willst du hin?«
»Ich muss jemand anderen fragen, egal, wen. Ganz gleich, ob jemanden hier im Palast oder auf der Straße. Irgendwer muss mir doch die Wahrheit sagen können.«
»Beatrice, tu das nicht!« Mirwat packte ihren Arm und hielt sie mit erstaunlicher Kraft zurück. »Wenn du jetzt gehst und ein anderer dich in diesem Zustand sieht, wird man dich für verrückt halten. Und dann werden sie dich einsperren oder fortjagen. Also sei bitte vernünftig und bleibe hier.«
Beatrice starrte auf den Boden. Eine innere Stimme sagte ihr, dass Mirwat Recht hatte. Wenn dies eine Verschwörung war, dann steckten sowieso alle hier im Palast dahinter. Außerdem hatte man tatsächlich früher die psychisch Kranken in finstere Verliese gesperrt oder sie grausamer Torturen unterzogen. Man würde sicherlich nicht zimperlich mit ihr umgehen – falls dies hier das Mittelalter war. Sie setzte sich auf die Bettkante.
»Gut, so ist es richtig.« Mirwat atmete hörbar auf. »Ali al-Hussein sagte schon, dass es unter Umständen einen Rückfall geben könnte. Ich hatte bisher gehofft, dass er sich irrt!«
Doch Beatrice achtete gar nicht auf ihre Worte. Sie mochte sich nicht vorstellen, dass Mirwat sie derart täuschen könnte. Sie hatte mit dieser Frau in den vergangenen Wochen so viel Zeit verbracht, dass sie schon fast glaubte, sie seit einer Ewigkeit zu kennen. Dennoch, für Nuh II. würde Mirwat wahrscheinlich alles tun – sogar eine Freundin belügen, wenn er es verlangte. Aber dann, das wusste Beatrice mit Sicherheit, würde Mirwat ihr auf eine direkte Frage nicht in die Augen sehen können. Es kam also auf einen Versuch an.
»Mirwat, sieh mich an. Bitte, ich flehe dich an, sage mir die Wahrheit.« Beschwörend nahm sie die Hände der Freundin. »Welches Jahr haben wir jetzt?«
»Wir schreiben das Jahr 389«, antwortete Mirwat ruhig und sah Beatrice so gerade und offen ins Gesicht, dass sich jeder Zweifel an ihrer Aufrichtigkeit auf der Stelle in Luft auflöste.
»Dann ist es also doch wahr«, murmelte Beatrice und starrte auf die ineinander verschränkten Hände in ihrem Schoß. »Ich bin tatsächlich im Mittelalter gelandet, wie und wodurch auch immer.«
Mirwat sah sie verständnislos an. »Wovon sprichst du? Was meinst du damit?«
»Ich bin ...« Beatrice brach ab. Was sollte sie der Freundin erzählen? Dass sie eine Zeitreisende, eine Frau aus der Zukunft war? Wie sollte sie Mirwat etwas erklären, was sie selbst nicht verstand – und nicht einmal glauben konnte? Sie versuchte sich vorzustellen, wie sie selbst reagieren würde. Angenommen, auf die Aufnahmestation käme ein Patient, der behauptete, er könne es sich zwar nicht genau erklären, aber eigentlich würde er aus dem Jahr 2999 stammen. Sie würde ohne zu zögern die psychiatrischen Kollegen anrufen und auf eine Verlegung in die Psychiatrie drängen. Nun war dies im Mittelalter natürlich nicht möglich. Im christlichen Europa hätte man sie vermutlich als vom Teufel besessen auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Was mochte man wohl in einem islamischen Land mit ihr anstellen? Sie wollte gar nicht daran denken. Zum Glück war Mirwat bisher die Einzige, die andeutungsweise davon wusste. Und sie musste die Einzige bleiben.
»Was ist mit dir los?«, fragte Mirwat besorgt. »Du bist heute irgendwie seltsam. Erst die Sache mit der Karte, dann wirst du ohnmächtig, schließlich beginnst du zu weinen und redest lauter unverständliches Zeug. Was ist denn ...«
»Es ist nichts«, antwortete Beatrice rasch. Sie brauchte jetzt vor allem eins – Zeit und Ruhe zum Nachdenken. »Ich bin müde und habe Kopfschmerzen. Der Wind war heute Abend ziemlich frisch. Vielleicht habe ich mich im Garten ein wenig verkühlt. Ich sollte mich in mein Zimmer zurückziehen und schlafen.«
Es war eine schwache Ausrede – der Wind war ausgerechnet an diesem Abend milder gewesen als die Tage zuvor. Aber sie hoffte, dass Mirwat das nicht bemerkt hatte.
»Wahrscheinlich ist das wirklich das Beste«, sagte Mirwat und warf Beatrice einen verständnisvollen Blick zu. Offensichtlich hatte sie ihre Notlüge durchschaut und akzeptierte sie. »Du bist sicher, dass ich nicht doch den Arzt rufen soll?«
»Nein, Mirwat, das ist unnötig. Ich werde mich gleich hinlegen. Und du wirst sehen, morgen geht es mir schon viel besser.«
»Wie du willst. Aber wenn du mich brauchst, rufe nach mir.«
Mirwat geleitete Beatrice hinaus. Sie wollte die Tür gerade schließen, da drehte sich Beatrice noch einmal um.
»Mirwat, bitte erzähle niemandem von meiner seltsamen Stimmung. Ich möchte nicht, dass alle glauben ...«
Mirwat nickte.
»Du kannst dich auf mich verlassen. Leg dich jetzt schlafen. Morgen wird es dir sicherlich besser gehen!«
Beatrice hörte, wie die Tür leise hinter ihr geschlossen wurde und Mirwat den Riegel wieder vorlegte. Es herrschte völlige Stille, der ganze Palast schien tief und fest zu schlafen. Der Gang wurde nur von ein paar Öllampen, die in großen Abständen an den Wänden hingen, spärlich erleuchtet. Beatrice starrte die Lampen an, als würde sie sie zum ersten Mal sehen. Wieso nur war ihr das Fehlen von Glühbirnen nicht viel eher aufgefallen? Sie seufzte und tastete sich dann durch das Halbdunkel zu ihrem Zimmer vor.
Natürlich konnte Beatrice in dieser Nacht nicht schlafen. Rastlos wanderte sie durch ihr Zimmer. Sie nahm jeden einzelnen Gegenstand in die Hand und prüfte ihn in der Hoffnung, einen Fehler zu entdecken – vielleicht einen Reißverschluss an einem Kissenbezug, einen Druckknopf an einem Kleid, synthetische Fasern in den Vorhängen, Wäschezeichen und Herkunftsetiketten unter den Teppichen und am Bettzeug, Schrauben an den Möbeln, etwas, das man übersehen hatte, als man diese mittelalterliche Welt für sie inszeniert hatte. In ihrer Verzweiflung nahm Beatrice sogar das Bett auseinander und drehte die Truhen um. Ohne Erfolg. Im Gegenteil, jeder einzelne Gegenstand war ein Meisterwerk mittelalterlicher arabischer Handwerkskunst und schien Mirwats Aussage nochmals zu bestätigen. Sie befand sich im Jahr 389 islamischer Zeitrechnung.
Schließlich gab Beatrice ihre Suche auf, trat ans Fenster und lauschte den Geräuschen der Nacht. Grillen zirpten, manchmal raschelte eine Maus durch das Gebüsch, Fledermäuse flatterten auf der Jagd nach Insekten über den Himmel. Sie konnte sich nicht daran erinnern, in Hamburg jemals so eine Stille erlebt zu haben. Selbst wenn der Verkehr in der Nacht fast völlig zum Erliegen kam, irgendwo fuhr doch ein Auto, man hörte in der Ferne die Sirene eines Polizei- oder Unfallwagens, die Stimmen und das Gelächter von Jugendlichen, die aus einer Diskothek kamen. Und niemals war es so dunkel. Nur vage konnte sie in den dunklen Schatten die Silhouetten der Bäume erkennen. Aber es gab Sterne, unendlich viele Sterne, einen ganzen Himmel voll davon. Es waren so viele, dass Beatrice nicht einmal die ihr bekannten Sternbilder ausmachen konnte.
Sie seufzte tief. Bislang hatte sie fest daran geglaubt, dass es ihr eines Tages gelingen würde, einen Bus, einen Zug oder vielleicht sogar ein Flugzeug zu erwischen, mit dem sie hätte fliehen können. Aber das kam nun natürlich nicht mehr in Frage. Aber wie sollte sie den Weg nach Deutschland finden? Zu Fuß? Mit einem Eselskarren oder auf einem Maultierrücken? Sie musste unwillkürlich schmunzeln, als sie sich vorstellte, wie sie auf einem kleinen zottligen Esel quer durch den Vorderen Orient und durch Europa reiten würde, um irgendwann, nach einigen Jahren, wieder nach Hamburg zu kommen ... Das Lächeln erstarb auf ihren Lippen, ihr wurde heiß und kalt zugleich. Ihr war ganz plötzlich eingefallen, dass Hamburg um die erste Jahrtausendwende kaum mehr als ein mit hölzernen Palisaden befestigter Marktplatz war, der in regelmäßigen Abständen von den Wikingern heimgesucht wurde. Selbst wenn sie es schaffen sollte, wieder nach Deutschland zurückzukommen, wozu? Weshalb sollte sie die Mühen und die Gefahren auf sich nehmen? Deutschland und Hamburg, so wie sie es kannte, gab es noch gar nicht!
Beatrice wurde schwindlig, als ihr die Konsequenzen klar wurden. Wie sollte sie wieder nach Hause kommen, wirklich nach Hause, nicht nur zurück nach Hamburg, sondern auch in ihr Jahrhundert? Wie sollte sie durch die Zeit zurückreisen, wenn sie noch nicht einmal wusste, wie sie überhaupt hierher gekommen war?