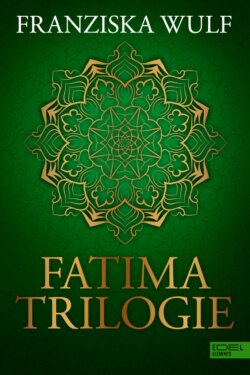Читать книгу Fatima Trilogie Gesamtausgabe - Franziska Wulf - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IX
ОглавлениеAhmad al-Yahrkun erwachte frühzeitig am nächsten Morgen. Er verrichtete die rituellen Waschungen, kleidete sich rasch an und verließ sein Zimmer noch vor dem Morgengesang des Muezzins. Auf seinem Weg durch den Palast begegnete ihm niemand, alle Bewohner schienen noch zu schlafen. Nur die Wachen auf den Palastmauern versahen ihren Dienst. Die Soldaten am Tor grüßten Ahmad höflich und ließen ihn ohne zu fragen passieren. Es war allgemein bekannt, dass der Großwesir oft frühzeitig aufstand und noch vor dem Morgengebet einen Erkundungsgang durch die Stadt unternahm.
Ahmad trat vor das Palasttor und atmete die kühle, klare Morgenluft ein. Der Himmel über ihm war noch dunkel, aber in der Ferne zeigte sich bereits ein heller Streifen. Bald würde sich die Sonne über den Horizont erheben, der Muezzin würde auf das Minarett steigen und mit seiner klaren Stimme den Lobpreis Allahs ausrufen. Die Bewohner Bucharas würden erwachen, und der Tag würde beginnen. Ahmad liebte die Stadt zu dieser Stunde, wenn alles schlief – brave Menschen und Sünder gleichermaßen. In dieser geheimnisvollen, wunderbaren Stunde, diesem Schweben zwischen Nacht und Tag, war die Stadt rein, unschuldig, jungfräulich. Nie fühlte er sich Allah, dem Allmächtigen, näher, als wenn er mit dem Rosenkranz in der Hand durch die menschenleeren Straßen Bucharas ging. Manchmal glaubte er sogar den Atem Allahs zu spüren, der kam, um nach Seinen Gläubigen zu sehen.
Ahmad wandte sich vom Palast ab und ging ruhigen Schrittes eine der schmalen Straßen entlang, während er die neunundneunzig Perlen des Rosenkranzes langsam durch seine Finger gleiten ließ. Kein Mensch begegnete ihm auf seinem Weg durch die Stadt, selbst die Katzen und Hunde schienen noch zu schlafen.
Schließlich blieb er vor einem schlichten Haus stehen. Gerade als er an die Tür klopfen wollte, erhob der Muezzin seine Stimme. Ahmad hielt inne, schloss die Augen und betete. Er hatte zwar sein Morgengebet gleich nach dem Aufstehen gesprochen, nutzte aber dennoch jede Gelegenheit, um Allah mit einem Gebet zu ehren. Erst dann klopfte er an die Tür und wartete.
Es handelte sich um das Haus eines Schreibers, bei dem Ahmad schon viele Handschriften und Kopien, auch im Namen des Emirs, in Auftrag gegeben hatte. Selbst wenn also Bewohner der umliegenden Häuser ihn hier vor der Tür stehen sahen und vielleicht sogar erkannten – niemand würde sich darüber wundern oder gar Verdacht schöpfen.
Ein großer breitschultriger Diener öffnete ihm. Mit einer stummen Verbeugung begrüßte er Ahmad und führte ihn ohne ein Wort zu sagen einen schmalen Flur entlang in einen kreisrunden Raum, der nicht weniger als neun Türen hatte. Hier zog er Ahmad eine Kapuze aus dichter schwarzer Wolle über den Kopf, drehte ihn dann mehrmals um seine Achse und klopfte dann an eine Tür. Ahmad kannte die Prozedur bereits und wartete darauf, dass eine kräftige Hand seinen Arm packte und ihn auf verschlungenen Wegen zu dem geheimnisvollen Treffpunkt führen würde. Dennoch glitten die Perlen des Rosenkranzes etwas schneller durch seine Finger. Als er vor etwa zwei Jahren das erste Mal hier gewesen war, hatte er um sein Leben gefürchtet und fest damit gerechnet, das Tageslicht nie wieder zu sehen. Mittlerweile empfand er dieses seltsame Verfahren nur noch als unwürdig und erniedrigend. Trotzdem machte ihn der Gedanke nervös, seinem unsichtbaren Führer hilflos ausgeliefert zu sein. Aber sein Kontakt war kaum mehr als ein Schatten in Buchara. Ohne Zweifel wollte er es auch bleiben – zu seiner eigenen Sicherheit und zur Sicherheit derjenigen, die ihn aufsuchten.
Ahmad begann bereits ein zweites Mal mit der Rezitation der neunundneunzig Beinamen Allahs, als er schließlich die Hände seines stummen Begleiters im Rücken spürte. Er wurde ein paar Schritte vorwärts geschoben und hörte dann eine Tür hinter sich ins Schloss fallen. Endlich war er am Ziel. Der angenehme, beruhigende Duft von Amber und Sandelholz empfing ihn, und vor sich, in nicht allzu großer Entfernung, hörte er das leise Rascheln von Papier und das Kratzen einer Feder. Dort saß vermutlich Saddin, der Nomade, sein Kontakt. Niemand in Buchara kannte Saddins Familiennamen oder seine Herkunft. Man wusste nicht viel mehr über ihn, als dass er vor nunmehr fast drei Jahren plötzlich in Buchara aufgetaucht war. Über Nacht hatte er seine Zelte vor den Toren der Stadt aufgeschlagen und lagerte dort seit diesem Tag mit seinen Leuten, seinen Sklaven, seinen Kamelen – und seinen Pferden. Es waren die schönsten, edelsten Tiere, die man sich vorstellen konnte. Nuh II. selbst hatte dem Nomaden bereits ein paar Pferde abgekauft und jedes Mal ein halbes Vermögen bezahlt. Es hatte nicht lange gedauert, bis Gerüchte über Saddin im Umlauf waren. Die hartnäckigsten behaupteten, er sei ein verstoßener Prinz, der vor den Toren Bucharas darauf wartete, wieder in das Reich seines Vaters zurückkehren zu können. Dass der Nomade den Pferdehandel lediglich aus Liebhaberei betrieb und sein eigentliches Geschäft im Verborgenen führte, wussten nur wenige.
Gehorsam und geduldig wie ein Bittsteller niedriger Herkunft wartete Ahmad. Seine Hände waren zwar nicht gefesselt, dennoch behielt er vorsichtshalber die Kapuze auf dem Kopf. Allzu lebhaft erinnerte er sich noch an das erste Treffen, als er, ohne auf die entsprechende Erlaubnis zu warten, die Kapuze abgenommen hatte. Im selben Augenblick hatte ein Dolch nur um Haaresbreite seine linke Wange verfehlt.
Im Geiste sah er, wie Saddin mit überkreuzten Beinen vor ihm saß und sich über ihn amüsierte, ihn auslachte, wie er, Ahmad al-Yahrkun, der Großwesir und Spross einer der einflussreichsten Familien dieser Stadt, unterwürfig vor ihm stand – wie ein Falkenweibchen, das mit verhülltem Kopf auf den Beginn der Jagd und die befreiende Hand seines Herrn wartete. Er sah den Nomaden vor sich, wie er ihn mit spöttischem Lächeln betrachtete und so seine Geduld auf die Probe stellte. Ahmad verfluchte ihn für diese Grausamkeit. Doch er wollte auf keinen Fall riskieren, ein Ohr zu verlieren.
»Entschuldigt vielmals meine Unhöflichkeit, Ahmad«, erklang endlich, nach einer halben Ewigkeit, Saddins angenehme Stimme. »Ich war beschäftigt und daher in Gedanken. Verzeiht. Nehmt die Kapuze ab.«
Gehorsam löste Ahmad die Schnüre, die die Kapuze zusammenhielten, und wischte sich erleichtert den Schweiß von der Stirn, denn unter der dichten Wolle war es heiß und stickig gewesen.
Saddin saß in der Tat, wie Ahmad es vermutet hatte, vor ihm mit überkreuzten Beinen auf einem Kissen. Wenn der Nomade eben noch über ihn gelacht hatte, so war jetzt keine Spur mehr davon auf seinem Gesicht zu entdecken.
»Seid gegrüßt, verehrter Freund«, sagte Saddin, neigte leicht seinen Kopf und führte die Hand zum Mund und zur Stirn. »Setzt Euch, ruht Euch aus.« Er deutete auf ein Kissen vor ihm. »Verzeiht die Unannehmlichkeiten. Ich werde mit meinen Leuten sprechen und veranlassen, dass sie die Schnüre nicht mehr so fest knoten. Ihr seid ja halb erstickte. Darf ich Euch zur Erfrischung Wasser anbieten?«
Ahmad nickte und beobachtete den Nomaden, wie er nach Zitrone duftendes Wasser in einen Becher goss. Saddin war höflich, aber das war er stets. Niemals ließ er es auch nur einen Augenblick an der gebotenen Höflichkeit mangeln. Ahmad gab sich nicht der Illusion hin, diese Höflichkeit wäre aus der Ehrfurcht vor seinem Namen und seinem verantwortungsvollen Amt heraus geboren. Saddin befand sich in einer Position, in der er weder Ämter noch Würdenträger zu fürchten brauchte, wenn er höflich war, dann nur aus Respekt vor dem Alter; immerhin war Ahmad alt genug, um Saddins Vater sein zu können. Doch glaubte er jedes Mal in den dunklen, schönen Augen des jungen Mannes ein spöttisches Funkeln zu entdecken. Und er war sicher, dass Saddin ihn, wenn er mit der Kapuze über dem Kopf vor ihm stand, auslachte.
»Ich habe deine Nachricht erhalten«, sagte Ahmad, nachdem er einen Schluck des köstlich erfrischenden Wassers getrunken hatte.
»Das ist gut.«
Bildete er es sich nur ein, oder glitzerten Saddins Augen noch spöttischer als zuvor? Hatte er nicht eben, kaum merklich zwar, eine Augenbraue gehoben als Ausdruck der Verachtung und des Hohns? Ahmad ärgerte sich über sich selbst. Wieso musste er so dummes Zeug reden wie ein schwachsinniger Greis?
»Ich war sehr verärgert. Du hast die Röhre ausgetauscht, die ich deiner Taube ans Bein gebunden habe«, sagte Ahmad barsch, in der Hoffnung, verlorenen Boden wieder gutzumachen.
»Verzeiht mir, dass ich Euch die goldene Röhre nicht sofort zurückgegeben habe, sondern Euch zuerst eine Erfrischung anbot«, entgegnete Saddin ruhig und deutete eine Verbeugung an. »Was den Austausch angeht, so hielt ich es für klüger, der Taube eine Röhre aus Leder umzubinden. Leder ruft im Gegensatz zu Gold kein Funkeln im Sonnenlicht hervor, welches die Aufmerksamkeit von Jägern auf sich lenken könnte. Verzeiht meine eigenmächtige Handlungsweise. Selbstverständlich hätte ich Euch vorher um Eure Erlaubnis bitten sollen.« Er öffnete seine Faust und hielt Ahmad die goldene Röhre hin. »Hier ist Euer Eigentum.«
Ahmad starrte die goldene Röhre an, als könnte sie sich jeden Augenblick in eine giftige Schlange verwandeln. Woher hatte Saddin gewusst, dass er danach fragen würde?
»Vielleicht können wir aber jetzt auf das zu sprechen kommen, weshalb ich Euch zu mir gebeten habe?«
Die Stimme des Nomaden war merklich kühler geworden, und Ahmad spürte, wie ihm die Schamesröte ins Gesicht stieg. Hastig nahm er die Röhre an sich und steckte sie in eine verborgene Tasche.
»Ja, natürlich, ich wollte nur ...«, stammelte Ahmad.
»Gut, dann lasst uns endlich zum Geschäft kommen. Ich habe die Frau für Euch beobachtet. Gestern während der größten Mittagshitze hat sie gemeinsam mit Sekirehs Dienerin den Palast verlassen. Sie ...«
»Mit Sekirehs Dienerin?«, rief Ahmad überrascht aus. »Aber weshalb...«
»Wenn Ihr mir erlaubt, meinen Bericht zu beenden, werdet Ihr alles erfahren, was Ihr wissen wollt.«
»Natürlich, verzeih ...«
»Die beiden haben eine Wahrsagerin aufgesucht, die im Norden der Stadt wohnt. Sie sind dort ziemlich lange geblieben und erst kurz vor dem zweiten Wachwechsel wieder in den Palast zurückgekehrt.«
Verständnislos blickte Ahmad den jungen Nomaden an. Was war an dieser Nachricht so bedeutsam, dass er unbedingt persönlich mit ihm sprechen musste? Wahrscheinlich suchten alle Weiber des Harems von Zeit zu Zeit eine der vielen Wahrsagerinnen und Hexen auf, die in Buchara lebten. Sie holten sich dort Rat, wenn sie sich ein Kind wünschten, eine Rivalin aus dem Weg haben oder das Herz eines Mannes gewinnen wollten.
»Aha, und was haben sie dort gemacht?«
»Habt Ihr schon von den Steinen der Fatima gehört?«, fragte Saddin.
»Die Steine der Fatima? Natürlich kenne ich die Legende von dem Auge der Fatima, der Vielgeliebten, welches Allah in Seiner großen Güte und Barmherzigkeit...«
»Die Frau aus dem Norden besitzt einen dieser Steine.«
Diese Worte trafen Ahmad wie ein Peitschenhieb mitten ins Gesicht. Eine Hitzewelle rollte über ihn hinweg, und gleichzeitig kroch eine Gänsehaut über seinen Körper. Plötzlich fror er so erbärmlich, dass seine Zähne aufeinander schlugen. Das Blut rauschte in seinen Ohren, und seinen Herzschlag spürte er bis in die Schläfen hinein. Während dieser Zeit ruhten die dunklen Augen des Nomaden unablässig auf ihm. Sie durchbohrten ihn fast mit ihrem Blick, als wollte Saddin seine Gedanken erforschen.
Lass dir nur nichts anmerken, dachte Ahmad.
»Das kann nicht wahr sein, du musst dich irren«, sagte er schließlich und versuchte seiner Stimme einen unbekümmerten Ton zu verleihen. »Es handelt sich um eine uralte Legende, ein Märchen, das man den Kindern erzählt. Diese Steine existieren nicht.«
Saddin schüttelte ruhig den Kopf und nahm sich einen köstlich duftenden Pfirsich aus einer Kupferschale.
»Nein, ich habe ihn mit eigenen Augen gesehen und es mit eigenen Ohren gehört.«
Unwillkürlich hielt Ahmad die Luft an. Dann war es also wahr. Es gab die Steine der Fatima wirklich. Er konnte kaum noch still sitzen.
»Du willst diesen Stein mit eigenen Augen gesehen haben? Wie schaut er denn aus?«
Saddin biss in den Pfirsich und wischte sich mit dem Handrücken den Saft vom Kinn. Er antwortete, ohne seinen Blick von Ahmad abzuwenden.
»Es ist ein Saphir, etwa so groß wie ein Taubenei. Ist Euch nicht wohl, verehrter Freund?«
Ahmad öffnete seinen Kragen, fächelte sich Luft zu und keuchte und japste. »Nein, mir fehlt nichts, es ist nur ziemlich heiß und stickig hier drinnen.« Ahmad schüttelte den Kopf und versuchte dem Blick des Nomaden auszuweichen. »Vielleicht handelt es sich um ein kostbares Juwel, das im Volksmund Stein der Fatima genannt wird. Vielleicht hat die Barbarin das Juwel irgendwo gestohlen, und sie wollte es an die Wahrsagerin verkaufen?«
Hatte er zu hastig gesprochen? Saddins Augen verengten sich kaum merklich.
»Möglich.«
Er glaubt mir nicht, dachte Ahmad verzweifelt. Dieser Kerl spürt, dass ich nicht die Wahrheit gesagt habe, dass mehr dahinter steckt. Laut erwiderte er, während er sich erhob: »Ich danke dir, dass du mich von dieser Angelegenheit unterrichtet hast. Ich hatte schon seit langem einen Verdacht gegen diese Sklavin. Nun weiß ich endlich, dass sie eine schändliche Diebin ist. Ich muss Nuh II. davon in Kenntnis setzen. Wie kann ich deine Mühe entlohnen?«
Täuschte er sich oder zuckte ein verächtliches Lächeln um die Mundwinkel des Nomaden?
»Zu gegebener Zeit komme ich darauf zurück«, antwortete Saddin. »Einen kleinen Gefallen könntet Ihr mir jedoch bereits jetzt erweisen. Malek al-Omar, ein bisher unbescholtener Bewohner dieser reichen und schönen Stadt, wurde wegen einer lächerlichen Kleinigkeit vor zwei Tagen in den Kerker geworfen. Morgen nach dem Morgengebet soll das Urteil über ihn gesprochen werden. Ich würde es begrüßen, wenn Malek von aller Schuld freigesprochen würde.«
Ahmad runzelte die Stirn. Malek al-Omar war ein stadtbekannter Bettler, der am helllichten Tag auf frischer Tat bei einem Diebstahl ertappt worden war. Es gab mindestens fünf Zeugen, die alle gesehen hatten, wie Malek einen Juwelenhändler bestohlen hatte. Die Beute, mehrere goldene Ringe, Armreifen und Ketten, hatte sich sogar noch in seinen Taschen befunden, als die Soldaten ihn wenig später aufgegriffen hatten. Für diesen Gauner einen Freispruch zu erwirken hieße, das Unmögliche zu vollbringen. Andererseits war Saddin nicht der Mann, dem man leichtfertig eine Bitte abschlagen sollte.
»Gut«, sagte Ahmad. »Ich verspreche dir, dass Malek al-Omar morgen freigelassen wird.«
Saddin nickte zufrieden. »Ich muss Euch jetzt bitten zu gehen. Ich werde erwartet.«
Wie in Trance ließ sich Ahmad von Saddin die Kapuze wieder aufsetzen und festbinden. Während er zum Haus des Schreibers zurückgeführt wurde, dachte er über das nach, was Saddin ihm erzählt hatte. Ein Stein der Fatima hier, mitten in Buchara. Das war mehr, als er jemals zu glauben, zu hoffen, zu träumen gewagt hatte. Er musste sich sehr zusammennehmen, um ruhig zu bleiben. Aber wie sollte er gleichgültig bleiben, wenn es um ein derartig kostbares Kleinod, den Schlüssel zu aller Weisheit ging? Ein Heiligtum von unschätzbarem Wert für die Gläubigen, das sich in den Händen einer Unwürdigen, einer Ungläubigen befand?
Auf seinem Weg durch die Stadt nahm er seine Umgebung kaum wahr. Die Straßen waren jetzt belebt. Ärmlich gekleidete Händler brachten mit Handkarren oder Eseln ihre Waren zum Markt, Frauen waren mit Krügen auf dem Weg zum Brunnen, Viehhändler trieben Schafe oder Ziegen vor sich her. Immer wieder stieß er mit anderen zusammen, und einmal wäre er fast gestürzt, als er die ausgebreiteten Waren eines Töpfers erst zu spät entdeckte. Ohne auf den Mann zu achten, der lauthals hinter ihm herschimpfte, eilte Ahmad weiter.
»Wie kommt dieses Weib zu dem Stein?«, stieß er in mühsam gezügelter Wut hervor, während er sich aus den Tontöpfen und Scherben herausarbeitete. »Warum ausgerechnet sie? Ich muss den heiligen Stein aus den Klauen dieser Barbarin befreien. Wenn ich nur wüsste, wie ...«
»Herrin, es ist Zeit zum Aufstehen.«
Eine sanfte helle Stimme holte Beatrice aus dem Schlaf. Nur äußerst widerwillig öffnete sie die Augen und sah über sich das schmale Gesicht von Yasmina, ihrer Dienerin.
»Verzeiht, dass ich Euch geweckt habe, aber der Tag ist schon weit fortgeschritten!«
»Wie spät ist es denn?«, fragte Beatrice und rieb sich verschlafen die Augen.
»Schon bald wird der Muezzin die Gläubigen zum Mittagsgebet aufrufen, Herrin«, antwortete Yasmina.
Beatrice konnte das gar nicht glauben. Ihr kam es so vor, als wäre sie erst vor einer Stunde eingeschlafen. Obwohl sie sich eigentlich geschworen hatte, den Besuch bei Samira als amüsanten Ausflug anzusehen, hatten die Worte und Prophezeiungen der Alten sie doch ziemlich aufgewühlt. Noch lange hatte sie in dieser Nacht wach gelegen und sich von einer Seite zur anderen gewälzt. Erst in den frühen Morgenstunden, als bereits Sonnenstrahlen durch das Gitter der Fensterläden fielen, waren ihr die Augen vor Müdigkeit und Erschöpfung zugefallen. Doch nicht einmal im Schlaf hatte der Stein der Fatima sie in Ruhe gelassen. In wilden Träumen hatte sie gegen tausende von Spinnen und Käfern gekämpft, war von zwielichtigen Gestalten überfallen worden und auf der Flucht vor gedungenen Mördern um die halbe Welt gereist. Huschende, lautlose Schatten hatten sogar ihr Zimmer durchsucht, um ihr den Stein abzunehmen. Jetzt fühlte sie sich müde und zerschlagen und wollte eigentlich nur eins – weiterschlafen.
»Bitte, Yasmina, lass mich einfach liegen«, murmelte sie, drehte sich auf die Seite und zog ihr seidenes Laken wieder bis zum Kinn. »Ich fühle mich heute nicht wohl und möchte nicht aufstehen. Frühstück und Mittagessen können ausfallen, ich habe ohnehin keinen Appetit. Wenn ich etwas brauche, rufe ich dich.«
»Herrin, verzeiht mir, aber ich muss Euch dennoch bitten aufzustehen.«
Überrascht stützte sich Beatrice auf ihren Ellbogen und sah Yasmina an, als würde sie das zarte Mädchen heute zum ersten Mal sehen. Ihre Dienerin las ihr gewöhnlich jeden Wunsch von den Augen ab und war stets ängstlich darum bemüht, unter gar keinen Umständen Beatrices Unmut zu wecken. Dass die Kleine ihr so hartnäckig widersprach, war mehr als sonderbar.
»Was ist los, Yasmina?«
Das Mädchen senkte beschämt den Blick. »Glaubt mir, Herrin, wenn ich könnte, würde ich Euch so lange schlafen lassen, wie Ihr wollt, aber ...«
Beatrice war von einem Moment zum nächsten hellwach. Es musste einen Grund für das untypische Verhalten der Dienerin geben. Sie setzte sich in ihrem Bett auf und ergriff das Mädchen bei den Schultern.
»Yasmina, sage mir bitte, was los ist.«
»Der Emir hat nach Euch rufen lassen«, erklärte die Kleine, und die erste Träne rollte über ihre Wange. »Er will Euch sofort nach der Mittagsmahlzeit in seinen privaten Gemächern sehen. Er wird mich auspeitschen und aus dem Palast werfen lassen, wenn Ihr nicht rechtzeitig gewaschen und angekleidet seid. Ich muss doch tun, was mir befohlen wird. Und jetzt seid Ihr böse auf mich und werdet mich bestimmt aus Eurem Dienst fortschicken. Und dann muss ich in der Küche Wasser tragen oder gar die Becken im Bad heizen und ich ...«
Was sie noch sagen wollte, ging in ihrem heftigen Schluchzen unter. »Nun beruhige dich«, meinte Beatrice sanft und streichelte ihr behutsam über die mageren Schultern. »Du brauchst keine Angst zu haben, ich bin dir nicht böse. Im Gegenteil, ich bin sehr zufrieden damit, wie gewissenhaft du deine Pflicht erfüllst. Nicht einmal im Traum würde mir einfallen, dich aus meinem Dienst zu entlassen.« Das Mädchen hob den Kopf. »Wirklich, Herrin? Ist das wirklich Eure Meinung?« Der ängstliche Blick von Yasminas rot geweinten Augen schnitt Beatrice ins Herz. Dieses kleine, kaum zwölfjährige Mädchen hatte Angst, echte, nackte Existenzangst. Beatrice wusste auch, wovor Yasmina sich fürchtete. Sie hatte ja inzwischen das Elend dort draußen gesehen. Hier im Schutze des Palastes hatte Yasmina immer ausreichend zu essen und ein Dach über dem Kopf. In den Gassen von Buchara hatte so ein schmächtiges Mädchen hingegen keine Chance. Um zu überleben, würde sie betteln oder stehlen müssen – und wahrscheinlich trotzdem verhungern.
»Natürlich, Yasmina, sonst würde ich das nicht zu dir sagen.« Tröstend strich Beatrice dem Mädchen über das lange schwarze Haar und lächelte es aufmunternd an. »So, und nun wollen wir uns beeilen. Der Emir wird schon bald mit seinem Mittagsmahl beginnen, und wir wollen ihn doch nicht warten lassen und Ärger riskieren, nicht wahr?«
Über Yasminas schmales Gesicht glitt ein strahlendes Lächeln. Sie nickte eifrig und wischte sich die Tränen von den Wangen.
Während Yasmina ihr beim Waschen und Ankleiden behilflich war und ihre Haare zu einer kunstvollen Frisur flocht, verfluchte Beatrice Nuh II. ibn Mansur. Sie war dem Emir bisher nur selten begegnet. Meistens sah sie ihn bloß von weitem durch die vergitterten Fenster, durch die man in die Eingangshalle hinabschauen konnte. Ein überaus vernünftiger Abstand, wie sie fand. Mit einem Mann, der es wagte, eine Frau zu schlagen und der in einem kleinen Mädchen Todesangst auslöste, wollte sie nichts zu tun haben.
»Ich habe zwar überhaupt keine Lust, aber es muss wohl sein«, sagte sie zu sich selbst, als Yasmina ihr zur Kontrolle noch einmal den Handspiegel reichte. »Bringen wir es schnell hinter uns.«
Sie waren gerade fertig, als es klopfte. Jussuf stand vor der Tür, um Beatrice abzuholen und sie zu Nuhs Gemächern zu begleiten. Während sie schweigend neben dem dunkelhäutigen Eunuchen durch die Gänge des Palastes ging, fiel Beatrice plötzlich ein, dass sie gar nicht wusste, weshalb Nuh II. sie sehen wollte. Sie war so wütend auf den Emir gewesen, dass es ihr gar nicht in den Sinn gekommen war, darüber nachzudenken. Nun wünschte sie, sie hätte die Gelegenheit ergriffen und Yasmina ausgehorcht. Vielleicht wusste Jussuf etwas, aber ihn zu fragen wäre sinnlos gewesen. Der Eunuch sagte nie auch nur ein überflüssiges Wort, und über seine Befehle sprach er schon gar nicht. So versuchte Beatrice in seinem Gesicht zu lesen. Doch Jussufs Miene war unbeweglich und grimmig wie immer. Also war sie in ihren Vermutungen ganz auf sich allein gestellt.
Unglücklicherweise hatte sie eine lebhafte Phantasie, und mit jedem Schritt, den sie sich den privaten Gemächern des Emirs näherten, wurde sie nervöser. Als sie schließlich vor einer mit ornamentalen Schnitzereien reich verzierten Tür stehen blieben, klopfte ihr Herz wie ein Dampfhammer. Anscheinend wurden sie bereits erwartet, denn die Tür öffnete sich, noch bevor Jussuf anklopfen konnte. Ein alter, in ein schlichtes weißes Gewand gekleideter Diener empfing sie.
»Mein Herr, der edle und weise Nuh II. ibn Mansur, Allah möge ihn segnen und ihm ein langes Leben schenken, erwartet euch bereits. Kommt.«
Beatrice und Jussuf folgten dem vom Alter gebeugten Mann durch eine hohe, geräumige Halle. Der Alte schlurfte so langsam und schwerfällig vor ihnen her, dass Beatrice Gelegenheit hatte, die Pracht zu bewundern. Zahlreiche kostbare Teppiche hingen an den Wänden und lagen auf dem Boden; einige von ihnen waren so groß wie eine moderne Dreizimmerwohnung, andere erreichten kaum die Maße eines Aktenkoffers. Riesige, mit bunten Steinen geschmückte Öllampen aus Messing hingen an schweren Ketten von der Decke herab, welche mit den schönsten Stuckarbeiten verziert war, die Beatrice bisher gesehen hatte. Weihrauch wurde in hohen dreibeinigen Räucherbecken verbrannt. Sein würziger Geruch vermischte sich mit dem Duft der aus edlen Hölzern gefertigten niedrigen Tische und Truhen, die überall in der Halle verteilt waren. Nuh II. ibn Mansur schien das Schachspiel sehr zu lieben, denn in der ganzen Halle lagen und standen Schachbretter unterschiedlicher Größe und reich verzierte Kästen zum Aufbewahren der Figuren. Beatrice zählte nicht weniger als sieben Schachspiele, die auf den Tischen aufgebaut waren, jedes aus einem anderen Material gefertigt und eines kunstvoller als das andere.
Schließlich blieb der alte Diener an einer hohen Tür am anderen Ende der Halle stehen. Er klopfte dreimal und öffnete dann selbst.
»Herr, die Frau aus dem Norden ist da«, hörte Beatrice ihn unter Verbeugungen sagen. Er schwieg und lauschte auf eine Antwort, die Beatrice nicht verstehen konnte. »Jawohl, Herr!« Der Diener drehte sich zu Beatrice um. »Komm, Weib, Seine Hoheit Nuh II. ibn Mansur, der Emir von Buchara, erwartet dich. Und du bleibst hier vor der Tür stehen!«, befahl er dem Eunuchen schroff, schob Beatrice in das Zimmer und schloss sorgfältig die Tür von außen.
Gleich beim Eintreten schlug Beatrice der schwere süße Duft von Jasmin entgegen. Der Geruch raubte ihr fast den Atem und trieb ihr die Tränen in die Augen. Jemand musste das Parfum literweise in dem Zimmer verteilt haben. Beatrice hätte zu gern sämtliche Fenster und Türen aufgerissen, um frische Luft in den Raum zu lassen. Allerdings schien es keine zu geben. Die Wände waren mit schweren, dunklen, üppig mit Goldstickereien und goldenen Quasten verzierten Stoffen verkleidet. Das Licht der Öllampen wurde durch Schirme aus roter Seide gedämpft und verlieh dem Raum eine anzügliche Atmosphäre. Dazu passte auch das mit roten Seidenlaken und verschwenderisch vielen Kissen ausgestattete Bett. Es stand mitten im Raum und war groß genug, um einem halben Dutzend Männern und Frauen bequem Platz zu bieten. Dann entdeckte Beatrice eine goldene Schale mit frivol aussehenden Süßigkeiten, die auf einem kleinen Tisch stand, und ihr wurde übel. Dieses Zimmer sah aus, wie man sich ein Liebesnest in einem Bordell für alternde Manager vorstellte – teuer, schwülstig und unendlich geschmacklos. Am abstoßendsten aber war Nuh II. selbst. Der Emir hatte es sich auf dem Bett bequem gemacht. Er sah aus wie ein Mann, der nach der Arbeit auf dem Sofa sitzt und darauf wartete, dass ihm seine Frau das Bier bringt.
Nuh stopfte sich gerade mit seinen fleischigen juwelenbesetzten Fingern etwas von dem Gebäck, das an einen Phallus erinnerte, in den Mund. Er erhob sich, als hätte er Beatrice eben erst bemerkt, legte seinen Hausmantel aus goldbesticktem, dunkelblauem Samt ab und kam ihr entgegen. Seinen dicken Bauch, den nicht einmal die eng geschnürte Schärpe verbergen konnte, schob er dabei vor sich her wie eine wertvolle Trophäe. Ohne ein Wort zu sagen, nahm er Beatrice bei der Hand und führte sie zum Bett. Sein Griff war ekelerregend – feucht und warm und weich. Dennoch war er fest genug, um Beatrice die Möglichkeit zu nehmen, ihm ihre Hand wieder zu entziehen. Widerstrebend ließ sie sich auf der äußersten Kante des Bettes nieder. Ihre schlimmsten Befürchtungen schienen sich zu bestätigen. Wie lange würde sie diese Situation ertragen können? Was sollte sie tun, wenn Nuh II. ihr zu nahe kam? Denn dass er sie hierher hatte bringen lassen, um mit ihr über das rätselhafte, unbekannte Germanien zu plaudern, war mehr als unwahrscheinlich.
Nuh II. setzte sich dicht neben sie. Er stank so penetrant nach Jasmin, als hätte er in dem Parfum gebadet. Beatrice versuchte, durch den Mund zu atmen. Der schwere, intensive Duft brannte auf ihren Schleimhäuten, ihre Stirn- und Nackenmuskulatur verspannte sich, und allmählich stellten sich hinter den Augenbrauen beginnende Kopfschmerzen ein. Sie war froh, dass sie keine gesundheitlichen Probleme hatte. Wäre sie Asthmatikerin oder Allergikerin gewesen, hätte sie die Konzentration an Duftstoffen vermutlich nicht überlebt.
Vielleicht kann ich schnell wieder gehen, dachte sie, machte sich allerdings keine großen Hoffnungen. Dieses ganze Arrangement war unmissverständlich.
Dem Emir schien es neben ihr sehr gut zu gefallen. Er rückte so dicht an sie heran, dass sie die Fettpolster unter seinem Hemd und seine heftigen Atemzüge auf ihren Rippen fühlen konnte. Beatrice verwünschte ihr Kleid. Weshalb war die Seide nur so dünn? Ebenso gut hätte sie gar nichts anzuziehen brauchen. Hätte sie Yasmina doch nur gebeten, ihr ein derbes Wollkleid anzutun. Oder besser einen dicken knöchellangen Mantel aus Bärenfellen.
Nuh II. legte vertraulich einen Arm um sie und zog sie noch näher zu sich heran.
Beatrice wollte etwas sagen, aber die Zunge klebte ihr am Gaumen. Sie war nicht einmal in der Lage, seinen Arm von sich abzuschütteln. Er lastete wie ein zentnerschwerer feuchter Mehlsack auf ihren Schultern. Nuh II. schwitzte vor Erregung. Er legte auch noch den anderen Arm um sie und kam ihr mit seinem roten Gesicht so nahe, dass kaum noch ein Blatt zwischen sie und ihn passte. Ganz offensichtlich wollte er sie küssen – und dabei würde er es kaum belassen. Der glasige, lüsterne Ausdruck seiner kleinen blutunterlaufenen Augen gefiel ihr überhaupt nicht. Er erinnerte sie an einen brünstigen Keiler.
Beatrice geriet in Panik. Verzweifelt versuchte sie einen Ausweg aus der Umarmung zu finden. Aber je mehr sie sich wehrte, umso enger zog er sie an sich. Schreien war vermutlich sinnlos. Die dichten Stoffe und Teppiche an den Wänden und auf dem Boden waren wie geschaffen, um jedes noch so kleine Geräusch zu schlucken. Niemand würde sie hören und ihr zu Hilfe eilen. Dies hier war eine Falle, ausgeklügelt und gut durchdacht. Und sie war allein mit diesem fetten, perversen Kerl. Wie konnte sie sich ...
In diesem Augenblick presste der Emir seine speichelfeuchten, heißen Lippen auf ihre. Voller Entsetzen öffnete Beatrice ihren Mund, doch ihr Schrei wurde von einer dicken, fleischigen Zunge erstickt, die ungebeten vorstieß. Beatrice biss Nuh II. auf die Zunge, riss den Kopf zurück und drehte ihr Gesicht zur Seite. Er stöhnte kurz vor Schmerz und schlug ihr dann mit dem Handrücken so hart ins Gesicht, dass sie benommen rücklings auf das Bett fiel. Sie schmeckte Blut. Ihre ganze rechte Gesichtshälfte war taub. Schon in der nächsten Sekunde war der Emir über ihr. Sein dicker, massiger Leib lag auf ihr und presste ihr die Luft ab – der Kerl musste mindestens drei Zentner wiegen. Für eine Schrecksekunde war Beatrice wie gelähmt, doch dann spürte sie seine glitschigen, feuchten Hände, die an ihr herumtasteten und an den Seidenbändern ihres Ausschnitts nestelten, und es kam wieder Leben in ihren Körper. Ohne lange nachzudenken, packte sie seinen runden Kopf an beiden Ohren und drehte beide Ohrmuscheln so im Uhrzeigersinn, dass sie den Knorpel knirschen hören konnte. Nuh II. brüllte vor Schmerz auf und ließ sie los, um ihre Hände zu ergreifen. Auf diese Reaktion hatte Beatrice jedoch nur gewartet. Sie zog ein Knie an und rammte es dem fetten Emir genau zwischen die Beine. Er brüllte wie ein wütender verwundeter Stier und rollte sich japsend zur Seite. Hastig wühlte sich Beatrice aus den Kissen heraus, doch bevor sie aus dem Bett springen konnte, wurde sie wieder von Nuh II. gepackt. Sie wehrte sich, trat nach ihm, erreichte aber nur, dass ihr Kleid zerriss. Dann umschlang er ihren Bauch und drückte so fest zu, dass sie würgen musste.
»Du bleibst hier! Ich bin noch lange nicht fertig mit dir!«, keuchte er und zog Beatrice mit beinahe unmenschlicher Kraft wieder auf das Bett zurück. »Wir zwei werden noch eine vergnügliche Zeit miteinander verleben.«
Zu ihrem Entsetzen erkannte Beatrice, dass Nuh II. diese Situation sogar genoss. Wie sollte sie diesem perversen Kerl entkommen? In ihrer Not begann sie wild mit den Fäusten um sich zu schlagen. Schließlich traf ihr Ellbogen das Nasenbein des Emirs. Unter einem grässlichen Knirschen gab der Knochen nach und Blut schoss aus der gebrochenen Nase. In die Augen des Emirs trat ein erstaunter Blick. Beatrice taumelte zurück, befreite sich aus Nuhs Griff und stand aus dem Bett auf. Für einen kurzen Augenblick glaubte sie ihn endlich in die Schranken verwiesen zu haben. Das Blut lief dem Herrscher von Buchara in Strömen über das Gesicht und besudelte sein kostbares Seidenhemd.
Nasenbeinfraktur!, sprach eine innere Stimme zu ihr. Tu endlich etwas. Du bist Ärztin, du musst ihm helfen. Leg seinen Kopf in den Nacken, tamponiere die Nasenlöcher, damit die Blutung aufhört, und untersuche den Schädel nach weiteren Verletzungen.
Quatsch!, meldete sich eine andere, hasserfüllte Stimme zu Wort, von deren Existenz Beatrice bislang nicht einmal etwas geahnt hatte. Mach dir keine Gedanken. Der Mistkerl hat es verdient.
Langsam zog Beatrice sich zurück.
Nuh II. tastete seine geschwollene Nase ab. Überrascht betrachtete er das frische Blut an seinen Fingern, dann sah er Beatrice an. Dieser Blick sagte alles – und Beatrice schloss mit ihrem Leben ab. Nuh II., der uneingeschränkte Herrscher, Herr über die Geschicke der Menschen in Buchara, war Widerstand und Weigerung nicht gewohnt. Beatrice hatte seinen Jähzorn heraufbeschworen. Er würde sie mit Sicherheit köpfen lassen, wenn er sie nicht auf der Stelle zu Tode prügelte.
Was nun geschah, ging so rasch, dass Beatrice die Vorgänge erst später rekonstruieren konnte. Mit einem Gebrüll, das Beatrice fast die Trommelfelle zerriss, sprang Nuh II. aus dem Bett. Der Emir bewegte sich so schnell, wie sie es ihm auf Grund seiner Fettleibigkeit niemals zugetraut hätte. Unfähig, sich von der Stelle zu rühren oder auch nur zu schreien, starrte sie ihm und ihrem sicheren Tod entgegen. Doch im letzten Augenblick, bevor Nuh II. sie erreichte und zu Boden schleudern konnte, flog die Tür auf. Zwei starke Arme packten Beatrice von hinten, zogen sie in Sekundenschnelle aus dem Zimmer und warfen die Tür hinter ihr zu. Sie hörte das Poltern, als Nuh II. gegen die geschlossene Tür rannte. Er schrie vor Zorn und stieß rohe Verwünschungen aus.
»Verschwinde, wenn dir dein Leben lieb ist!«, zischte Jussuf dem alten Diener zu und legte den Riegel vor die Tür.
Verwundert sah Beatrice dem alten Mann nach, der sich in erstaunlichem Tempo davonmachte, ohne weitere Fragen zu stellen.
»Komm schon, zurück zum Harem!« Jussuf packte Beatrice und schleifte sie am Arm mit sich. Wie in Trance lief sie hinter dem Eunuchen her. Erst als sie vor ihrer eigenen Zimmertür stand, kam sie wieder richtig zu Bewusstsein.
»Ich danke dir für deine Hilfe«, sagte sie atemlos, als ihr klar wurde, was der Eunuch für sie getan hatte. »Danke mir nicht zu früh«, entgegnete Jussuf düster. »Nuhs Zorn wird nicht so schnell verrauchen, wie du vielleicht glaubst. Geh jetzt in dein Gemach. Ich werde dich einschließen. Das ist sicherer. Wenn Nuh II. in Zorn gerät, ist er unberechenbar.«
»Wie lange wirst du mich einsperren?«
»Bis er wieder zur Vernunft gekommen ist.« Jussuf schob Beatrice in das Zimmer. Gleich darauf hörte sie, wie der Schlüssel im Schloss umgedreht und der Riegel vorgeschoben wurde. Sie wusste zwar, dass nur Jussuf Schlüssel für die Gemächer der Frauen des Emirs besaß, nicht einmal die anderen Eunuchen hatten dieses Privileg, dennoch verriegelte sie die Tür zusätzlich von innen. Einem Ansturm der Soldaten der Palastwache würde der kleine, dünne Metallbolzen zwar kaum standhalten, aber sie fühlte sich trotzdem sicherer.
Kopfschüttelnd stand Ahmad al-Yarkuhn neben Nuh II. Der Emir lag von vielen Kissen gestützt auf einer schmalen Liege und stöhnte wie ein Schwerverletzter. Ahmad fragte sich, ob er wirklich so große Schmerzen hatte. Gut, seine Nase sah ziemlich übel aus, und noch immer war das Hemd des Emirs blutbefleckt. Doch hatte Nuh II. seinen Gegnern schon oft wesentlich schlimmere Verletzungen zufügen lassen, und bei Folter und Hinrichtungen sah er zu, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. In Bezug auf seinen eigenen Körper war der harte und unerbittliche Herrscher von Buchara offenbar ziemlich wehleidig.
Schweigend beobachtete Ahmad den Arzt bei seiner Arbeit.
Was wohl Ali al-Hussein über seinen Patienten dachte? Seine Miene war ruhig und unverbindlich freundlich, während er mit geschickten Händen verkrustetes Blut von der Nase des Emirs wusch. Nur manchmal glaubte Ahmad ein spöttisches, verächtliches Funkeln in den Augen des jungen Mannes zu entdecken. Aber vielleicht täuschte er sich auch. Er mochte Ali al-Hussein nicht. Er hielt den Arzt für einen hochmütigen, in sich selbst verliebten Schönling. Vielleicht traf zu, was einige Leute am Hofe des Emirs sagten, vielleicht war es ihm zu Kopf gestiegen, bereits in so jugendlichem Alter zum Leibarzt des Emirs ernannt worden zu sein. Aber insgeheim vermutete Ahmad, dass Ali al-Hussein von Geburt an arrogant und eingebildet war. Und dennoch, trotz seiner persönlichen Abneigung musste Ahmad eingestehen, dass Ali von seiner Kunst etwas verstand und wahrscheinlich der beste und geschickteste Arzt weit und breit war. Die Nase, noch vor wenigen Stunden kaum mehr als ein geschwollener, blutiger, unförmiger Klumpen im Gesicht des Emirs, ließ bereits ihre ursprünglichen Konturen wieder erahnen.
»Wann seid Ihr denn endlich fertig, Ali al-Hussein?«, fragte Nuh II. gereizt und wippte ungeduldig mit dem Fuß.
»Die Verletzung ist so schwer, dass sie besonderer Sorgfalt bedarf, Herr«, entgegnete der Arzt ruhig und tastete die Nase ab, so dass Nuh II. aufschrie.
Die seltsam klingende Stimme des Emirs reizte Ahmad zum Lachen, doch er biss sich auf die Lippen. Nuh II. hatte gebrüllt und getobt wie ein wilder Stier, nachdem die Sklavin aus seinem Zimmer geflohen war. Einen Knaben, der zufällig an seinen Gemächern vorbeigekommen war und die Zimmertür des Herrschers geöffnet hatte, hatte er in seiner Wut buchstäblich gegen die Wand geschleudert. Nur einem gütigen Schicksal war es zu verdanken, dass der Junge keine schlimmen Verletzungen davongetragen hatte. Nuh II. war immer noch zornig. Und es war unklug, seinen Zorn durch unbedachtes Gelächter weiter zu schüren.
»Ich werde Euch jetzt eine andere Salbe auf die Nase streichen«, sagte Ali unterdessen zum Emir. »Nachdem die Blutung endlich gestoppt ist, wird diese Rezeptur die Schwellung weiter zum Abklingen bringen. Doch Ihr solltet vorsichtig sein. Beim Niesen oder bei unbedachten Berührungen kann Eure Nase wieder zu bluten beginnen.«
Nuh II. knirschte mit den Zähnen. »Selbst wenn ich wollte, ich könnte gar nicht niesen. Wisst Ihr, was für Schmerzen ich erdulden muss?«
»Ja, Herr. Es ist nur Eurem starken Charakter zu verdanken, dass Ihr nicht vor Schmerz schreit und wimmert wie ein altes Weib«, erwiderte Ali al-Hussein. »Dennoch muss ich Euch bitten, Euer Leid noch eine Weile zu erdulden und so lange still zu halten, bis ich die Salbe aufgetragen und Euch einen Verband angelegt habe.«
Ahmad sah den Arzt scharf an. Er glaubte einen ironischen Unterton in der Stimme des jungen Mannes zu hören. Seiner Miene nach zu urteilen, war er jedoch der freundliche, um seinen Patienten besorgte Arzt.
»Dieses Biest!«, zischte Nuh II. und stöhnte laut, als Ali die Salbe auftrug. »Wenn ich dieses Weib in die Finger bekomme ...«
Ahmad fiel der Stein der Fatima wieder ein. Er wunderte sich, dass er tatsächlich für einen Augenblick nicht mehr an das kostbare Kleinod gedacht hatte, das sich immer noch in den Händen dieser Ungläubigen befinden musste. Waren diese Ereignisse das von Allah gesandte Zeichen, um das er gebeten hatte? Vielleicht bekam er jetzt die Gelegenheit, diesem unwürdigen Weib den heiligen Stein abzunehmen.
»Da Ihr sie gerade erwähnt, Herr«, sagte Ahmad und sah ungerührt zu, wie dem Emir die Tränen über die runden Wangen liefen. Er konnte kein Mitleid empfinden. Hätte Nuh II. auf ihn gehört, so wäre ihm dieser Schmerz erspart geblieben. Er hätte diese blonde Hexe niemals anrühren dürfen. »Was soll mit der Sklavin geschehen? Wollt Ihr sie dem Scharfrichter vorführen oder sie verbannen? Ihr könntet sie auch dem Sklavenhändler ...«
»Unsinn!«, fiel ihm der Emir ärgerlich ins Wort.»Nichts dergleichen wird geschehen. Bisher mussten sich selbst die wildesten, temperamentvollsten Pferde meinem Willen beugen. Da werde ich mich ganz gewiss nicht einer Frau geschlagen geben.«
»Aber Herr, Ihr ...«
Nuh II. winkte ab. »Natürlich muss ich sie bestrafen, aber nicht durch den Scharfrichter.« Er dachte kurz nach, dann hellte sich seine Miene auf. »Ich werde sie einsperren lassen. Für, sagen wir, zehn Tage. In eine kleine Zelle, ohne Tageslicht. Und dann werden wir ja sehen, ob dieses Weib es noch einmal wagt, mich anzugreifen.«
»Ihr wollt sie wirklich wieder in Euer Schlafgemach holen?«, platzte Ahmad entsetzt heraus.
Mittlerweile war Ali al-Hussein mit der Behandlung fertig und verstaute die Salbentiegel in seiner Tasche. Nuh II. erhob sich umständlich von der Liege. Er machte den Eindruck, als hätte er nicht nur eine Verletzung des Gesichts, sondern auch des Rückens erlitten. Unter lautem Stöhnen ließ er sich schwerfällig auf eines der weichen Sitzpolster fallen. Dann verlangte er nach seinem Handspiegel. Für einen kurzen Augenblick sah Ahmad auf dem Gesicht des jungen Arztes ein schadenfrohes Lächeln. Doch es verschwand so schnell, dass Ahmad erneut glaubte sich getäuscht zu haben.
»Natürlich werde ich die Sklavin wieder zu mir holen, Ahmad. Ich habe sie schließlich nicht erworben, damit sie ihre Tage in meinem Garten verbringt«, erwiderte der Emir, sah in den Spiegel und betastete vorsichtig den dicken Verband an seiner Nase. »War das wirklich nötig, Ali al-Hussein? Ich sehe aus wie ein Possenreißer.«
Der Arzt verschloss sorgfältig seine Tasche und zuckte gleichmütig mit den Schultern.
»Dieser Verband schont den Knochen und wird Euch daran erinnern, in den kommenden Tagen vorsichtig zu sein. Wenn Ihr es wünscht, kann ich ihn selbstverständlich wieder entfernen. Ich lehne dann jedoch jede Verantwortung dafür ab, sollte Eure Nase schief und krumm zusammenwachsen.«
»Und wie lange muss ich diesen Verband erdulden?«
»Zwischen zehn und zwanzig Tagen. Es ...«
»Was? Hat Allah Euch den Verstand geraubt? Seid Ihr von allen guten Geistern verlassen, Ali al-Hussein? Ich werde niemals so lange diese Binden ...«
»Es kommt ganz auf Euch und Eure Geduld an, Herr«, entgegnete der Arzt ruhig. »Wenn Ihr Euch meinen Anweisungen fügt, werde ich den Verband in zehn Tagen entfernen können. Anderenfalls dauert es länger.«
Nuh II. starrte den Arzt wütend an. Ahmad konnte nicht umhin, den jungen Ali zu bewundern, der ruhig und gelassen dem vernichtenden Blick des Herrschers standhielt. Es war ein stummes Kräftemessen, bis Nuh II. endlich nachgab.
»Nun denn, so sei es.« Er seufzte, warf nochmals einen Blick in den Spiegel und schüttelte resigniert den Kopf. »Ahmad, kümmere dich darum, dass alle Regierungsgeschäfte in den kommenden zehn Tagen abgesagt werden. So kann ich unmöglich vor das Volk treten.«
»Sehr wohl, Herr. Und was soll ich dem Volk sagen?«
Nuh II. dachte einen Augenblick nach. »Dass ein noch nicht abgerichteter Falke mich angegriffen und im Gesicht verletzt habe.«
Ahmad verbeugte sich.
»Wie Ihr es wünscht, Herr.«
»Herr, ich darf mich verabschieden? Solltet Ihr mich brauchen, ruft nach mir. Morgen komme ich zur gleichen Zeit wieder und sehe nach Euch.«
Der junge Arzt verbeugte sich vor Nuh II., nickte Ahmad kurz zu und ging, ohne die Erlaubnis des Emirs abzuwarten.
»Er ist ein fähiger Arzt«, meinte Nuh II. grimmig. »Aber eines Tages wird er seinen Hochmut bereuen.«
»Sicher, Herr, es ist, wie Ihr sagt«, entgegnete Ahmad und stieß einen Seufzer aus. Irgendwie beneidete er Ali al-Hussein. »Aber wir haben gerade über die Sklavin geredet. Ihr wollt sie wirklich wieder zu Euch holen?«
»Bist du auf deine alten Tage taub geworden? Das sagte ich doch eben.«
»Herr, verzeiht mir, aber das kann ich nicht gutheißen«, erklärte Ahmad vorsichtig. »Tut das nicht. Bedenkt noch einmal Eure Entscheidung. Dieses Weib ist nicht wie unsere Frauen. Sie ist gefährlich. Sie hat Euch bereits einmal verletzt. Was wird sie Euch das nächste Mal antun? Ihr solltet ...«
»Ich kann mir schon vorstellen«, unterbrach Nuh II. ihn erneut, »welchen Rat du mir geben willst, Ahmad. Diese Frau zu verbannen mag für Männer wie dich die beste Lösung sein. Du bist nicht verheiratet und kennst dich nicht mit Frauen aus.« Nuh II. bedachte Ahmad mit einem verächtlichen, mitleidigen Lächeln. »Ich hingegen habe mehr als zwanzig Frauen in meinem Harem. Und jede von ihnen ist im Laufe der Zeit gehorsam und gefügig geworden. Glaube mir, auch mit dieser Sklavin aus dem Norden wird es nicht anders sein.«
Ahmad spürte, wie der Zorn in ihm aufwallte. Nuh II. hatte wieder einmal an einer alten Wunde gerührt. Diese Wunde hatte der Emir eigenhändig geschlagen, als er die einzige Frau, die Ahmad jemals geliebt hatte, zu sich in den Harem genommen hatte. Es war mittlerweile fast zwanzig Jahre her, aber die Wunde war nicht verheilt – sie schmerzte immer noch genau wie damals. Doch Ahmad sagte nichts. Am Tag der Hochzeit hatte er sein ganzes Leben in den Dienst Allahs und des Emirs von Buchara gestellt. Er hatte kein Recht, Nuh II. in seine Schranken zu weisen. Also schluckte er seine Wut hinunter.
»Herr, verzeiht, dass ich Euch widerspreche. Diese Frau ist nicht wie die anderen. Sie ist größer, kräftiger, und wer weiß, über welche seltsamen Fähigkeiten sie verfügt. Sie wird sich nicht so leicht von Euch zähmen lassen. Diese Frau wird Euch wieder angreifen. Fragt Ali al-Hussein, er hat die Frau untersucht. Er kann noch nicht weit sein, er wird Euch meine Worte bestätigen.«
»Ich werde diesem selbstgefälligen Arzt hinterherlaufen und mich endgültig zum Gespött von Buchara machen? Darauf kannst du lange warten!«, erwiderte Nuh II. und stieß ein zorniges Lachen hervor. »Nein. Einmal ist es diesem Weib gelungen, mich zu verletzen. Aber nur, weil sie mich mit ihrer heftigen Gegenwehr überrascht hat. Ich versichere dir, das nächste Mal wird ihr das nicht gelingen. Ich bin darauf vorbereitet.«
Ahmad wünschte, er könnte Nuhs Worte mit dem gleichen Achselzucken hinnehmen wie Ali al-Hussein, aber es gelang ihm nicht. Trotz der Demütigungen, die er immer wieder durch diesen Tyrannen zu ertragen hatte, brachte er es nicht fertig, ihn ins offene Messer laufen zu lassen.
Er fühlte sich diesem Mann verpflichtet, selbst wenn es ihm manchmal schwer fiel.
»Herr, ich ...«
»Ahmad, ich will nicht mehr darüber reden«, unterbrach ihn Nuh II. scharf. »Du hast meine Befehle vernommen. Kümmere du dich um die Geschäfte. Und sorge dafür, dass Jussuf die Sklavin in eine finstere Zelle sperrt, aus der sie erst in zehn Tagen wieder entlassen wird.«
»Herr ...«
»Geh!«
Ahmad biss sich auf die Lippe, verbeugte sich kurz und verließ hastig den Raum. Nachdem er die Tür fest hinter sich zugezogen hatte, stieß er heftig die Luft aus und schüttelte den Kopf. Vor ihm lag ein großes Stück Arbeit. Die Regierungsgeschäfte bereiteten ihm keine Sorgen. Vieles davon würde er selbst erledigen können, anderes ließe sich tatsächlich aufschieben, bis der Emir wieder vollständig genesen war. Außerdem würde er so ohne viel Aufhebens Saddin den kleinen Gefallen erweisen können, um den der Nomade ihn gebeten hatte. Wenn er selbst die Verhandlung führte, würde es leicht werden, den Gauner Malek al-Omar freizusprechen.
Um Jussuf machte Ahmad sich gar keine Gedanken. Der Eunuch würde den Befehl des Emirs gehorsam ausführen und die Sklavin nach zehn Tagen wieder aus dem Kerker befreien. Und das war genau der Punkt. Ein erneutes Zusammentreffen des Emirs mit dieser germanischen Hexe durfte auf gar keinen Fall zu Stande kommen. Irgendwie musste es Ahmad gelingen, das zu verhindern.
Weitaus schwieriger würde es jedoch werden, den wahren Grund für die Verletzung des Emirs geheim zu halten. Es gab dunkle Kanäle, aus denen jede noch so unwichtige Begebenheit im Palast nach außen sickerte und in den Gassen Bucharas die Runde machte. Die Diener, die Kaufleute und natürlich Ali al-Hussein – jeder von ihnen konnte die Wahrheit über die gebrochene Nase des Emirs weitertragen. Vielleicht begannen bereits in diesem Augenblick, während er noch hier stand und sich darüber den Kopf zerbrach, wie er das Unheil abwenden konnte, verräterische Zungen mit ihrem Werk. Und eines war sicher – auf diese Geschichte würde sich das Volk mit Begeisterung stürzen. Ahmad seufzte tief.
»O Allah!«, murmelte er und strich sich nachdenklich durch den Bart. »Was soll ich nur tun? Wie soll ich den Namen des Emirs vor dem Gespött des Pöbels schützen? Weshalb hast Du ausgerechnet mir diese Verantwortung aufgebürdet?«
Doch dann glitt ein Lächeln über sein Gesicht. Diese ganze unerfreuliche Angelegenheit hatte auch ihr Gutes. Zehn Tage würde diese Ungläubige eingesperrt sein. Zehn Tage hatte er also Zeit, ihren Besitz nach dem Stein der Fatima zu durchsuchen. Das sollte ausreichen. Er hob seine Hände und dankte Allah für Seine unermessliche Weisheit und Güte.