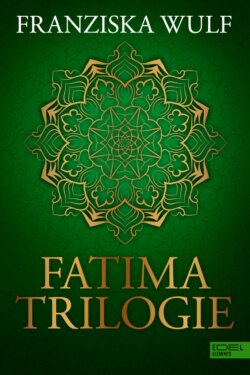Читать книгу Fatima Trilogie Gesamtausgabe - Franziska Wulf - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VI
ОглавлениеHerr, verzeiht, dass ich Euch störe.«
Selim war so leise in das Arbeitszimmer getreten, dass Ali erschrocken zusammenzuckte. Er untersuchte gerade einen fünf Jahre alten Jungen, der seit zwei Jahren nicht mehr sprechen wollte.
»Was gibt es denn?«, fragte er unwirsch.
»Ich habe eine Nachricht für Euch. Der ...«
Doch Ali ließ ihn gar nicht ausreden. »Wenn ich fertig bin, werde ich dich anhören. Warte so lange vor der Tür!«
Mit hängenden Schultern verließ Selim den Raum fast noch leiser, als er gekommen war. Er tat Ali beinahe Leid. Vielleicht war er doch etwas zu schroff gewesen. Aber sein Diener musste lernen, dass er unter gar keinen Umständen gestört werden durfte, wenn er gerade einen Patienten behandelte. Selbst dann nicht, wenn der Vater ein einfacher Ziegenhirte war und sich die Behandlung seines Sohnes eigentlich gar nicht leisten konnte.
Mit einem Seufzer wandte er sich wieder dem kleinen Jungen zu, der ihn mit großen dunklen Augen aufmerksam ansah. Ali untersuchte die Ohren des Kindes, schaute ihm in den Mund und tastete seinen Hals ab. Er konnte nicht feststellen, dass der Kleine unter einer Erkrankung litt. Was also sollte er tun? Wie sollte er den Jungen heilen?
Ali warf einen kurzen Blick auf den Vater. Der Mann war, wie auch sein Sohn, ärmlich, aber sauber gekleidet. Er war mager und abgehärmt, so dass er fast wie ein Greis aussah, obwohl er kaum älter als Ali selbst sein mochte. Dieses Gesicht erzählte von Entbehrungen, von Hunger, von harter Arbeit, von Armut, Ungerechtigkeit und Not. Dennoch hatte er sich mit seinem kleinen Sohn auf den beschwerlichen Weg gemacht, quer durch die Rote Wüste, um den berühmten Arzt aufzusuchen, der sogar die Lieblingsfrau des Emirs vom Tode gerettet hatte. Fünf Tage waren die beiden unterwegs gewesen, drei weitere Tage hatten sie auf eine Konsultation gewartet. Ihre Verpflegung hatte aus einem Schlauch voll Wasser und einem kleinen Sack gemahlener Hirse und gekochter Linsen bestanden. Jetzt ruhten die verzweifelten Blicke des Mannes auf Ali, als hinge nicht nur das Leben seines Sohnes, sondern auch sein eigenes Seelenheil von dem Arzt ab.
Während Ali an dem Jungen herumtastete, dachte er angestrengt nach. Irgendetwas musste er doch für das Kind tun können. Sollte er sie anlügen und ihnen eine kostspielige Behandlung anraten? Das würde wahrscheinlich die gesamte Familie in den Hungertod treiben. Andererseits brachte er es auch nicht übers Herz, die beiden einfach so wieder fortzuschicken und ihrem Schicksal zu überlassen. Was also sollte er tun?
»Was sagt Ihr, Herr?«, fragte der Mann schüchtern und drehte nervös seinen abgetragenen, bereits mehrfach geflickten Fez in den Händen. »Könnt Ihr meinem Sohn helfen?«
»Es gibt keine Anzeichen für eine körperliche Erkrankung deines Sohnes«, begann Ali zögernd, in der Hoffnung, dass ihm wie so oft beim Sprechen der rettende Gedanke käme. »Er hat offensichtlich keine Verletzungen erlitten, Ohren und Zunge sehen normal aus. Aber ...« Ja, natürlich, das war es! »Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit. Manchmal wird eine Stummheit durch ein schreckliches Ereignis ausgelöst. Hat dein Sohn ein solches Erlebnis gehabt?«
Der Mann legte seine Stirn in Falten und dachte angestrengt nach. »Ich glaube nicht, ich weiß aber nicht genau ...«
»Nun, du musst nicht in seiner Nähe gewesen sein. Aber es gibt andere Anzeichen, ob ein solches Ereignis stattgefunden hat. Fürchtet er sich vor dem Einschlafen? Träumt er schlecht, oder möchte er im Dunkeln nicht allein sein?«
»Ja, das ist richtig, Herr!«, rief der Mann überrascht aus.
»Woher wisst Ihr das?«
Ali lächelte. Wieder einmal hatte ihm eine spontane Eingebung den richtigen Weg gewiesen. »Deinem Sohn kann geholfen werden.« Er öffnete einen Schrank und nahm eine kleine Phiole aus glasiertem Ton aus einem Kästchen. »Dies ist Orangenblütenöl. Gib jeden Abend einen Tropfen davon in eine Schüssel Wasser und bade deinen Sohn damit. Und wenn er sich zum Schlafen hinlegt, bleibe noch eine Weile an seinem Lager. Er hat offensichtlich einen Schock erlitten. Es wird einige Zeit dauern, und ich kann dir nicht sagen, wie lange, aber ich bin sicher, er wird wieder anfangen zu sprechen.«
»Gepriesen sei Allah!«, rief der Mann aus und seine dunklen Augen wurden feucht. »Ihr seid wahrlich ein großer Arzt, Herr! Was bin ich Euch schuldig?«
»Nicht doch ...«, winkte Ali ab. Aber er hatte nicht mit dem Eigensinn des Mannes gerechnet – und mit seinem Stolz.
»Nein, Herr, ich will Euch Euren Dienst bezahlen«, sagte er mit fester Stimme. »Ich habe auf dem Markt eine Ziege verkauft. Ich habe Geld.«
Der Mann öffnete einen kleinen Beutel aus Ziegenleder und ließ das Geld hinausgleiten – auf seiner schwieligen Hand lagen ein Dinar und fünf Kupfermünzen. Ali schluckte, als er sich vorstellte, dass diese paar Münzen wahrscheinlich das gesamte Vermögen des Mannes darstellten – abgesehen von seinen Ziegen, einer Frau und sieben Kindern.
»Du hast eine Ziege verkauft?« Ali tat, als wäre er enttäuscht. »Schade. Du musst wissen, ich liebe Ziegenfleisch. Ich wage ja gar nicht zu fragen, aber Zicklein sind in Buchara überaus teuer. Wenn du vielleicht statt des Geldes ...«
Über das magere Gesicht des Mannes glitt ein strahlendes Lächeln. »Soll ich Euch ein Zicklein bringen?«
»Das würdest du wirklich tun?«
»Mit Freuden, Herr! Unsere beste Geiß wird in ein paar Tagen Junge bekommen. Ich werde Euch ein schönes, zartes Zicklein bringen.«
»Ich weiß gar nicht, ob ich das annehmen kann. Das ist viel zu ...«
Doch der Mann ließ ihn nicht ausreden. »Nein, Herr, ich bin Euch zu Dank verpflichtet. Ihr habt meinem Sohn geholfen.«
»Du musst jetzt gehen«, sagte Ali und versuchte seine Verlegenheit zu verbergen. »Es warten noch andere Kranke darauf, meinen Rat zu hören.«
»Entschuldigt, Herr, dass wir Eure Zeit so lange in Anspruch genommen haben.« Der Mann ergriff den Saum von Alis Gewand und küsste ihn ehrfürchtig. »Allah möge Euch segnen. Er schenke Euch ein langes, gesundes Leben, Wohlstand und viele ehrbare Nachkommen.«
Ali schob den Mann mit seinem Sohn hinaus und schloss erleichtert die Tür. Mit einem Seufzer ließ er sich auf ein weiches Polster fallen und trank einen großen Schluck Rosenwasser. Seit sich die wundersame Heilung der Lieblingsfrau des Emirs in Buchara und Umgebung herumgesprochen hatte, kamen die Menschen von überall her, um ihre Leiden von ihm, dem berühmten Arzt, kurieren zu lassen. Viele kamen einfach nur zu ihm, um ihren Verwandten erzählen zu können, dass sie von Ali al-Hussein ibn Abdallah ibn Sina, dem wundertätigen Arzt aus Buchara, behandelt worden waren. Andere jedoch wie dieser einfache, arme Ziegenhirte kamen aus schierer Verzweiflung. In ihren Augen las er die Hoffnung, dass er ihnen vielleicht helfen könne. Und während die anderen mit Ali um die Preise feilschten, als wäre er ein Teppichhändler auf dem Bazar, waren diese armen Menschen bereit, ihr ganzes Vermögen für die Behandlung zu geben. Sie legten ihr Leben in Alis Hände. Und wenn er einmal nicht in der Lage war, sie von ihrem Leiden zu heilen, so war es nicht seine Schuld. Nicht Ali al-Hussein war unfähig, sondern dann war es eben Allahs Wille. Diese Menschen beschämten Ali zutiefst.
»Verzeiht, Herr, darf ich jetzt ...«
Ali sah auf. »Ach Selim, dich hätte ich beinahe vergessen.« Er fuhr sich über das Gesicht und durch das Haar. Plötzlich fühlte er sich müde und erschöpft. »Warten noch viele Patienten?«
»Herr, vor der Tür stehen nur noch drei, eine alte, fast blinde Frau mit ihrem Sohn, ein Mann auf Krücken und ein Mann mit seiner Frau. Aber unten in der Halle warten noch mehr. Soll ich sie fortschicken und ihnen sagen, dass sie morgen wiederkommen sollen? Die Sonne geht bald unter. Ihr habt nun schon den ganzen Tag Kranke behandelt. Ihr seht müde aus, Herr, Ihr solltet Euch ausruhen.«
Ali schloss einen Moment die Augen. Ausruhen. Ja, das war es, was er jetzt brauchte – ein heißes Bad, eine Massage mit warmem Öl und anschließend schlafen. Aber dann sah er den Ziegenhirten und seinen kleinen Jungen vor sich. Die Kranken, die unten auf ihn warteten, hatten womöglich noch längere Wege hinter sich.
»Nein, lass gut sein, Selim. Ich werde diese Patienten noch behandeln. Sie warten schließlich bereits den ganzen Tag.« Er seufzte. »Du wolltest mir vorhin etwas sagen?«
»Ja, Herr. Der Emir hat einen Boten geschickt. Er lässt Euch mitteilen, dass er Euch morgen gleich nach dem Morgengebet zu sprechen wünscht. Er wird Euch eine Sänfte schicken.«
Ali runzelte die Stirn. Was konnte der Emir von ihm wollen? Er hatte ihn bereits seit längerer Zeit nicht aufgesucht; genauer gesagt war er das letzte Mal im Palast gewesen, als Mirwats Wunde, die der Gänsekiel in ihrem Hals hinterlassen hatte, verheilt war. Ob Nuh II. ibn Mansur der Meinung war, dass er sich zu wenig um ihn kümmerte? Aber es hatte keinen Sinn, sich jetzt den Kopf darüber zu zerbrechen, morgen würde er es erfahren.
»Danke, Selim«, sagte er zerstreut. Der alte Diener sah ihn überrascht an. Es kam nicht oft vor, dass sich Ali bei ihm bedankte, noch dazu für einen derart geringen Dienst.
»Ich diene Euch mit Freuden«, erwiderte er und verbeugte sich ehrfürchtig.
»Schick mir die alte Frau und ihren Sohn.« Ali erhob sich. »Und das Tor soll geschlossen werden. Abgesehen von denen, die bereits warten, wird heute kein Patient mehr vorgelassen«
»Sehr wohl, Herr, ich werde mich sofort darum kümmern.«
Während Selim hinausschlurfte, seufzte Ali und verwünschte bereits seine Entscheidung, heute noch weitere Patienten zu behandeln. Er war einfach zu gutmütig. Wer schon so lange gewartet hatte, würde auch noch bis morgen warten können.
Es war wieder die »Stunde der Frauen«. Beatrice und Mirwat schlenderten durch den Garten und kosteten von den frischen Datteln, die eine Dienerin ihnen auf einer Messingschale anbot. Im Winter, hatte Mirwat Beatrice erzählt, wurde es manchmal so kalt, dass Wasser in den Teichen und Brunnen des Gartens zu Eis gefror. Aber zum Glück lag der Winter noch in weiter Ferne. Jetzt streichelte der laue Abendwind ihre Wangen, und das Licht der untergehenden Sonne überzog alles mit einem Goldschimmer. Es war eine Atmosphäre wie aus einem preisgekrönten Hollywoodfilm – so schön, dass man es fast nicht glauben konnte.
Doch Beatrice vermochte die zauberhafte Stimmung an diesem Abend nicht zu genießen. Bereits seit einigen Tagen plagte sie eine zunehmende Unruhe, die heute ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht hatte. Dabei hatte es nichts damit zu tun, dass sie auf rätselhafte Weise im orientalischen Mittelalter gelandet war. Hiermit hatte sie sich bereits wenige Tage nach dem Gespräch mit Mirwat abgefunden und sich sogar mit dem Gedanken arrangiert – wenigstens bildete sie sich das ein. Nein, es war etwas anderes. Da war ein unterschwelliges Gefühl des Unbehagens. Sie war deprimiert, nervös, gereizt ...
»Was sagst du dazu?«, drangen plötzlich Mirwats Worte in ihre Überlegungen. »Ich würde gerne deine Meinung hören«
»Oh, ich finde, du hast Recht«, antwortete Beatrice hastig.
»Gib dir keine Mühe, Beatrice«, erwiderte Mirwat mit einem Lächeln. »Du hast nicht ein Wort von dem gehört, was ich gesagt habe. Wo bist du nur mit deinen Gedanken?«
Beatrice hob resigniert die Hände. Konnte denn hier gar nichts verborgen bleiben? »Es tut mir Leid, ich habe gerade nachgedacht. Das wird doch wohl noch erlaubt sein, oder?« Gleich darauf merkte sie, dass ihre Antwort schroffer ausgefallen war, als sie beabsichtigt hatte. »Entschuldige, ich bin heute nicht in besonders guter Stimmung.«
»Ja, das ist mir auch schon aufgefallen.« Mirwat schüttelte den Kopf. »Was ist nur mit dir los? Du bist nervös und reizbar wie ein Löwe im Käfig.«
Beatrice dachte eine Weile nach. Wie ein Löwe im Käfig. Ja, vielleicht hatte Mirwat damit sogar den Nagel auf den Kopf getroffen. Sie war eine Gefangene – eingesperrt in diesem Palast, einem luxuriösen Kerker mit Marmorböden, Ebenholzmöbeln und Dienern für jede noch so alltägliche Verrichtung. Niemals, nicht einmal für einen kurzen Augenblick, war sie für sich allein. Ständig wurde sie beobachtet, ständig waren die anderen Frauen in der Nähe, die Dienerinnen oder die Eunuchen. Dienerinnen brachten ihr das Essen, noch bevor sie wirklich Hunger bekam, Mädchen hielten das Zimmer sauber und ordentlich und halfen ihr beim Ankleiden, Auskleiden, Baden und Frisieren. Wenn sie morgens die Augen aufschlug, wartete bereits Yasmina auf einen Befehl, und wenn sie sich abends ins Bett legte, breitete Yasmina die Laken über sie. Manchmal schrak Beatrice aus dem Schlaf hoch, weil sie glaubte, dass man sie sogar während ihrer Träume beobachtete.
Zusätzlich litt sie unter geradezu tödlicher Langeweile. Anfangs waren die Frauen sehr oft zu ihr gekommen, um sich von ihr medizinischen Rat zu holen. Häufig hatte sie sogar noch spät in der Nacht Patientinnen behandelt. Doch mit der Zeit brauchten sie ihre Hilfe immer seltener. Beatrice hatte schon überlegt, sich um die armen Kreaturen im Kerker des Sklavenhändlers zu kümmern, aber natürlich war das verboten. Mirwat hatte fast der Schlag getroffen, als Beatrice ihr von dieser Idee erzählt hatte, und sich geweigert, ihr bei der Durchführung zu helfen. Ihr selbst jedoch fehlten die nötigen Verbindungen, um ihr Vorhaben allein in die Tat umzusetzen. Sie hätte nicht einmal gewusst, wie sie den Kerker finden sollte.
Die Stunden wurden mit jedem Tag länger und unerfüllter. Es gab kein Radio, keinen Fernseher, um sich abzulenken, nur das Geplauder der anderen, das sich stets um die gleichen Themen drehte – Männer, Kleider, Kinder. Wie sehr sehnte Beatrice sich danach, ein Buch in der Hand zu halten, allein und ungestört in einer stillen Ecke zu sitzen und einen Roman zu lesen. Aber sie war gefangen, gefangen in dieser Zeit. Und es gab kein Entrinnen.
»Du siehst traurig aus«, sagte Mirwat und blickte sie forschend an. »Fehlt dir etwas?«
Beatrice seufzte. »Ich glaube, ich habe Heimweh.«
»Vermisst du deine Familie?«, erkundigte sich Mirwat mitfühlend.
Beatrice runzelte nachdenklich die Stirn. Seltsam, über ihre Eltern und ihre Freunde hatte sie noch gar nicht nachgedacht. Was mochten sie wohl gerade tun? Fehlte sie ihnen? Fragten sie sich, was aus ihr geworden war? Vielleicht war sie ja gar nicht wirklich verschwunden, sondern lag auf irgendeiner Intensivstation im Koma. Vielleicht schuf sie sich dort als Gefangene ihres eigenen Geistes diese Traumwelt. Sie wusste noch nicht einmal, ob ihr diese Vorstellung Angst machte. Oder ob es sie beruhigte, dass es wenigstens eine Erklärung für den Wahnsinn gab, den sie gerade durchlebte.
»Ja, ich vermisse meine Familie. Aber vor allem vermisse ich mein gewohntes Leben, die Freiheit zu tun, was mir gefällt.«
»Aber das darfst du doch», erwiderte Mirwat und schüttelte verständnislos den Kopf. »Niemand darf dir Befehle erteilen.«
»Ja, natürlich«, entgegnete Beatrice mit einem Anflug von Bitterkeit. Wenn man wie Mirwat dazu erzogen worden war, eines Tages im Harem des Emirs zu leben, dann konnte das Leben hier in der Tat wie das Paradies erscheinen. Aber sie selbst? Für sie war es die Vorstufe zur Hölle. Beatrice sehnte sich danach, am Abend nach einem langen, arbeitsreichen Tag ins Bett zu fallen, froh und dankbar, dass sie endlich liegen durfte. Manchmal, wenn sie nach über dreißig Stunden Dienst nach Hause gekommen war, war sie so müde gewesen, dass sie sich nicht einmal mehr zugedeckt hatte und am anderen Morgen frierend aufgewacht war. Hier war der Schlaf im Grunde genommen kaum notwendig. Weder Körper noch Geist wurden ausreichend gefordert, um eine echte Müdigkeit zu erzeugen. Beatrice schlief schlecht. Sie träumte wirres Zeug und wachte oft mitten in der Nacht auf, ohne wieder einschlafen zu können. Meistens stand sie dann auf, um sich die Sterne anzusehen. Aber das hölzerne Gitter vor ihrem Fenster behinderte die Aussicht. Sie konnte sich nicht einmal hinauslehnen. Wenn sie sich wenigstens um ihre eigenen Bedürfnisse hätte kümmern können. Aber genau das durfte sie nicht.
Als sie vor ein paar Tagen Yasmina gesagt hatte, dass sie sich allein anziehen wolle, war die Kleine laut weinend aus dem Zimmer gestürzt, und erst einige Stunden später hatte Beatrice erfahren, dass das Mädchen geglaubt hatte, sie würde es aus ihren Diensten verstoßen. Mirwat hatte sich sicherlich noch niemals in ihrem Leben selbst angekleidet, geschweige denn, dass sie gearbeitet hatte. Sie konnte daher auch gar nicht wissen, was ihr entging und was Beatrice fehlte. Aber wie sollte sie das der Freundin erklären?
»Wir sollten uns hinsetzen, dann lässt sich leichter reden«, schlug Beatrice vor. Sie nahmen auf einer Bank in einem abgelegenen Teil des Gartens Platz, von dem sie wussten, dass die anderen Frauen ihn nur selten aufsuchten.
»Zu Hause, in Hamburg«, begann Beatrice, nachdem sie eine Weile schweigend nebeneinander gesessen und dem Gesang der Vögel gelauscht hatten, »habe ich für mich selber gesorgt. Ich habe mein Gemüse und Fleisch selbst eingekauft und habe mir mein Essen selbst gekocht. Ich habe mich selbst gebadet und angezogen. Ich habe sogar meine Wäsche selbst gewaschen.«
»Aber das ist ja schrecklich!«, rief Mirwat und sah Beatrice mit einer Mischung aus Entsetzen und Mitleid an. »Hattest du denn überhaupt keine Diener? Du Ärmste!«
Beatrice lächelte. Sie hatte gewusst, dass es Mirwat schwer fallen würde, sie zu verstehen.
»Es ist nicht so schlimm, wie du denkst. Ich brauchte mich nicht an den Brunnen zu stellen, um dort die Wäsche zu waschen. Wir haben Apparate, die fast von selbst arbeiten und das für uns erledigen. Und das Wasser wird über ein ausgeklügeltes Rohrsystem direkt in unsere Wohnungen und Häuser gebracht. Aber«, fuhr Beatrice fort, ohne auf Mirwats ungläubige Miene zu achten, »ich war mein eigener Herr. Ich war allein, wenn ich allein sein wollte, und wenn ich Lust auf Gesellschaft hatte, habe ich meine Freunde gerufen. Und es gab keinen Unterschied, ob es sich dabei um Männer oder Frauen handelte.«
»Was?!«
»Dir fällt es sicherlich schwer, das zu glauben. Aber es ist die Wahrheit. Ich habe mit Männern Kaffee getrunken, bin mit ihnen spazieren gegangen ...«
»... und ins Kino!«, fügte Beatrice voller Sehnsucht in Gedanken hinzu. Hatte es wirklich eine Zeit gegeben, als sie mit männlichen Kollegen am selben Tisch in der Kantine gesessen und gegessen hatte? Sich mit ihnen unterhalten hatte – über das neue Kinoprogramm, den Chef, Patienten, Tratsch aus dem Krankenhaus? Oder war das alles nur ein Traum?
Mirwat schüttelte ungläubig den Kopf. »Aber das ist unmöglich. Niemand würde das zulassen. Du kannst dich nicht einfach in der Öffentlichkeit mit Männern treffen. Du bist eine Frau!«
Beatrice lächelte traurig. »Dort, wo ich herkomme, ist das möglich. Frauen dürfen wie Männer zu jeder Zeit überall hingehen. Wir brauchen uns nicht einmal zu verschleiern.«
»Das gibt es nicht. Du willst mich zum Narren halten. Du denkst dir eine Geschichte aus.«
»Nein, Mirwat, ich schwöre dir, es ist die reine Wahrheit. Eigentlich hatte ich gar nicht vor, dir etwas davon zu erzählen. Ich wusste, dass es dir schwer fallen würde, mir zu glauben, dass es in deinen Ohren wie ein Märchen klingen muss. Aber vielleicht kannst du mich jetzt besser verstehen und sogar nachvollziehen, weshalb mir eure Sitten und Bräuche manchmal seltsam vorkommen und ich Probleme habe, mich daran zu gewöhnen.«
»Ich glaube dir kein Wort!«, rief Mirwat aus und sprang hoch. »Du lügst, sobald du den Mund aufmachst. Wahrscheinlich ist auch das ganze Geschwätz von der Heilkunde gelogen. Du bist in Wirklichkeit gar keine Ärztin, sondern ein Kräuterweib, eine Hexe, die uns alle mit ihrer schwarzen Zauberkunst ins Verderben stürzen will.«
»Bitte, Mirwat, beruhige dich wieder«, versuchte Beatrice erschrocken die Freundin zu beschwichtigen. Was hatte sie nur gesagt?
»Nein!«, kreischte Mirwat und wich mit weit aufgerissenen Augen vor ihr zurück. »Rühre mich nicht an, böses Weib!«
»Mirwat! Sprich leise, es könnte dich jemand hören.«
»Das würde natürlich deine Pläne vereiteln, nicht wahr? Was hattest du mit uns vor? Wolltest du uns alle verzaubern und in dein Reich hexen? Oder wolltest du uns alle töten, ganz langsam, eine nach der anderen? Vielleicht hast du ja sogar Sekireh auf dem Gewissen. Vielleicht stirbt sie nur, weil du sie mit deinem bösen Blick ...«
Das war zu viel. Beatrice gab Mirwat eine Ohrfeige, die vermutlich im ganzen Garten zu hören war. Die junge Frau starrte sie erschrocken an und hielt sich die Wange. Aber wenigstens war sie von einer Sekunde zur anderen still.
»Wie kannst du es wagen, solche Dinge zu sagen!« Beatrice zitterte vor Zorn. »Wenn ich euch alle töten wollte, glaubst du, ich hätte dir den Dattelkern aus dem Hals gezogen? Nein, ich hätte die Gelegenheit ergriffen und dich als Erste jämmerlich verenden lassen!« Mirwat begann zu weinen.
»Beatrice, bitte, ich ...« Doch Beatrice war zu wütend, um zuzuhören. »Verschwinde, Mirwat, ich will dich nicht mehr sehen. Wenn du glaubst, dass du wieder normal geworden bist, kannst du zu mir kommen. Du weißt, wo du mich findest!«
Laut schluchzend rannte Mirwat davon.
Beatrice ließ sich wieder auf die Bank fallen. Ihre Handfläche brannte und kribbelte von dem Schlag, den sie Mirwat verpasst hatte. Jetzt, da ihr Zorn allmählich verrauchte, tat es ihr fast Leid, Mirwat geschlagen zu haben. Aber wie hätte sie die hysterische junge Frau anders wieder zur Vernunft bringen können?
»Du hast das Richtige getan«, sagte plötzlich eine Stimme hinter ihr. »Mirwat hätte sonst dem ganzen Palast erzählt, du seist eine Hexe.«
Überrascht dreht sich Beatrice um und sah Sekireh vor sich stehen.
»Hast du alles mit angehört?«
»Nun, nicht alles, aber genug, um zu erfahren, worum es ging. Mirwat war nicht besonders leise.«
Beatrice seufzte. Vermutlich hatten dann noch andere ihren Streit mitgekriegt, und spätestens morgen früh würde der ganze Palast davon wissen.
»Doch ich kam nicht, um euch zu belauschen«, fuhr Sekireh fort und ließ sich neben Beatrice auf der Bank nieder. »Das war nur Zufall. Ich habe dich gesucht.«
»Wie geht es dir? Sind die Schmerzen schlimmer geworden?«
»Nein«, antwortete Sekireh und stützte die Hände auf ihren Stock. »Es ist seltsam. Seitdem ich weiß, dass ich sterben muss, habe ich weniger Schmerzen. Es ist, als ob die Gewissheit dem Leid seinen Stachel nimmt. Meine Tage sind zwar gezählt, aber ich habe noch genügend Zeit, meine Angelegenheiten zu regeln.« Sie lachte auf. »Mirwat ist entsetzlich dumm. Aber ich kam, um dir etwas zu sagen. Du solltest zu Samira gehen.«
»Samira?«, fragte Beatrice erstaunt. Im ganzen Palast hatte sie noch niemanden dieses Namens kennen gelernt. »Wer ist Samira?«
»Oh, Samira ist das, was Mirwat ohne Zweifel als Hexe bezeichnen würde«, antwortete Sekireh lächelnd. »Sie ist eine Heilkundige und Seherin. Samira wohnt in einem entlegenen Viertel in Buchara. Ich suche sie hin und wieder auf, um mir ihren Rat zu holen. Wenn du möchtest, kann Hannah dich zu ihr führen.«
»Und was soll ich dort?«, fragte Beatrice verständnislos.
»Ich weiß so gut wie nichts über dich, Beatrice, und ich will auch gar nichts wissen. Aber eines ist mir von dem Augenblick an klar gewesen, als ich dir zum ersten Mal gegenüberstand. Du gehörst nicht hierher. Du bist eine selbständige, kluge Frau, die sich nicht dazu erniedrigen sollte, von einem fetten, lüsternen Kerl wie Nuh II. Befehle entgegenzunehmen.« Sekireh seufzte. »Er mag zwar mein Sohn sein, dennoch habe ich nicht den Blick für die Wahrheit verloren.« Sie stieß den Stock auf die Erde. »Samira weiß mehr als jeder andere Mensch in Buchara. Sie kennt und sieht Dinge, die anderen verborgen sind. Vielleicht kann sie dir helfen.«
Beatrice zuckte mit den Schultern. Was hatte sie zu verlieren?
»Warum nicht? Schaden kann es nicht.«
Sekireh nickte. »Gut. Ich werde alles Nötige vorbereiten. Wenn es Zeit ist, wirst du es erfahren.«
Sekireh erhob sich ächzend und ging ohne ein weiteres Wort davon. Beatrice sah ihr nach und wusste nicht, ob sie sie bewundern oder bedauern sollte. Wie sie selbst schien auch Sekireh in der falschen Zeit zu leben. Ihrer Einstellung nach war sie eine moderne Frau, die vermutlich mit ihrem Leben etwas anderes angefangen hätte, als Frau des Emirs von Buchara zu werden – wenn sie eine Wahl gehabt hätte. Kein Wunder, dass die Alte verbittert war.
Der Gong, der das Ende der »Stunde der Frauen« ankündigte, hallte durch den Garten und holte Beatrice aus ihren Gedanken. Der Gong wurde dreimal in bestimmten Abständen geschlagen, und bis zum dritten Schlag mussten die Frauen den Garten verlassen haben. Beatrice stand auf. Langsam ging sie zurück zum Palast. Sie hatte es nicht eilig. Sie blickte zum Himmel empor, an dem bereits viele Sterne zu sehen waren. Direkt über dem Palast war ein besonders schönes Sternbild. Beatrice kannte den Namen nicht, aber es war ihr schon oft aufgefallen. Jedes Mal, wenn sie es sah, empfand sie den Anblick als tröstlich. Diesmal schaute sie es sich länger als gewöhnlich an. Der Gong schlug gerade erst zum zweiten Mal, sie hatte also noch etwas Zeit. Versunken in den Anblick, glaubte sie plötzlich in der Anordnung der Sterne die Form eines Auges zu erkennen. Sie hatte plötzlich die Gewissheit, dass sich eine weitere Wende in ihrem Leben anbahnte. Wer auch immer da oben war, er würde sie nicht im Stich lassen.
»Komm in den Palast, es ist Zeit.«
Jussufs Stimme riss sie aus ihren Gedanken. Lautlos und dunkel wie ein Schatten war der schwarze Eunuch plötzlich hinter ihr aufgetaucht. Beatrice hatte ihn nicht bemerkt, bis er direkt vor ihr stand.
»Ja, ich komme«, sagte sie. Beatrice wusste, dass Jussuf sie nicht eine Sekunde aus den Augen lassen würde, bis sich die Tür des Harems hinter ihr geschlossen hatte. Der Eunuch versah seine Aufgabe überaus gewissenhaft.
Gerade als Beatrice die Tür erreicht hatte, schlug der Gong zum dritten Mal. Auf der Treppe drehte sie sich noch einmal um und sah zu dem Sternbild zurück. Das Auge stand groß und strahlend über ihr.