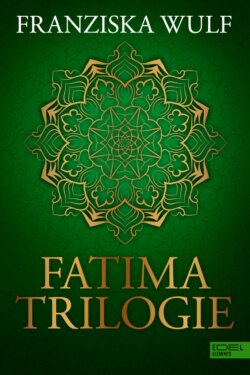Читать книгу Fatima Trilogie Gesamtausgabe - Franziska Wulf - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
X
ОглавлениеDer Friede Allahs sei mit Euch, verehrte Dame. Es freut mich, Euch persönlich kennen zu lernen.« Der Mann verbeugte sich höflich vor Mirwat, geleitete sie zu einem der bequemen Sitzpolster und nahm dann ihr gegenüber Platz. »Womit kann ich Euch dienen?«
Der Raum war behaglich und luxuriös ausgestattet und der Mann vor ihr hatte gute Manieren. Dennoch fielen Mirwat lauter unangenehme Dinge ein, die ihr hier, weitab vom Palast in einem verrufenen Viertel von Buchara zustoßen konnten. Unwillkürlich zog sie ihren Schleier fester um sich. Sie fragte sich, ob ihre Entscheidung richtig gewesen war. Nicht die Entscheidung, mehr über Beatrice und ihre dunklen Machenschaften herauszufinden. An diesem Entschluss hatte sie nicht die geringsten Zweifel, und jetzt schon gar nicht, nachdem diese Hexe aus dem Norden es gewagt hatte, ihren geliebten Mann so schwer zu verletzen. Aber hatte sie sich wirklich an einen Verbrecher wenden müssen? Konnte sie nicht auch auf andere Weise erfahren, was Beatrice bei Samira gewollt hatte? Der Kerl mit dem freundlichen Lächeln war ein Schurke. Er gefiel ihr überhaupt nicht. Daran konnten auch Reichtum und gutes Benehmen nichts ändern.
»Nun? Wollt Ihr mir nicht sagen, was Euch zu mir führt?«, forderte er sie nochmals auf.
»Ich weiß nicht ...«, begann Mirwat unschlüssig. Dann kam ihr ein Gedanke. War sie nicht die Lieblingsfrau des Emirs? Hörten nicht ungezählte Diener auf ihre Befehle? Was also sollte ihr ein dahergelaufener Betrüger und Dieb schon anhaben können? Trotzig hob sie ihr Kinn. Sie ließ sich nicht so schnell einschüchtern. »Kennst du Samira?«, fragte sie. Der Mann neigte leicht den Kopf. »Gut. Vor kurzem hat eine Frau, ihr Name ist Beatrice, Samira aufgesucht. Ich will wissen, was sie von ihr wollte. Um jeden Preis!«
Ein anzügliches Lächeln glitt über das Gesicht des Mannes. »So. Das wird Euch aber einiges kosten, verehrte Dame.«
»Glaubst du, das wird reichen?« Mirwat warf ihm einen Beutel zu.
Geschickt fing er ihn auf und ließ die goldenen Münzen auf seine Hand gleiten. Ein gieriges Funkeln trat in seine dunklen Augen, und Mirwat hatte den Verdacht, dass auch die Hälfte genug gewesen wäre. Aber das war unerheblich. Schließlich war für die Sicherheit ihres geliebten Gemahls keine Summe zu hoch.
»Seid gewiss, dass ich meinen zuverlässigsten Mann mit Eurem Auftrag betrauen werde«, sagte er und verbeugte sich lächelnd. »Ihr werdet zufrieden sein. Ich verspreche Euch, dass Ihr schon in wenigen Tagen alles erfahren werdet, was Ihr wissen wollt.«
»Ich erwarte deine Nachricht«, entgegnete Mirwat und erhob sich.
Sie ließ sich nach draußen geleiten, wo Nirman auf sie wartete. Auf verschlungenen Wegen kehrten die beiden Frauen zum Palast zurück.
Um Beatrice herum herrschte Dunkelheit. Es war so finster, dass sie nicht einmal ihre eigene Hand sehen konnte, wenn sie sie dicht vor die Augen hielt. Wie lange war sie schon hier eingesperrt ohne jeglichen Kontakt zur Außenwelt – zwei Tage, zwei Wochen oder gar zwei Monate? Natürlich waren solche Überlegungen Unsinn. Bevor Jussuf sie in diesem finsteren Loch eingeschlossen hatte, hatte er ihr gesagt, dass ihre Haft nur zehn Tage dauern sollte. Nur zehn Tage! Anfangs hatte sie geglaubt, dass sie diese Zeit spielend hinter sich bringen würde, dass sie es diesem widerlichen, fetten Kerl schon zeigen wollte. Er würde sie mit derart hinterhältigen, menschenverachtenden Methoden nicht kleinkriegen können. Denn was waren schon zehn lächerliche Tage? Früher waren zehn Tage wie im Flug vergangen. Beatrice hatte beschlossen diese Tage sogar zu genießen, sie als eine Art Urlaub vom Haremsalltag anzusehen. Zehn Tage, in denen sie endlich einmal allein war, ohne Diener, die sich aufdrängten und ihr selbst die kleinsten Arbeiten abnahmen; ohne die anderen Frauen und ihre seichten Gespräche, die sich immer nur um die gleichen Themen drehten; ohne die allgegenwärtigen Eunuchen, die sie auf Schritt und Tritt begleiteten. Doch trotz ihres festen Vorsatzes hatte sie schnell jedes Zeitgefühl verloren, und schon bald begann sie die anderen Frauen zu vermissen und sich zu langweilen. Außerdem merkte sie schnell, dass der Mensch nicht für die Dunkelheit geschaffen war. Diese undurchdringliche Finsternis, der sie hilflos ausgeliefert war, machte ihr Angst. Gewissenhaft zählte Beatrice die Mahlzeiten. Achtmal hatte sie bisher eine Schüssel mit gekochter Hirse und einen Becher Wasser erhalten. Aber wie viele Mahlzeiten wurden ihr täglich gebracht? Fünf? Drei? Oder vielleicht nur eine? Eine innere Stimme sagte ihr, dass sie vermutlich erst drei Tage im Kerker saß. Immer wieder rief sie sich Jussufs Worte ins Gedächtnis. »Zehn Tage lang wirst du eingesperrt. Du wirst jeden Tag genügend zu essen bekommen, und nach zehn Tagen werde ich dich wieder hinauslassen.«
Aber wie sollte sie diese zehn Tage durchstehen, wenn sie schon jetzt halb verrückt vor Angst und Einsamkeit wurde? Beatrice begann sich Sorgen zu machen. Sie war nicht sicher, ob sie sich wirklich hundertprozentig auf die Worte des Eunuchen verlassen konnte. Was wurde aus ihr, wenn Jussuf wegen einer Laune des Emirs mittlerweile ebenfalls im Gefängnis saß? Wenn Nuh II. selbst von seinen politischen Gegnern gestürzt wurde und sich niemand mehr darum scherte, dass der ehemalige Herrscher noch kurz vor seinem Ende eine Frau aus seinem Harem in den Kerker hatte sperren lassen? Oder wenn man sie ganz einfach hier unten vergaß?
Solche Dinge konnten passieren. Sie hatte einmal in einer Zeitschrift von einem Mann gelesen, der in einem österreichischen Dorfgefängnis mehrere Tage vergessen worden war. Als man sich endlich wieder an ihn erinnerte, war der junge Mann halb tot und verrückt vor Hunger und Durst. Und das war im 20. Jahrhundert passiert, im Zeitalter der Kredit- und Telefonkarten, zu einer Zeit, in der man nicht einmal mehr Brötchen beim Bäcker kaufen oder seine Patentante anrufen konnte, ohne dass irgendeine Bank oder ein Konzern davon erfuhr. Wenn so etwas in einer Zeit der ständigen Erreichbarkeit geschehen konnte, wie viel größer war da die Gefahr, dass man im Mittelalter einfach vergessen wurde. Ein Menschenleben zählte nicht viel, wenn es sich nicht gerade um den Emir selbst oder ein anderes Mitglied des Adels handelte. Sie, Beatrice, war von diesem privilegierten Status so weit entfernt wie der Mond von der Erde. Sie war eine Sklavin und somit weniger wert als ein Pferd aus dem Stall des Emirs. Sie war ein Gegenstand, Eigentum – da gab es keine Trauer und schon gar keine Schuldgefühle. Beatrices Herzschlag beschleunigte sich. Hoffentlich wurden hier im Kerker Listen über die Gefangenen und die Belegung der Zellen geführt. Dann gab es nämlich wenigstens die Chance, dass irgendjemand eines Tages ihren Namen lesen und sich an sie erinnern würde. Falls nicht ...
»Hör endlich auf damit, du dumme Gans!«, schalt Beatrice sich selbst. »Du machst dich nur verrückt. Es wird schon alles gut gehen. Und zehn Tage sind schließlich keine Ewigkeit!« Aber darin täuschte sie sich. Zehn Tage wurden schnell zu einer Ewigkeit, wenn man allein im Dunkeln saß und in dieser absoluten Stille nichts anderes hörte als das Klopfen des eigenen Herzens, die eigenen Atemzüge und das Rauschen des Bluts in den Ohren, wenn das Rascheln der eigenen Kleidung zu einem Geräusch anschwoll, das dem Motorenlärm eines Lastwagens nahe kam. Dann spürte man, wie sich Minuten, ja sogar Sekunden ausdehnten und sich zu einer monströsen Dauer aufblähten, die ihnen überhaupt nicht zustand. Und mit jeder verstrichenen Minute schlich der Wahnsinn auf leisen Sohlen näher, bis man schließlich seinen kalten, grausamen Atem im Nacken fühlte.
Beatrice begann ihre Gedanken laut auszusprechen und regelmäßig Selbstgespräche zu führen. Anfangs fand sie es merkwürdig, ihre eigene Stimme in der Dunkelheit zu hören, aber der Klang beruhigte sie wenigstens ein bisschen. Solange sie noch zu sprechen in der Lage war, konnte sie auch notfalls schreien, und dann würde man sie hören – irgendwann. So dick konnten die Mauern gar nicht sein. Das Wichtigste war, bei vollem Verstand zu bleiben und sich nicht in eine Panik hineinzusteigern.
Samira saß auf ihrem aus Kissen errichteten Thron und döste ein wenig. Draußen auf den staubigen Straßen der Stadt herrschte eine mörderische Hitze. Auch hier, im Inneren des Hauses, war es warm und stickig, obwohl alle Fenster mit dicken Teppichen verhangen waren.
Das liegt an dem kaputten Dach, dachte Samira bei sich und verscheuchte träge eine Fliege, die sich auf ihrem Handrücken niedergelassen hatte. Die Sonne brennt im Sommer unbarmherzig auf uns herab, und im Winter kriecht dafür die Kälte durch jede Ritze ins Haus. Ich sollte das Dach reparieren lassen.
Sie döste wieder ein, und ihr Kopf sackte auf ihre Brust, als sie plötzlich ein Geräusch hörte. Schritte, schnelle, schwere Schritte. Mahtab war es nicht. Den ruhigen, etwas schwerfälligen Gang ihrer Tochter kannte sie gut. Aber wer konnte das sein? Wer würde sie in der größten Mittagshitze aufsuchen wollen? Und warum hatte Mahtab den Besucher nicht von ihr fern gehalten? Sie wollte nicht gestört werden. Unwillig öffnete sie die Augen. Im nächsten Moment presste sie die Hand auf den Mund. Ihr Magen hob und senkte sich bedenklich. Sie keuchte. Entsetzen, Trauer, Zorn wechselten in rascher Folge einander ab.
An der Türschwelle stand ein dunkel gekleideter Mann. Er hatte sein Gesicht verhüllt, wie es Reisende zu tun pflegen, wenn sie die Wüste durchqueren. In seiner rechten Hand hielt er einen langen, breiten Dolch. Blut. Frisches rotes Blut tropfte von der Klinge. Mit der Linken hielt er Mahtabs blutigen Schopf gepackt. Mit weit aufgerissenen Augen starrte sie ihre Mutter an, als würde sie selbst im Tod noch Hilfe von ihr erhoffen.
»Sie weigerte sich, mich zu dir zu lassen«, sagte der Kerl, als wollte er sich für den grausamen Mord bei ihr entschuldigen, und warf Samira den Kopf vor die Füße. »Ich hoffe, dass du klüger bist.«
Samira schluckte mehrmals und kämpfte gegen die Ohnmacht an. Mahtab! Ihre Tochter! Dieser gemeine Mörder hatte ihre einzige, ihre geliebte Tochter umgebracht. Warum nur hatte sie sie nicht schreien hören? Warum hatte sie nicht geahnt, was geschehen würde?
Allah, warum hast Du mich mit der Gabe des Sehens ausgestattet, wenn ich noch nicht einmal mein eigenes Kind retten kann?
Sie wollte schreien, ihre Trauer, ihren Schmerz hinausschreien. Doch dann fiel ihr ein, dass er noch da war. Mahtabs Mörder befand sich noch hier im Raum. Er sah ihr zu, weidete sich an ihrem Schmerz. Und es packte sie der Zorn.
»Was willst du?«, fragte sie barsch, als sie sich wieder unter Kontrolle hatte.
Langsam kam der Mann näher. Mit jedem Schritt stieß er Statuen um, zertrat Kerzen und Körbe und riss Kräuter von der Decke. Aber Samira achtete kaum darauf. Sie würde das alles nicht mehr brauchen. Sie wusste jetzt, dass sie heute sterben würde.
»Ich möchte dir ein paar Fragen stellen«, sagte der Mörder.
Seiner Stimme war deutlich anzuhören, dass er seine Aufgabe genoss: »Vor einigen Tagen war eine Frau bei dir, eine Ungläubige aus dem Norden mit goldenen Haaren. Was wollte sie?«
»Das wirst du von mir nicht erfahren«, antwortete Samira mit fester Stimme. Gleichzeitig überlegte sie, ob es etwas gab, für das sie Allah um Verzeihung bitten musste. Sie würde nicht mehr lange die Gelegenheit dazu haben.
»So, bist du dir dessen sicher?«, erwiderte er und kam so dicht an sie heran, dass sie ihn fast berühren konnte. Der Dolch funkelte vor ihren Augen. »Denk an diese törichte Frau. Was glaubst du werde ich mit dir machen, wenn du mir meine Fragen nicht beantwortest?«
Samira blickte ihm in die Augen – dunkle, grausame Augen, deren Kälte sie erschauern ließ. Aber sie sah noch etwas anderes in ihnen. Sie sah das Gesicht einer Frau. Sie kannte dieses schöne, ebenmäßige Gesicht. Wie oft hatte diese Frau sie aufgesucht? Wie oft hatte sie ihr mit ihrem Rat geholfen? Und nun schickte ihr dieses Weib einen Mörder? Samira spürte den Zorn in sich brennen.
Nein, du sollst nicht davonkommen!, dachte sie grimmig. Die Strafe Allahs soll dich treffen – und deinen gedungenen Mörder auch!
»Das ist mir gleich«, antwortete sie und lächelte. Sie hatte ein erfülltes Leben gelebt. Viele Menschen hatten sie in ihrer Verzweiflung aufgesucht, und fast jedem hatte sie helfen oder doch wenigstens Trost spenden können. Es gab nichts, das sie bereuen musste. »Du wirst nichts von mir erfahren.«
Ein fürchterlicher Schmerz durchzuckte Samira, als der Eindringling ihr ohne Vorwarnung den rechten Daumen abschnitt.
»Willst du es dir nicht doch lieber überlegen?«
»Nein!«
Samira verlor auch den linken Daumen.
»Ich weiß, wer dir den Auftrag gab!«, stieß sie unter Schmerzen hervor. »Verflucht soll sie sein! Möge Allah ihr die Schönheit rauben und Missgunst und Neid ihr Gesicht zeichnen. Ihr Herz und ihr Antlitz sollen vertrocknen, und ihr Schoß soll unfruchtbar bleiben.« Dann sah sie ihn an, den Mörder ihrer Tochter. Und zum ersten Mal bemerkte sie so etwas wie Unsicherheit und Angst in seinen dunklen Augen flackern. »Jetzt zu dir. Ich verfluche dich, Malek al-Omar! Nie wirst du in deinem jämmerlichen Leben das erreichen, was du dir vorgenommen hast. Schon bald werden die Krähen dir die Augen auspicken, und deine Seele wird in den Feuern der Hölle verbrennen.«
Mit einem wütenden Aufschrei stürzte sich der Mann auf Samira. Das Messer zuckte wild durch die Luft. Aber sosehr er auch schrie und tobte, sie sagte kein Wort mehr.
Zwischen der fünfzehnten und der zwanzigsten Mahlzeit begann Beatrice damit, Gedichte aufzusagen, die sie im Laufe ihrer Schulzeit gelernt hatte; sie sang alle Lieder, die sie kannte, angefangen von deutschen Volksliedern, Kinderliedern und Schlagern bis hin zu Popsongs, und wenn ihr die Texte nicht mehr einfielen, dachte sie sich neue aus. Um nicht steif zu werden, machte sie Kniebeugen und Liegestütze und Übungen, an die sie sich noch vage aus Frauenzeitschriften erinnerte. Sie rekapitulierte sogar ihr gesamtes chirurgisches Wissen, malte sich alle Operationen aus, die zum Weiterbildungskatalog der Chirurgen gehören, und spielte sie vom ersten Schnitt bis zur Naht Schritt für Schritt durch. Dabei redete sie laut mit imaginären Kollegen und ahmte sogar deren Stimmen nach. Manchmal befürchtete sie, die Grenze zum Wahnsinn endgültig überschritten zu haben. Aber wenn sie schließlich psychisch erschöpft und müde auf dem harten, kühlen Steinboden lag, um ein wenig zu schlafen, und die Stille sie wieder umgab, ahnte sie, dass ihre Zwiegespräche das schmale Band waren, das sie noch vom Irrsinn trennte.
Beatrice schlief schlecht und träumte wirres Zeug vom Stein der Fatima und Samiras Prophezeiungen. Der Emir, mal in OP-Kleidung, mal mit dem Gesicht ihres Chefs ausgestattet, jagte sie kreuz und quer durch den Palast. Dabei war es ihm leicht, die Verfolgung aufzunehmen, da sie mit schweren Eisenketten an den Fußgelenken gefesselt war und nur langsam vorankam. Wenn er es dann endlich geschafft hatte, sie einzuholen, brachte er sie brutal zu Fall und stürzte sich auf sie. Geifer lief aus seinen Mundwinkeln herab und tropfte ihr ins Gesicht, während er ihr die Kleider vom Leib riss. Meistens wachte sie dann schweißgebadet und vor Kälte zitternd mit schmerzenden Gliedern wieder auf. Sie verfluchte Nuh II. ibn Mansur und wünschte ihm die Pest an den Hals. Sollte er doch jämmerlich an irgendeiner widerlichen Infektion zu Grunde gehen. In ihrem Zorn und ihrer Verzweiflung warf sie ihre hölzerne Schüssel gegen die Wand und schlug so lange gegen die eiserne Klappe in der Tür, bis sie den Schmerz schließlich nicht mehr spürte und ihre Fäuste taub waren. Erschöpft zog sie sich in eine Ecke zurück, fuhr sich durchs Haar und wischte sich die Tränen von den Wangen. Aber wozu tat sie das? Es konnte ohnehin niemand sehen, wie sie ausschaute. Da merkte sie, dass etwas Warmes und Klebriges ihre Unterarme hinablief – Blut! Sie musste sich bei ihrem Wutanfall verletzt haben. Entsetzt untersuchte sie ihre Handrücken und stellte fest, dass sie an beiden Händen tiefe Schnitte hatte und dass die Knöchel stark angeschwollen waren. Sie hatte zwar keine Schmerzen, da ihre Hände von der Wucht ihrer Schläge immer noch taub waren, aber eine Fraktur war nicht auszuschließen. Außerdem hatte sie sich seit Tagen nicht mehr waschen können, und die kleine Zelle stank nach Urin und Kot. Diese Wunden an ihren Händen konnten sich leicht infizieren. Horrorvisionen von ihrem bevorstehenden Tod traten ihr vor Augen. Sie würde eine Blutvergiftung bekommen und im Fieber sterben; oder der Wundbrand würde ihr die Hände wegfressen, und unter fürchterlichen Schmerzen würde sie jämmerlich krepieren; oder eine Tetanusinfektion würde zu so schweren Krämpfen der Rückenmuskulatur führen, dass sie ihr die Wirbelsäule brachen. Selbst wenn Jussuf tatsächlich nach Ablauf von zehn Tagen zurückkehrte, um sie wieder herauszulassen, würde es ihr wahrscheinlich nichts mehr nützen – sie war dann schon nicht mehr am Leben.
Beatrice begann laut zu schluchzen. Tränen liefen in Strömen über ihr Gesicht, ihr Körper bebte und zitterte. Sie weinte so sehr, dass sie sich fast übergeben musste. Hustend und würgend warf sie sich auf den Boden. Sie würde sterben, da war sie sich ganz sicher. Dies war das Ende. Warum nur hatte sie nicht eher an die Folgen gedacht, weshalb war ihr das nicht eingefallen, bevor sie in sinnloser Wut ihre Fäuste an der Eisenklappe zertrümmert hatte? Beatrice, die immer gedacht hatte, keine Angst vor dem Tod zu haben, musste sich jetzt eingestehen, dass sie sich selbst belogen hatte. Sie hatte Angst vor dem Tod, es war sogar eine infernalische Angst. Sie hatte nur bisher trotz ihres Berufs und dem ständigen Kontakt mit Sterbenden nie wirklich über ihren eigenen Tod nachgedacht.
Beatrice ertappte sich dabei, wie sie ihre geschwollenen Hände faltete und betete. Sie flehte Gott um ihr Leben an und fiel schließlich in einen tiefen, traumlosen Schlaf. Als sie wieder erwachte, fühlte sie sich müde und zerschlagen. Aber wie durch ein Wunder hatten sich ihre verletzten Hände nicht infiziert. Sie hatte zwar erhebliche Schmerzen und konnte die Finger kaum bewegen, aber sie hatte anscheinend keine Knochenbrüche erlitten. Vielleicht hatte Gott ihre Gebete tatsächlich erhört. Sie schickte ein Dankgebet zum Himmel. Trotzdem verwendete Beatrice die Hälfte ihrer Wasserration für die Reinigung der Wunden, um nicht doch noch eine Infektion zu riskieren. Einmal war alles gut gegangen. Man sollte sein Glück, seinen Schutzengel oder was auch immer nicht zu oft herausfordern. Danach legte sie sich wieder hin. Abgesehen von einer notdürftigen Reinigung war Schlaf das Einzige, was sie in diesem Drecksloch für eine Heilung tun konnte.
Ali wartete. Er stand in einem Raum, den er wegen der Kapuze auf seinem Kopf nicht sehen konnte, und wartete darauf, endlich zu Saddin vorgelassen zu werden. Es war nicht das erste Mal, dass er den Nomaden aufsuchte. Aber es war das erste Mal, dass dieser seine Verabredung nicht einhielt. Sein Begleiter, dessen Anwesenheit Ali normalerweise nur erahnen konnte, schien auch schon nervös zu werden. Ali hörte, wie er unruhig auf und ab ging und hin und wieder seufzte. Was war los?
Endlich öffnete sich vor ihm eine Tür. Ein Mann stolperte an Ali vorbei.
»Drei Tage! Drei lächerliche Tage!«, jammerte er laut mit einer Stimme, die Ali bekannt vorkam. »Wie soll ich nur diese Frist einhalten? Noch nicht einmal ich weiß ja, wo der Kerl sich versteckt. O Allah, was soll ich nur tun?« Das Jammern und Stöhnen entfernte sich langsam, und eine kräftige Hand schob Ali vorwärts. Was mochte jener arme Kerl mit Saddin besprochen haben?
»Seid gegrüßt, Ali al-Hussein«, erklang endlich Saddins Stimme. »Nehmt die Kapuze ab.«
Ali löste die Schnüre an seinem Hals. Er war nicht wenig erstaunt, als er den Nomaden nicht wie üblich lässig auf einem der bequemen Polster sitzen sah. Er stand am Fenster und blickte hinaus. Dabei umklammerten seine Hände den Fensterrahmen, dass die Knöchel weiß hervortraten. Ali hörte, wie er die Luft zwischen den Zähnen ausstieß. Dann wandte sich Saddin zu ihm um.
»Verzeiht meine Unhöflichkeit, verehrter Ali al-Hussein«, sagte er, und ein gequältes Lächeln huschte über sein Gesicht. »Ich hasse es, meine Klienten warten zu lassen, aber ich musste vorerst eine überaus wichtige Angelegenheit regeln.«
»Nun, das ist nicht so schlimm«, erwiderte Ali leichthin. So zornig hatte er den Nomaden nie zuvor gesehen.
»Doch, das ist es leider«, erklärte Saddin. »Es ist nicht meine Art. Ich bitte Euch nochmals um Vergebung. Macht es Euch bequem. Darf ich Euch eine Erfrischung anbieten?«
An seinen Schläfen arbeiteten die Muskeln, und Ali hatte den Eindruck, dass sich der Nomade nur mit Mühe beherrschen konnte. Er sah aus, als hätte er am liebsten die Schale mit den reifen Pfirsichen quer durch den Raum geschleudert.
»Was führt Euch zu mir, verehrter Ali al-Hussein?«, fragte Saddin höflich.
»Ich weiß nicht, ob ich dich damit jetzt behelligen soll. Es scheint im Augenblick Wichtigeres zu geben.«
»Macht Euch keine Sorgen. Die Tatsache, dass sich einer meiner Geschäftspartner nicht an unsere Abmachungen gehalten hat, berührt in keiner Weise Eure Wünsche. Abgesehen davon«, seine Augen verengten sich zu schmalen Schlitzen, und ein grimmiges Lächeln huschte über sein Gesicht, »wird diese Angelegenheit in drei Tagen geregelt sein – so oder so.«
Ali nickte. Das war also die Frist, von der der andere Mann gesprochen hatte. Er war froh, dass nicht er den Zorn des Nomaden auf sich geladen hatte. »Ich habe mir die Sache noch einmal überlegt«, sagte Ali. »Ich will nicht mehr länger warten. Ich möchte doch schon in diesem Jahr Buchara verlassen.« Saddin hob überrascht eine Augenbraue. Verlegen fuhr Ali sich durchs Haar. »Ich weiß, anfänglich sprach ich von einem längeren Zeitraum. Ich hatte noch eine Menge vor. Die Bibliothek hier birgt noch viele Schätze, die es zu entdecken gibt. Aber mittlerweile sind die Launen des Emirs unerträglich geworden. Ich bin wahrlich kein herzloser Mann. Ich weiß um die Leiden und Schmerzen meiner Patienten. Unter normalen Umständen habe ich Geduld. Es macht mir nichts aus, schreiende Kinder zu trösten, ich habe Erfahrung, Männer mit Verletzungen zu beruhigen, aber dem jammernden, wehleidigen Emir bin ich nicht mehr gewachsen. Die letzten Tage waren die Hölle.« Er machte eine Pause. »Ich will nach Bagdad.«
Saddin lächelte verständnisvoll. »Ich kann mir vorstellen, welche Qual es ist, diesem Mann zu dienen. Ich spiele hin und wieder Schach mit ihm. Er lädt mich in den Palast und klagt dann über die mangelnden Schachkenntnisse des Großwesirs.« Er seufzte.
»Dabei weiß er gar nicht, wie schwer es mir manchmal fällt, nicht gegen ihn zu verlieren.«
Er sah Ali an, und sie mussten beide lachen. Und plötzlich herrschte eine fast freundschaftliche Atmosphäre im Raum.
»Aber um zu Eurem Wunsch zurückzukommen, ich weiß nicht...«, fuhr Saddin fort und runzelte nachdenklich die Stirn. »Ich kann Euch nicht versprechen, dass es mir gelingen wird, Euch noch in diesem Jahr unbemerkt aus Buchara fortzubringen. Nach meinen Informationen wird hier in den nächsten Wochen und Monaten keine Karawane mehr vorbeikommen. Natürlich könnte ich Euch bei den Hirten verbergen, aber das würde bedeuten, dass Ihr einen Großteil Eures Besitzes und Gefolges in Buchara zurücklassen müsstet. Und wenn ich Euch richtig verstanden habe, so liegt Euch gerade daran, dass Ihr Euren Besitz mitnehmen könnt.«
Ali nickte unglücklich. Seine Möbel und Teppiche waren ihm egal. Die hätte er ohne auch nur mit der Wimper zu zucken zurückgelassen. Aber ohne seine Bücher und sein geliebtes Fernrohr? Sosehr er sich über die Launen und die Wehleidigkeit des Emirs ärgerte – das war die Sache nicht wert.
»Ja«, sagte er und nickte. »Dann warte ich lieber bis zum nächsten Jahr. Ohne meine Bücher ...«
»Das dachte ich mir«, unterbrach ihn Saddin lächelnd. »Aber lasst den Kopf nicht hängen. Mir wird schon etwas einfallen, um Euer Problem zu lösen. Ich werde mich zuerst erkundigen, ob nicht doch eine Karawane auf dem Weg hierher ist. Vielleicht lässt sich auch ein Karawanenführer zu einer geringfügigen Änderung seiner Route überreden. Sobald ich mehr weiß, gebe ich Euch Nachricht.«
Ali erhob sich. Gerade als er sich wieder die Kapuze überstülpen wollte, fiel sein Blick auf einen Gegenstand, der mitten auf einem der Teppiche lag. Er bückte sich. Es war ein kurzer Dolch mit breiter Klinge. Besonders auffällig war der Griff. Eine fette silberne Schlange wand sich darum. Dieses hässliche Ding kam ihm bekannt vor. Aber wo hatte er es schon einmal gesehen? Saddin gehörte der Dolch sicher nicht.
»Hier, das hat offensichtlich jemand verloren«, sagte er und reichte dem Nomaden den Dolch.
Der nahm ihn an sich und betrachtete ihn eine Weile. »Geschmacklos! Der Schmied muss einen schlechten Tag gehabt haben, als er ihn gemacht hat«, sagte er verächtlich. »Ich weiß, wem er gehört. Wenn ich den Mann in drei Tagen sehe, bekommt er sein Eigentum zurück.«
Ali lief ein Schauer über den Rücken. Er ahnte, was Saddin bei seinen Worten im Sinn hatte, und konnte dem armen Kerl nur wünschen, dass er seine Frist einhielt.
Ali verabschiedete sich. Er war schon auf dem Weg nach Hause, als ihm plötzlich einfiel, warum ihm die Stimme des Mannes so bekannt vorgekommen war und wo er diesen hässlichen Dolch schon einmal gesehen hatte. Der verzweifelte, jammernde Mann, dem er bei Saddin begegnet war, war Mustafa ibn Mustafa, der Kopf einer großen und gefürchteten Diebesbande von Buchara. Hin und wieder suchte er Ali auf, wenn einer seiner Schergen sich verletzt hatte. Er war brutal und kaltschnäuzig, ein Mann, der seine Macht über andere genoss. Ihm schien es zu gefallen, wenn andere vor ihm zitterten. Und doch hatte gerade eben dieser Mustafa vor Angst gewimmert.
Das bestätigte den Eindruck, den Ali schon seit längerem von dem Nomaden hatte. Mit einem Mal wusste er gar nicht mehr, was er an Buchara, dem Emir und seinem Amt als dessen Leibarzt auszusetzen hatte. Er konnte doch eigentlich mit seinem Leben überaus zufrieden sein.
Ein kluger, vernünftiger Mann hätte sich in sein Schicksal ergeben. Er hätte den Traum von Bagdad begraben und wäre Saddin aus dem Weg gegangen, dachte Ali. Und ich törichter Narr habe genau das Gegenteil getan.
In Beatrice ging eine Veränderung vor. Sie hörte auf, die Mahlzeiten zu zählen. Sie hatte nicht mehr das Bedürfnis, genau zu wissen, wie lange sie schon hier in dieser Zelle saß. Eine seltsame Ruhe überkam sie.
Sie hatte immer noch genau vor Augen, wie Jussuf sie hierher gebracht hatte. Die Fackel, die er getragen hatte, hatte für kurze Zeit die kleine saubere Zelle ausgeleuchtet, den dunklen, altersgeschwärzten Steinboden, die aus riesigen Quadern gearbeiteten Wände. Dann hatte Jussuf die Tür hinter sich geschlossen. Sie hatte gehört, wie der schwere Riegel vorgeschoben wurde, und gleich darauf war das Licht der Fackel, das immer noch durch einen schmalen Spalt an den Türangeln hindurchschimmerte, wieder davongetragen worden. An diesen Lichtschimmer klammerte sie sich jetzt. Er war ihr Strahl der Hoffnung geworden, die Verbindung zum Leben, der Beweis, dass es außerhalb dieser Finsternis tatsächlich Licht gab. Irgendwann würde dieses Licht zurückkehren und sie wieder hinausführen aus der Dunkelheit. Daran glaubte sie fest.
Beatrice strich vorsichtig über den Steinboden. Ihre Hände taten zwar immer noch weh, aber dieser Schmerz war zu ertragen. Sie fühlte die Unebenheiten unter ihren geschwollenen Fingern. Der Stein war hart und kalt. Und doch hatte das Leid vieler Gefangener ihm seine Spuren aufgedrückt. Das Scharren ungezählter Hände und Füße hatte Kerben auf seiner Oberfläche hinterlassen und sie blank poliert. Wie viele Tränen mochten auf diesem Stein getrocknet sein? Wie viele Männer und Frauen hatten sich wie sie selbst die Fäuste blutig geschlagen? Wie viele Gefangene hatten hier bereits ihren Verstand verloren oder waren, von der Welt dort draußen vergessen, gestorben? Wie oft hatten Menschen in letzter Verzweiflung versucht sich mit bloßen Händen einen Weg nach draußen zu graben – und waren natürlich jämmerlich gescheitert? Beatrice konnte die schmalen Kerben fühlen, sie konnte die Trostlosigkeit spüren, die daraus sprach. Die Menschen, die hier gegraben hatten, hatten um die Sinnlosigkeit gewusst. Dennoch hatten sie es in einem letzten Aufbäumen, einem letzten Aufflackern ihres Lebenswillens versucht.
Jussuf hatte ihr auf dem Weg zu diesem Gefängnis anvertraut, dass die Häftlinge nicht wissen sollten, wie lange ihre Inhaftierung hier im finsteren Keller des Verlieses dauern würde, und gesagt, dass er selbst eine schwere Strafe riskierte, weil er dieses Verbot missachtet hatte. Damals hatte sie das Ausmaß dieser Grausamkeit nicht begriffen, doch jetzt wurde ihr ganz schlecht, wenn sie daran dachte. Wie viel mehr musste die Dunkelheit, die Stille, die Einsamkeit einen Menschen quälen, wenn man nicht wusste, wie lange dieser Zustand andauern sollte? Wenn man keine Frist kannte, an die man sich in seiner Verzweiflung klammern konnte? Wenn man damit rechnete, dass man hier den Rest seines Lebens verbringen musste? Weshalb waren die anderen, deren Spuren sie im Stein fühlen konnte, eingesperrt worden? Hatten auch sie sich gegen die Tyrannen zur Wehr gesetzt, so wie sie? Oder war ihnen diese Strafe wegen noch geringerer Vergehen auferlegt worden? Wie viele von ihnen hatten dieses Gefängnis wieder lebend verlassen, und war es ihnen gelungen, an dieser grausamen Folter nicht zu zerbrechen?
Beatrice wurde übel, sie konnte das Elend nicht mehr ertragen, das aus dem Stein ihrer Zelle sprach. Sie schloss die Augen. In der herrschenden Dunkelheit kaum mehr als ein Akt der Verzweiflung, denn die Bilder der Gefangenen, Projektionen ihrer eigenen Fantasie, ließen sich dadurch nicht bannen. Doch dann tauchte aus den Tiefen ihres Gehirns plötzlich der Stein der Fatima vor ihren Augen auf. Strahlend blau und klar sah sie ihn vor sich, als würde er vor ihr liegen. Sie holte ihn aus der geheimen Tasche ihres Kleides hervor. Warum nur hatte sie nicht schon viel früher an ihn gedacht? Sie schlang ihre Hand um den Stein und schlief ein.
Als Beatrice die Augen wieder aufschlug, sah sie etwas schmales Gelbes auf dem Boden der Zelle. Es dauerte eine Weile, bis sie begriff, dass die schmale Linie dem Spalt der Türangel entsprach. Sie starrte den Streifen an, bis ihre Augen tränten. Bildete sie es sich nur ein, oder wurde er allmählich heller?
»Ruhig, Beatrice, ganz ruhig. Mach dir jetzt keine falschen Hoffnungen«, ermahnte sie sich selbst.
Doch es war zwecklos. Ungeachtet jeder Vernunft begann ihr Herz rasend schnell zu klopfen. Und im selben Augenblick wusste sie, dass sie es wahrscheinlich nicht ertragen würde, wenn dieses Licht nicht für sie bestimmt sein sollte. Sie würde diese Enttäuschung nicht überleben. Unwillkürlich kniete Beatrice nieder und schloss ihre Augen. Atemlos lauschte sie. Und tatsächlich dauerte es nicht lange, bis ihr in der Dunkelheit geschärftes Gehör etwas vernahm, das nicht ihr eigener Herzschlag war, sondern das Geräusch von Schritten, gleichmäßigen, schweren Schritten auf den harten Steinfliesen. Sie kamen immer näher. Und wenn es nur einer der Kerkerdiener war, der ein neues Opfer brachte, eine neue Seele in diese Hölle warf?
O Gott, wie lange dauert es denn noch?, dachte sie und sprach zum ersten Mal seit langer Zeit ihre Gedanken nicht aus. Die Furcht, etwas zu versäumen, ein wichtiges Geräusch zu verpassen, war zu groß. Ich halte diese Ungewissheit nicht länger aus!
Die Schritte näherten sich und wurden immer lauter. Beatrice schlug die Augen auf. Der Türspalt zeichnete sich bereits deutlich als Rechteck vor der Dunkelheit ab, die Helligkeit war unglaublich. Wie eine Träumerin hob sie ihre Hände empor und vermochte kaum zu fassen dass sie sie sehen konnte – wirklich sehen, mit ihren eigenen Augen! Dann erscholl ein ohrenbetäubender Lärm, ein Poltern, Rasseln und Quietschen, das von den Wänden widerhallte, als kündige es die Ankunft eines überirdischen Wesens an. Licht, gleißend helles Licht übergoss Beatrice. Vor Angst und Entsetzen schrie sie auf. Sie schloss ihre Augen und schlug die Hände vors Gesicht, um nicht geblendet zu werden. Trotzdem schmerzten ihre Augen, und grelle Lichtpunkte tanzten hinter ihren Lidern. Doch sie nahm die Gestalt war, die dort im Licht stand und deren Umrisse sich deutlich abzeichneten. Es war die Gestalt eines Engels. Und es war auch die Stimme eines Engels, die dröhnend wie eine Posaune und tröstlich zugleich zu ihr sprach.
»Ich bin gekommen, um dich zu erlösen. Die zehn Tage sind vorüber.«