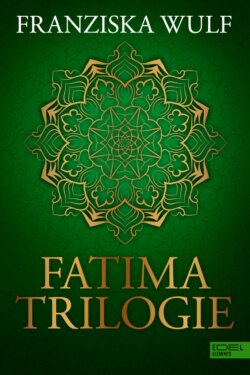Читать книгу Fatima Trilogie Gesamtausgabe - Franziska Wulf - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
XII
ОглавлениеAhmad al-Yahrkun stand im Schlafgemach des Emirs und sah dem korpulenten Herrscher dabei zu, wie er in dem Raum auf und ab lief. Das Gesicht des Emirs war hochrot vor Aufregung, seine Kleidung war zerknittert. Er hatte noch nicht einmal seine Schärpe umgebunden – ein Umstand, den Ahmad in über zwanzig Jahren, seit aus dem etwas kräftigen Jüngling ein fettleibiger Herrscher geworden war, noch nicht erlebt hatte. Ahmad seufzte tief. Eigentlich wäre es seine Aufgabe, beruhigend auf Nuh II. einzuwirken. Aber wie sollte er das tun, wenn in ihm selbst ein Sturm tobte und er sich nur unter äußerster Willensanstrengung beherrschen konnte, nicht gemeinsam mit dem Emir durch das Zimmer zu laufen?
»Beruhigt Euch, Herr«, sagte Ahmad schließlich und hoffte, dass seine Stimme gelassener klang, als er sich fühlte. »Ich bin sicher, dass es sich nur um ein Missverständnis handelt.«
»Ein Missverständnis?«, brüllte Nuh II. los. »Wenn ich eine Frau zu mir ins Schlafgemach holen will und dieses Weib mir, dem Emir von Buchara, ausrichten lässt, sie sei heute nicht in der richtigen Stimmung, so handelt es sich nach meiner Auffassung keinesfalls um ein Missverständnis. Das ist Rebellion!« Er packte eine Kupferkanne und schleuderte sie voller Wut quer durch den Raum. Mit lautem Getöse prallte die Kanne gegen die Wand, verspritzte dort ihren Inhalt und fiel scheppernd zu Boden. »Und es ist nicht nur eine Frau, die plötzlich gegen mich aufbegehrt, es sind fast alle. Weißt du, was Jambala zum Beispiel gestern von mir verlangte? Sie will lesen und schreiben lernen! Jetzt frage ich dich, wozu um alles in der Welt muss eine Sklavin lesen und schreiben können? Kannst du mir das erklären? Dieses Weib soll mir zu Willen sein, aber nicht mir vorlesen!«
Ahmad seufzte und starrte geistesabwesend die hässlichen dunkelbraunen Streifen an, die der Mokka an der weiß getünchten Wand hinterlassen hatte. So bald wie möglich würde er einem Sklaven den Befehl geben, den Schaden zu beheben und die Wand neu zu weißen. Ja, Nuh II. hatte Probleme, wirklich ernste Probleme. Seit zwei Tagen befand sich der ganze Harem in Aufruhr. Die Frauen widersprachen, verlangten Unmögliches. Der Grund für diese Hysterie? Möglicherweise hing es mit der Barbarin zusammen, die den Stein der Fatima besaß. Der Aufruhr hatte nämlich an dem Tag begonnen, als dieses Weib den Kerker wieder verlassen durfte – in Ahmads Augen ein schwerer Fehler, den er gewiss nicht begangen hätte. Aber das war lediglich eine Vermutung, mehr nicht.
»Meine Frauen sind verrückt geworden!«, schrie Nuh II. und raufte sich die Haare. »Sie verlangen nach Rechten! Welche Rechte? Ich weiß nicht einmal, wovon diese Weiber überhaupt sprechen! Sie haben alles, was sie brauchen. Und mehr noch als das. Ich trage die Frauen meines Harems auf Händen, ich überhäufe sie mit kostbaren Geschenken. Oder hast du es etwa schon einmal erlebt, dass ich eine von ihnen schlecht behandelt hätte?«
Ahmad schüttelte den Kopf. Er musste sich konzentrieren und diese Probleme im Harem endlich beseitigen, bevor sie zu einem Aufstand führten, der die ganze Stadt heimsuchte. Aber seine Gedanken schweiften immer wieder ab. Und so sehr er auch versuchte eine Lösung zu finden, er konnte an nichts anderes denken als an den Stein der Fatima. In zehn Tagen war es ihm nicht gelungen, den heiligen Stein zu finden. Während die Barbarin im Kerker saß, hatte er ihr Zimmer bis in den letzten Winkel hinein durchsucht. Er hatte die Truhen und Schatullen durchwühlt, ihre Kleider abgetastet, ja er hatte sogar die Möbel auf den Kopf gestellt und sie nach Geheimfächern abgesucht – alles ohne Erfolg. Der Stein blieb unauffindbar. War es möglich, dass diese blonde Hexe die Bedeutung und Macht des Steines kannte und ihn deshalb immer bei sich trug?
»Ahmad, was soll ich tun? Wie kommen die Weiber wieder zur Vernunft? Ich habe fast den Eindruck, es handelt sich tatsächlich um eine Krankheit, wie viele hier im Palast behaupten. Eine Krankheit, die sich immer mehr ausbreitet. Die Einzige, die von dieser Seuche bisher verschont geblieben zu sein scheint, ist Mirwat. Ich kann doch nicht alle anderen auspeitschen lassen, ohne mich gleichzeitig zum Gespött des Volks zu machen.«
Ja, was war zu tun? Wenn er sich doch nur konzentrieren könnte. Ahmad rieb sich die Stirn. Die Kopfschmerzen hatten an dem Tag begonnen, an dem die Barbarin wieder aus dem Kerker entlassen und ihm klar geworden war, dass es ihm nicht mehr gelingen würde, den heiligen Stein in ihrem Gemach zu finden. Wie sollte er an den Stein herankommen? Und wie sollte er den drohenden Aufstand des Harems verhindern?
O Allah, ich flehe Dich an, betete er im Stillen. In Deiner großen Güte und Barmherzigkeit, hilf Deinem Diener, zeige ihm den richtigen Weg!
»Ahmad, ich rede mit dir!«, rief Nuh II. aufgebracht und packte ihn am Arm. »Hörst du mir überhaupt zu? Ein einziges Mal brauche ich deine Hilfe wirklich, und du bist mit deinen Gedanken ganz woanders!« Der Emir stampfte mit dem Fuß auf. »Jeder lässt mich im Stich. Nicht einmal Samira kann ich fragen, da sich dieses törichte Weib ausgerechnet jetzt umbringen lassen musste.«
»Verzeiht, Herr«, murmelte Ahmad und hoffte, dass der Emir ihm sein schlechtes Gewissen nicht anmerkte. Nuh II. hatte Recht, selten hatte er in solchen Schwierigkeiten gesteckt. Und Samiras grausamer Tod trug nicht gerade dazu bei, die Lage zu verbessern. Im Gegenteil. Zum Glück wussten die Frauen im Harem noch nichts davon, dass man ihre Ratgeberin mit ausgestochenen Augen und durchgeschnittener Kehle in einem verfallenen Gewölbe aufgefunden hatte. Und ausgerechnet jetzt konnte Ahmad dem Emir überhaupt nicht dienen.
O Allah, bitte, ich brauche einen Ausweg.
»Herr, ich denke, wir müssen ...«
Noch während er sprach, kam ihm eine Idee. War es möglich, dass die Barbarin den Stein der Fatima gar nicht mehr in ihrem Besitz hatte? Dass sie ihn Samira zur Aufbewahrung gegeben hatte? Aber dann ...
Ahmad wurde abwechselnd heiß und kalt, während er versuchte die Geschehnisse zu rekonstruieren. Saddin hatte die Barbarin bei der Wahrsagerin beobachtet. Selbst wenn er die Bedeutung des heiligen Steins nicht kannte, so hatte er dennoch gesehen, dass es sich um einen Saphir handelte, einen außergewöhnlich schönen Saphir sogar. Der Nomade war ein gewissenloser Dieb, ein skrupelloser Hehler, und er war klug. Nach dem Gespräch mit Ahmad musste ihm klar geworden sein, dass der Stein noch weitaus kostbarer war, als er angenommen hatte. Der Nomade war wieder zu Samira zurückgeschlichen, um ihr den Stein abzunehmen. Und als sie ihn nicht herausrücken wollte, hatte er die Alte kaltblütig ermordet. Ahmad wischte sich den Schweiß von der Stirn. Ja, genau so musste es gewesen sein. Was aber hatte Saddin mit dem Stein vor? Hatte er ihn möglicherweise gestohlen, um ihn zu verkaufen? Wenn er nun den Falschen in die Hände geriet? Saddin unterhielt sicherlich auch Kontakte zu den Diebesbanden und Schurken der Stadt. Die wären bestimmt bereit, erhebliche Summen zu zahlen. Aber was würden solche Menschen mit diesem für die Gläubigen unendlich wertvollen Stein, mit dieser heiligen Reliquie anstellen?
Ahmad lief es eiskalt den Rücken hinunter, sein Magen schlug Purzelbäume. Er musste zu Saddin, er musste mit ihm reden, sofort. Er konnte nicht erst eine Taube losschicken und auf die Antwort warten. Er musste zu ihm, auf der Stelle. Es galt, ein Sakrileg zu verhindern.
»Ahmad!«, rief Nuh II. und schüttelte ihn grob. »Was ist mit dir los?«
Erst jetzt fiel Ahmad auf, dass Nuh II. ihn bei den Schultern gepackt hielt.
»Nicht jetzt!«, stieß er ungewohnt heftig hervor und befreite sich aus dem Griff des Emirs.
Sichtlich erschrocken wich Nuh II. einen Schritt zurück. »Ahmad, was ...?«
»Verzeiht, Herr«, stammelte Ahmad. Ihm war sein ungehöriges Benehmen durchaus bewusst, aber er konnte nicht anders. Was waren Nuhs Schwierigkeiten mit dem Harem schon im Vergleich zu der Gefahr, die dem Stein der Fatima und somit allen Gläubigen drohte? »Ich kann jetzt nicht ...«
Fassungslos starrte ihn der Herrscher von Buchara an. »Was soll das heißen, Ahmad?«
»Mir ist ... ich muss dringend fort, Herr, verzeiht!«
»Ja sind denn jetzt alle verrückt geworden?«, brüllte Nuh II. »Willst auch du mich im Stich lassen? Habt ihr euch alle gegen mich verschworen?«
»Nein, Herr. Es ist nur ...« Der Emir tat Ahmad fast Leid, aber er konnte es ihm nicht erklären, nicht jetzt, nicht, wenn ihm die Zeit wie feiner Sand zwischen den Fingern verrann. »Ich werde erwartet. Ich verspreche Euch, wenn ich zurückkomme, ist mir eine Lösung eingefallen, wie Euer Harem wieder zur Vernunft gebracht werden kann.«
Abrupt drehte er sich um, ließ den überraschten Emir in seinem Schlafgemach stehen und machte sich auf den Weg zum Palasttor. Wo würde er Saddin finden? Sollte er einfach am Hause des Schreibers anklopfen? Vermutlich war Saddin gar nicht anwesend, und niemand würde ihm dort mitteilen, wo der Nomade war. Da fielen ihm Saddins Zelte vor den Toren Bucharas ein. Dort hielt sich der Nomade oft auf. Dort würde er so lange auf ihn warten, bis er zurückkäme.
Ahmad hastete die Gänge entlang, ohne auf die Diener und Beamten zu achten, die gemächlichen Schrittes ihren Tagewerken nachgingen. Mit einigen von ihnen stieß er zusammen, andere retteten sich durch einen Sprung zur Seite. Ahmad selbst rutschte über den glatten Marmor, bewahrte nur mühsam sein Gleichgewicht und rappelte sich hastig wieder auf. Er ließ sich nicht einmal die Zeit, um Verzeihung zu bitten. Doch er wurde immer schneller. Als er schließlich das Tor passiert hatte, begann er zu laufen. Er achtete nicht auf die beiden Palastwachen, die ihm voller Verwunderung hinterher starrten. Er achtete nicht einmal darauf, dass er vergessen hatte, seinen Umhang umzulegen und andere Schuhe anzuziehen. Das alles war ihm jetzt vollkommen gleichgültig. Er konnte an nichts anderes mehr denken als an den heiligen Stein. Der Gedanke an diese Kostbarkeit trieb ihn an und verlieh seinen Schritten förmlich Flügel.
Hoffentlich hat Saddin noch den Stein der Fatima, dachte Ahmad und überlegte, wie er es anstellen sollte, dem Nomaden den Stein abzukaufen. Er wäre ohne weiteres bereit, seinen ganzen Besitz, sogar seine Stellung und seinen Namen für den Stein der Fatima zu opfern, wenn es sein musste. Wenn er es jedoch geschickt anfing, würde das unter Umständen nicht nötig sein. Es kam nur darauf an, den Nomaden nicht spüren zu lassen, wie viel ihm dieser Stein bedeutete. Und wenn diese wertvolle Reliquie bereits einen Käufer gefunden und sie nun in der Hand eines Diebs oder gar eines gefürchteten Mörders war? Was sollte er in so einem Fall tun? Sich mit einer Diebesbande einlassen? Sein Magen hob und senkte sich bedenklich.
»O Allah, ich flehe dich an«, murmelte Ahmad unglücklich vor sich hin. »Lass es bitte noch nicht zu spät sein!«
Und er beschleunigte seine Schritte abermals.
Keuchend und mit letzter Kraft erreichte Ahmad schließlich die Zelte des Nomaden. Jedes Mal, wenn er hier vor den Toren der Stadt stand und die Zelte vor sich erblickte, war er aufs Neue überrascht, wie groß und zugleich schön Saddins Lager war. Es hatte nichts gemein mit den primitiven, aus schmutzigen und schlecht gegerbten Häuten gefertigten Unterkünften, von denen seine Mutter immer gesprochen hatte. Als er noch ein kleiner Junge war, hatte sie ihm oft von den Nomaden erzählt. Er hatte diese Geschichten geliebt. Und sooft sie sie auch erzählte, so oft lauschte er gebannt jedem einzelnen Wort. Während ihm angesichts der geschilderten Umstände Schauer des Ekels und des Grauens über den Rücken liefen, pflegte seine Mutter verächtlich mit der Zunge zu schnalzen und geringschätzig die Nase zu rümpfen. Sie hielt nicht viel von den Männern, Frauen und Kindern, die keine feste Bleibe hatten, ihr Leben damit verbrachten, von Stadt zu Stadt, von Oase zu Oase zu ziehen und dabei ihr kärgliches Dasein mit niederen Hilfsarbeiten, Diebstahl und Betrug fristeten. Nomaden seien arm, schmutzig und ungebildet und auf keinen Fall der passende Umgang für einen Spross der edlen und angesehenen Familie Yahrkun. Das war das Fazit, das seine Mutter in ihren Erzählungen zog. Manchmal, wenn Ahmad voller Staunen vor Saddins Zelten stand, war er selbst verblüfft und beschämt, wie tief die Worte seiner Mutter noch immer in ihm hafteten – und wie wenig sie mit der Wirklichkeit übereinstimmten.
Saddins Zeltlager bestand aus mehr als hundert Zelten und war eigentlich eine Stadt für sich, eine Stadt aus niedrigen, runden, in der Mitte spitz nach oben zulaufenden Häusern. In dieser Stadt lebten Diener und Viehtreiber mit ihren Familien, Huf- und Silberschmiede, Sattler, Töpfer und Weber. Die Zelte waren schlicht und unscheinbar und man hatte fast den Eindruck, dass sie mit ihrer Umgebung, dem Sand und dem Lehm, verschmolzen. Einige von ihnen waren so groß, dass spielend fünfzig oder mehr Männer in ihrem Inneren Platz gefunden hätten, andere waren eher klein und bescheiden. Und sogar die Kamele und Pferde wurden nachts in Zelten untergebracht. Das alles machte einen ebenso wohl geordneten Eindruck wie jedes andere Dorf oder jede beliebige Stadt.
Der einzige Unterschied bestand darin, dass hier die Häuser nicht aus gebrannten Lehmziegeln errichtet waren, sondern aus Baumwolle, Leinen und gegerbtem Leder.
Keuchend hielt Ahmad sich seine linke Seite. Sie schmerzte, als würde jemand ihm mit jedem Atemzug glühende Spieße hindurchtreiben. Der Schweiß lief ihm über das Gesicht, und seine Kleidung klebte nur noch am Körper. Erschöpft wankte er die staubigen Straßen entlang, die sich im Laufe der Zeit zwischen den Zelten gebildet hatten. Auf seinem Weg sah er Frauen, die Brot auf seltsamen ofenartigen Tonkrügen backten, sich unterhielten oder ihre Kinder wuschen. Es waren schöne Frauen mit braun gebrannter Haut, schwerem Silberschmuck an Hand- und Fußgelenken, in farbenfrohe Gewänder gehüllt. Als sie Ahmad bemerkten, verbargen sie hastig ihre Gesichter hinter ihren breiten Kopftüchern oder verschwanden im Inneren eines Zelts. Es dauerte eine ganze Weile, bis Ahmad endlich einem Mann begegnete. Der Alte saß vor seinem Zelt auf dem Boden und bearbeitete gerade ein Stück Leder mit einer Ahle.
»Der Friede Allahs sei mit Euch, guter Mann!«, begrüßte Ahmad den Mann. »Entschuldigt die Störung. Ich möchte mit Saddin sprechen. Wisst Ihr vielleicht, wo ich ihn finden kann?«
Der Mann sah von seiner Arbeit auf. Er musterte Ahmad mit so viel Misstrauen, dass ihm ein kalter Schauer über den Rücken lief. Plötzlich wurde ihm bewusst, dass er in dieser Zeltstadt ein Fremder, ein Eindringling war. Sein Name, seine Stellung als Großwesir hatten hier überhaupt nichts zu bedeuten. Wie alle Nomaden, so waren auch diese Menschen niemandem außer ihrem eigenen Stammesfürsten verpflichtet. Nicht einmal Nuh II. ibn Mansur hätte das Recht gehabt, diesem einfachen Mann, der dort im Staub saß und seine Arbeit verrichtete, einen Befehl zu erteilen.
»Dort hinten«, antwortete der Mann nach einer Weile ohne übertriebene Freundlichkeit. »Bei den Pferden.«
Ahmad dankte höflich und folgte dann so schnell seine wunden Füße es erlaubten dem ausgestreckten Zeigefinger des Mannes.
Er erreichte bald das lange Zelt, in dem die Nomaden ihre Pferde unterbrachten. Schon aus der Ferne hörte er Stimmengewirr, begleitet von dem Wiehern der Pferde. Vor dem Zelt standen etwa ein Dutzend Knaben im Alter zwischen zehn und vierzehn, die die doppelte Anzahl an Pferden an Zügeln und Halftern festhielten. Die schönen, edlen Tiere waren nervös; aufgeregt tänzelten sie hin und her, schnaubten und wieherten. Die jungen Hüter hatten sicherlich Mühe, die Pferde zu bändigen. Dennoch ließ sich keiner von ihnen die Anstrengung anmerken. Scheinbar unbekümmert lachten und scherzten sie und feuerten einander an. Und nicht ein einziges Mal hörte eines der Tiere ein böses Wort oder wurde gar geschlagen.
Ahmad trat an den Jungen heran, der ihm am nächsten stand. »Der Friede sei mit dir. Wo finde ich Saddin?«
»Er ist dort im Zelt«, antwortete der Junge bereitwillig und griff die Halfter der beiden Pferde, die er beaufsichtigte, fester.
»Ich danke dir«, sagte Ahmad und wandte sich dem Zelt zu. »Er wird aber keine Zeit haben, mit Euch zu sprechen, Herr!«, rief ihm der Junge nach. »Saddin ist zurzeit sehr beschäftigt.«
Ahmad blieb stehen. »Glaube mir, mein Junge, für mich wird er Zeit haben«, erwiderte er und setzte seinen Weg fort. Aus dem Augenwinkel sah er noch, wie der Junge den Kopf schüttelte und mit den Schultern zuckte. Dann brachen sie alle in helles Gelächter aus.
Im Inneren des Zelts war es sehr warm. Die dichten, aus dicker ölgetränkter Baumwolle gewebten Planen ließen nur wenig Tageslicht herein, und Ahmad blieb am Eingang stehen, um seine Augen nach dem gleißenden Sonnenlicht an das Halbdunkel zu gewöhnen.
Eine dicke Strohschicht lag auf dem Boden zum Schutz gegen Sand und Steine. Es roch intensiv nach Pferden, obwohl der Stall auf den ersten Blick leer zu sein schien. Erst nach einer Weile entdeckte Ahmad die Männer, die sich am hinteren Ende des Zeltes versammelt hatten. Sie kehrten ihm ihre Rücken zu und waren so versunken in die Betrachtung von etwas, das außerhalb von Ahmads Sichtfeld lag, dass sie nicht einmal bemerkten, als er zu ihnen trat.
»Der Friede sei mit Euch!«, sagte er und deutete eine höfliche Verbeugung an. »Wo finde ich Saddin? Ich muss mit ihm ...«
Einer der Männer drehte sich zu ihm um und starrte ihn finster an. »Nicht jetzt!«
Der barsche Ton ließ Ahmad unwillkürlich einen Schritt zurückweichen. Vor ihm traten die Männer wieder dichter zusammen und bildeten eine undurchdringliche Mauer aus Rücken und Schultern. An jedem anderen Tag wäre Ahmad resigniert umgekehrt und hätte sich unverrichteter Dinge wieder nach Hause begeben, aber heute ging es um den Stein der Fatima, um ein Heiligtum, das er vor der Entweihung schützen musste. Ein Zorn, den er nur selten fühlte, stieg in heißen Wellen in ihm empor und trieb ihm das Blut in die Schläfen. Mit einer Kraft, die er sich selbst niemals zugetraut hätte, schob er die beiden vor ihm stehenden Männer zur Seite und trat an ihnen vorbei in den Kreis. Er achtete nicht auf ihre überraschten Ausrufe und die Verwünschungen, die sie ausstießen, sondern starrte nur hinunter auf Saddin, der direkt zu seinen Füßen auf dem Boden kniete.
»Saddin«, sagte Ahmad laut, »ich muss mit dir sprechen. Es ist dringend.«
»Ihr habt die Antwort gehört, Ahmad al-Yahrkun. Nicht jetzt!«, zischte Saddin, ohne Ahmad auch nur eines Blickes zu würdigen. Ahmad sah Schweißtropfen auf der Stirn des Nomaden. War Saddin etwa krank? Erst in diesem Augenblick fiel ihm auf, dass es hier gar nicht um den jungen Mann ging, sondern dass er vor einem Pferd kniete. Der Bauch des Tiers war angeschwollen und aufgebläht wie eine Schweinsblase. Es wand sich vor Schmerzen, warf immer wieder den Kopf auf den Boden und schnaubte und wieherte qualvoll. Vier kräftige Männer hielten die Beine und den Schweif des Pferds fest und sprachen beruhigend auf das Tier ein, während Saddins linker Arm bis weit über dem Ellbogen in dessen Leib verschwunden war. Die umstehenden Männer schwiegen, stumme Zeugen des Kampfs, der zu ihren Füßen tobte. Was ging hier vor? Immer wieder sprach Saddin beruhigend auf das Pferd ein, gab den anderen Männern seine Anweisungen und tastete im Inneren des Tiers nach etwas, von dem Ahmad keine Ahnung hatte, was es war. Unauffällig trat der Großwesir zwei Schritte zurück und reihte sich in den Kreis der anderen ein.
»Wird das noch lange dauern?«, fragte er die Männer, die neben ihm standen.
»Das weiß nur Allah«, antwortete einer von ihnen und zuckte ratlos mit den Schultern. Er sprach leise, wie es Menschen im Zimmer eines Kranken zu tun pflegen. »Allerdings muss Saddin sich beeilen. Wenn er es nicht bald schafft, das Fohlen im Leib der Stute zu drehen, wird er beide verlieren. Bereits seit heute Nacht liegt die Stute in den Wehen. Sie ist sehr stark und tapfer, aber dennoch wird sie nicht mehr lange durchhalten. Sie ist mit ihrer Kraft am Ende.«
Unruhig trat Ahmad von einem Bein auf das andere. Es interessierte ihn nicht, dass diese Stute gerade ein Fohlen zur Welt brachte. Es war ihm auch gleichgültig, ob sie und ihr Fohlen die Geburt überleben würden oder nicht. Er machte sich nichts aus Pferden. Und gerade jetzt, da es um den Stein ging, von dem das weitere Schicksal aller Gläubigen abhing, war das Leben einer Stute und ihres Fohlens das Unwichtigste, was er sich vorstellen konnte. Doch Ahmad schwieg. Er wagte nicht, den Nomaden ein zweites Mal anzusprechen. Saddin wiederholte sich nie, und wenn er in Zorn geriet, war er unberechenbar. Wenigstens war er zurzeit außer Stande, den heiligen Stein an jemanden weiterzuverkaufen. Mit diesem Gedanken tröstete sich Ahmad und blieb schweigend im Kreis der anderen stehen. Unbeteiligt sah er zu und betete im Stillen für die Sicherheit dieser Kostbarkeit. Doch mit der Zeit nahm ihn das Geschehen mehr und mehr gefangen. Er begann wie alle anderen hier sich um die Stute und ihr ungeborenes Fohlen zu sorgen.
Die Stute zitterte vor Erschöpfung. Ihr Wiehern wurde immer leiser und schwächer. Unwillkürlich fing Ahmad an die neunundneunzig Beinamen Allahs zu rezitieren. Die Perlen des Rosenkranzes glitten durch seine Finger, während die Stute und ihr Fohlen um ihr Leben kämpften. Endlich ging ein Raunen durch die Versammelten. Ahmad stellte sich auf die Zehenspitzen, um besser sehen zu können. Und dann entdeckte er es – Saddin hielt zwei kleine, zierliche Beine in seinen Händen, um die er geschickt ein Seil wand.
»Sala, zieh du das Fohlen heraus«, sagte er zu einem der Umstehenden, drückte dem Mann das Seil in die Hand und kroch zum Leib der Stute.
Das arme Tier war mittlerweile so erschöpft, dass es nur noch keuchte. Saddin stützte sich mit seinem ganzen Gewicht auf den Leib des Tieres und begann mit beiden Armen die Wehen zu unterstützen. Immer wenn er von oben gegen den Bauch der Stute drückte, zog der andere Mann an dem Seil, und Stück für Stück wurde das Fohlen geboren. Atemlos sah Ahmad zu, wie zuerst zwischen den Vorderbeinen die Nüstern des Fohlens sichtbar wurden, dann die geschlossenen Augen, die Ohren und der Hals. Und plötzlich ging alles so schnell, dass Ahmad dem Geschehen kaum mit den Augen folgen konnte. In einem Moment zog der Mann noch am Seil, Saddin drückte den Bauch der Stute zusammen, und im nächsten lag ein Fohlen, nass und mit einer seltsamen weißen Haut, auf dem Stroh. Zwei der umstehenden Männer knieten sofort nieder und begannen, das Neugeborene mit Strohbündeln trockenzureiben, während Saddin sich um die Nachgeburt kümmerte. Fasziniert sah Ahmad zu, wie das Fohlen die Augen öffnete und den Kopf hob. Mit einem erstaunten, fast ungläubigen Ausdruck in den großen dunklen Augen sah es sich um. Sein Kopf schwankte hin und her, als hätte der dünne Hals noch nicht genügend Kraft, das Gewicht zu tragen. Es war das erste Mal, dass Ahmad einer Geburt beigewohnt hatte. Voller Rührung betrachtete er das winzige Wesen, das dort im Stroh vor ihm lag. Wie herrlich, wunderbar und vollkommen war doch die Schöpfung Allahs, des Allmächtigen!
Mühsam und sichtlich erschöpft richtete sich Saddin auf. Notdürftig wischte er sich das schweißnasse Gesicht und seine blutigen Hände an einem Tuch ab. Sein Hemd und seine Hose waren blutbefleckt, das Haar klebte in feuchten Strähnen an seinem Kopf. Er sah aus, als wäre er gerade aus einer Schlacht heimgekehrt. Die anderen Männer schlugen ihm auf die Schultern, beglückwünschten ihn zu der Geburt des Fohlens, und trotz seiner Müdigkeit strahlte er vor Freude und Erleichterung. Doch als Saddins Blick auf Ahmad fiel, verschwand das Lächeln von seinem Gesicht.
»Erwartet mich in meinem Zelt«, sagte er über die Köpfe und Schultern der anderen hinweg. »Ich bin gleich dort.«
Von außen unterschied sich Saddins Zelt von denen der anderen Nomaden lediglich durch seine Größe. So unscheinbar und grau, wie es war, machte es den Eindruck, als wäre es direkt der sandigen Erde entwachsen, auf der es stand.
Saddin musste seinen Untergebenen bereits von Ahmads bevorstehendem Besuch erzählt und entsprechende Anweisungen gegeben haben, denn ein Diener erwartete den Großwesir vor dem Zelteingang. Er verneigte sich vor Ahmad, begrüßte ihn höflich und bat ihn, seine Schuhe am Zelteingang abzustreifen. Erst dann hob er die schwere Plane, die den Eingang verdeckte, und ließ ihn eintreten.
Ahmad hatte schon oft gemeinsam mit Nuh II. das Lager aufgesucht. Der Emir interessierte sich sehr für die edlen Pferde des Nomaden. Immer wieder schaute er sich die Tiere an und bewunderte sie, und hin und wieder kaufte er Saddin sogar eines ab – meistens für beachtliche Summen. Aber diese Geschäfte wurden in der Regel unter freiem Himmel abgewickelt. Niemals zuvor hatte Ahmad eines der Zelte von innen gesehen, und so traf ihn der Anblick völlig unvorbereitet. Er wusste nicht genau, was er eigentlich erwartet hatte – vielleicht ein paar Felle, irdene Schüsseln und ein offenes Feuer, Staub und Sand. Aber Saddins Zelt war so behaglich, geschmackvoll und luxuriös ausgestattet wie das Haus eines wohlhabenden Kaufmanns. Staunend blieb Ahmad am Eingang stehen. Der Boden war mit kostbaren Teppichen bedeckt. Auf ein paar niedrigen Tischen standen Messingschalen mit Datteln, Feigen und Weintrauben. Ahmad entdeckte sogar Melonen und Granatäpfel, überaus seltene Köstlichkeiten in Buchara. Auf den farbenfrohen Sitzpolstern lagen weiche Lamm- und Ziegenfelle. Mehrere verteilt stehende Öllampen verbreiteten ein angenehmes Licht, und auf einem kleinen Schemel in einer Ecke des Raums befand sich ein Räuchergefäß, aus dem eine dünne Rauchsäule aufstieg, die den warmen, würzigen Duft von Weihrauch und Amber verbreitete. Von Staub, Sand und Armut war weit und breit nichts zu sehen.
Ein zweiter Diener begrüßte Ahmad und reichte ihm lächelnd ein Paar goldbestickte seidene Pantoffeln.
»Der Friede sei mit Euch, verehrter Ahmad al-Yahrkun!«, wurde er von einem weiteren Diener begrüßt. Auch dieser lächelte, und Ahmad begann sich zu fragen, ob man ihm sein ungläubiges Staunen vom Gesicht ablesen konnte. »Mein Herr wird bald erscheinen«, fuhr der Diener freundlich fort. »Er beauftragte mich, Euch eine Erfrischung anzubieten, um Euch die Wartezeit zu verkürzen. Wenn Ihr mir bitte folgen wollt?«
Der Diener führte ihn zu einem der Sitzpolster, half ihm beim Niedersetzen und ordnete sogar die Falten seiner Gewänder. Eine Platte mit Datteln, Feigen und Nüssen stand auf dem niedrigen Tisch neben Ahmad bereit, ebenso ein Krug mit Wasser und zwei Becher. Fassungslos nahm Ahmad den gefüllten Becher entgegen, den der Diener ihm reichte. Das Letzte, was er im Zelt eines Nomaden erwartet hatte, waren Manieren, die sich mit denen am Hofe des Emirs von Buchara messen konnten.
»Ich werde Euch jetzt allein lassen, Herr«, sagte der Diener und verbeugte sich höflich. »Wenn Ihr einen Wunsch habt, ruft nach mir. Mein Name ist Kemal.«
Der Diener verbeugte sich noch einmal und verschwand dann zwischen schweren, wollenen Vorhängen in einem anderen Teil des Zelts, der Ahmads Augen verborgen war. Erst jetzt merkte Ahmad, wie durstig er war, gestattete sich aber dennoch keine Gier; Mäßigung in allen Lebenslagen, das war ein Allah wohlgefälliges Verhalten. Vorsichtig trank Ahmad einen kleinen Schluck. Das Wasser war so klar und kühl, als wäre es erst vor wenigen Augenblicken aus einer reinen Bergquelle geschöpft worden – ein Genuss nach Staub und Hitze, nach dem anstrengenden Lauf und der Warterei bei den Pferden. Es war Ahmad ein Rätsel, wie es Saddin gelungen war, derart köstliches Wasser zu beschaffen. Soviel er wusste, gab es im Lager der Nomaden keinen Brunnen. Jeden Morgen sah man die in bunte Gewänder gehüllten Frauen mit den großen Tonkrügen durch das Stadttor gehen, um in Buchara Wasser zu schöpfen. Das Wasser aus diesen Zisternen jedoch war meist abgestanden, hatte eine gelbbraune Farbe und einen lehmigen Beigeschmack. Das Wasser in seinem Becher hingegen schmeckte so köstlich, als stammte es aus Nuhs eigenen Brunnen. Ahmad trank noch einen Schluck – und wartete. Als sich Saddin nach einiger Zeit immer noch nicht blicken ließ, wurde er unruhig. Ratlos drehte er den Becher in seiner Hand und überlegte, was er tun sollte.
»Kemal!«
Die dichten Vorhänge bewegten sich leicht, und wie durch einen Zauber stand der Diener vor ihm. »Herr, Ihr habt mich gerufen?«, sagte er und verneigte sich vor Ahmad. »Habt Ihr einen Wunsch?«
»Ja. Wo ist Saddin? Ich warte schon übermäßig lange auf ihn. Dabei muss ich ihn dringend sprechen.«
»Er wird gleich bei Euch sein, Herr. Habt noch einen Augenblick Geduld.«
Täuschte sich Ahmad oder machte sich der Diener insgeheim über ihn lustig? Er glaubte, ein spöttisches Funkeln in seinen Augen gesehen zu haben.
»Gut, aber sage ihm, dass ich nicht mehr lange auf ihn warten kann. Ich habe noch wichtige Geschäfte zu erledigen.«
»Sehr wohl, Herr, ich werde es ihm ausrichten«, entgegnete der Diener, verbeugte sich und verschwand wieder zwischen den Vorhängen. Doch erneut wurde Ahmads Geduld auf eine harte Probe gestellt. Um sich die Zeit zu vertreiben, erhob er sich schließlich und ging im Zelt umher. Mehr aus Langeweile denn aus Neugierde nahm er das Kupfer- und Messinggeschirr in die Hände und betrachtete jedes einzelne Stück genau von allen Seiten. Er war gerade in den Anblick einer besonders schönen Kupferkanne versunken, als plötzlich hinter ihm eine Stimme spöttisch sagte: »Gefällt sie Euch, Ahmad al-Yahrkun?«
Erschrocken fuhr Ahmad herum. Vor ihm stand Saddin.
»Sie ist wunderschön, ein Meisterwerk der Schmiedekunst«, antwortete Ahmad und stellte die Kanne hastig wieder auf den Tisch zurück, von dem er sie genommen hatte.
Unauffällig und lautlos wie ein Schatten war der Nomade hinter ihn getreten. Wie lange mochte er schon da stehen und ihn beobachten? Und plötzlich hatte Ahmad einen Verdacht. Er betrachtete die Vorhänge genauer. Waren die Stoffe wirklich so dicht, wie sie zu sein schienen? Oder waren sie nicht bestens geeignet, einen Mann zu verbergen, der seinen Gast ausspionieren wollte? Hatte Saddin vielleicht die ganze Zeit über dort gestanden, ihn beobachtet und sich heimlich über ihn lustig gemacht?
»Nehmt doch bitte Platz, im Sitzen redet es sich leichter«, sagte Saddin und ließ sich auf einem der Polster nieder. Er trug jetzt frische Kleidung und seine Hände und sein Gesicht waren sauber. Seine noch feuchten Haare waren im Nacken zusammengebunden. Offensichtlich hatte er gebadet – nach der Anstrengung kein Wunder und überdies ein hinreichender Grund, einen Gast länger als üblich warten zu lassen. Aber wenn Saddin nichts zu verbergen hatte, weshalb, so fragte sich Ahmad, entschuldigte er sich dann nicht bei ihm? Voller Argwohn nahm er gegenüber dem Nomaden Platz.
»Ich muss gestehen«, begann Saddin, während er Ahmad erneut Wasser anbot und dann seinen eigenen Becher füllte, »dass mich Euer unerwartetes Erscheinen sehr verärgert. Ich schätze es nicht, von meinen Geschäftspartnern hier aufgesucht zu werden.«
»Ich muss aber ...«
Doch Saddin schnitt ihm mit einer Geste das Wort ab. »Ihr kennt die Regeln, Ahmad al-Yahrkun«, fuhr er kühl fort. »Und Ihr habt sie akzeptiert, als Ihr mich das erste Mal um meine Hilfe gebeten habt.«
»Es ist aber ...«
»Wenn ich jetzt dennoch bereit bin, Euch anzuhören, so liegt es daran, dass Allah uns heute ein großes Geschenk gemacht hat und ich gewillt bin, aus Dankbarkeit meinen Zorn zu vergessen. Aber ich empfehle Euch, in Zukunft unsere Vereinbarung einzuhalten. Anderenfalls sehe ich mich gezwungen, unsere geschäftliche Beziehung zu beenden.«
»Die Stute und ihr Fohlen werden überleben?«, fragte Ahmad und merkte zu seinem eigenen Erstaunen, dass er sich sogar ein wenig über diese Nachricht freute.
Saddin nickte: »Allah hat uns Seine Gnade erwiesen. Und nun erzählt, was so dringlich ist, dass es keinerlei Aufschub duldet und Euch sogar zwang, in mein Heim einzudringen.«
Ahmad presste verärgert die Lippen zusammen. Der Nomade ließ keinen Zweifel daran, dass er ihn und sein Anliegen als überaus lästig empfand und diese Angelegenheit daher so schnell wie möglich hinter sich bringen wollte. Vermutlich hatte Ahmad es lediglich dem Gebot der Gastfreundschaft zu verdanken, welches die Nomaden seit Urzeiten als heilig erachten, dass er dieses überaus wichtige Gespräch nicht irgendwo auf freiem Feld im Stehen führen musste. Und wenn die Stute oder ihr Fohlen oder gar beide gestorben wären?
Was wäre dann mit ihm geschehen? Aber zum Glück hatte Allah in Seiner unendlichen Güte und Weisheit das verhindert.
»Ich bin wegen dieses Steins hier, dieses Saphirs, den die Barbarin bei sich gehabt hat, als du sie beobachtet hast«, sagte Ahmad nach kurzem Zögern. »Befindet sich das Juwel in deinem Besitz?«
»Nein.«
Die Antwort kam schnell, kühl und sicher. Dennoch beobachtete Ahmad den Nomaden misstrauisch. Log er ihn etwa an? Da fiel ihm ein, dass Saddin wie alle Schurken, jedes Wort auf die Goldwaage zu legen pflegte. Womöglich hatte er nur die falsche Frage gestellt.
»Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Solltest du den Stein in deinem Besitz gehabt und ihn verkauft haben, bitte ich dich, mir das zu sagen. Ich muss es wissen.«
Die letzten Worte kamen zu schnell, zu hastig. Ein Fehler, dessen Ahmad sich durchaus bewusst war. Saddin würde misstrauisch werden, Verdacht schöpfen, den Preis für den Stein hochtreiben. Aber er konnte nicht anders. Er musste die Antwort erfahren. Nervös ballte Ahmad die Hände zu Fäusten, bis die Knöchel weiß hervortraten. Sein Herz klopfte bis zum Hals, kalter Schweiß stand ihm auf der Stirn.
»Warum?«
Ahmad sah den Nomaden verständnislos an.
»Warum müsst Ihr es wissen, Ahmad?«
Ahmad spürte, wie ihm das Blut ins Gesicht schoss. Weshalb nur hatte er die lange Wartezeit, die Allah in Seiner Weisheit ihm geschenkt hatte, nicht genutzt, um sich seine Worte genau zu überlegen? Was um alles in der Welt sollte er dem Nomaden jetzt antworten?
»Ich wollte ... ich dachte mir ...«, stammelte er, während er verzweifelt versuchte die passenden Worte zu finden.
Saddin schüttelte den Kopf. Ein Lächeln glitt über sein Gesicht und entblößte dabei seine herrlichen ebenmäßigen Zähne – eine Reihe kostbarer weißer Perlen im Gesicht eines Gauners und Betrügers.
»Gebt Euch keine Mühe, verehrter Freund. Lasst mich raten. Der Stein interessiert Euch sehr. Ihr würdet ihn gern in Euren Besitz bringen. Die Barbarin hat den Stein nicht mehr, sonst würdet Ihr nicht mich fragen müssen.« Die Augen des Nomaden wurden schmal. »Ihr habt das Zimmer der Barbarin bereits durchsucht.« Er schnalzte mit der Zunge. »Ihr überrascht mich, Ahmad al-Yahrkun. Ich entdecke ungeahnte Seiten an Euch.«
Ahmad spürte, wie der Zorn in ihm aufwallte. Was bildete sich dieser Schurke eigentlich ein? Wie konnte er es wagen, ihn offen zu verhöhnen, ihn so zu demütigen? Trotzdem musste er wissen, ob Saddin den Stein der Fatima in seinem Besitz gehabt hatte. Wieder einmal biss er die Zähne zusammen und schluckte seinen Zorn hinunter.
»Ich vermute, dass die Barbarin Samira den Stein gab. Samira ist nun tot. Deshalb muss ich dich fragen ...«
»Ob ich Samira getötet habe?«, unterbrach ihn Saddin. Seine Augen begannen zornig zu funkeln. »Dazu hatte ich wahrlich keinen Grund. Und ich kann Euch versichern, dass Samira Euren Stein nicht hatte.«
»Aber wie kannst du dir sicher sein?«, fragte Ahmad. »Die Barbarin könnte ihr den Stein gegeben haben. Und dass sie jetzt tot ist ...«
»... hat überhaupt nichts mit diesem Stein zu tun«, unterbrach ihn Saddin heftig. »Samiras Tod ist das, was man das Werk eines unfähigen, törichten Mannes nennen könnte. Aber, Allah sei Dank, sein Handlanger hat bereits dafür bezahlt, sonst hätte ich mich auch darum selber kümmern müssen.«
Ahmad fuhr sich verzweifelt durchs Haar. »Aber wo ist der Stein dann?«
»Woher soll ich das wissen? Ich habe ihn nicht, und Samira hatte ihn auch nicht, sonst hätte sie ihn mir gegeben.« Saddin hob bedauernd die Hände. »Es tut mir Leid, dass ich Euch nicht mehr dazu sagen kann. Wenn ich gewusst hätte, wie viel der Stein Euch bedeutet, hätte ich ihn an mich genommen und für Euch aufbewahrt. Die Gelegenheit wäre überaus günstig gewesen. Aber Ihr müsst zugeben, dass es kaum in meiner Macht steht, derartige Wünsche vorauszusehen.« Saddin erhob sich und half Ahmad beim Aufstehen. Offensichtlich hatte er nicht die Absicht, noch länger mit dem Großwesir zu reden. »Ich vermute, Eure dringenden Geschäfte, von denen man mir erzählte, halten Euch davon ab, noch länger zu verweilen. Ich bedaure dies zutiefst, das Gespräch mit Euch war überaus lehrreich. Allerdings habe auch ich Verpflichtungen, die keinen Aufschub dulden.«
Am Zelteingang blieb Ahmad stehen. Während er darauf wartete, dass man ihm seine Schuhe brachte, ließ er seinen Blick über die Zelte schweifen. Plötzlich erregte etwas am Stadttor seine Aufmerksamkeit. Ahmad rieb sich die Augen und schaute noch einmal hin. Aber nein, er hatte sich nicht getäuscht. Dort oben, direkt über dem Tor, hing etwas, das aussah wie ein Mensch.
»Saddin!«, schrie er. »Komm schnell!«
»Was ist denn jetzt schon wieder?« Sichtlich verärgert trat der Nomade an seine Seite.
»Sieh nur!«, stieß Ahmad mühsam hervor und packte den jungen Mann am Arm. »Dort oben am Stadttor hängt jemand!«
Saddin warf einen flüchtigen Blick in die Richtung.
»Und? Der hängt schon seit zwei Tagen da.«
»Aber jemand muss ihn abnehmen. Er muss beerdigt werden, bevor die Krähen ihr Werk beginnen.«
»Das haben sie bereits getan«, entgegnete Saddin, und ein zufriedenes Lächeln umspielte seine Lippen. »Glaubt mir, die Welt ist besser dran ohne Malek al-Omar.«
»Malek? Aber du selbst hast doch um seine Freilassung gebeten!«, entfuhr es Ahmad. »Und jetzt erfreust du dich an seinem Tod?«
»Wundert Euch das?« Das Lächeln des Nomaden jagte Ahmad Schauer über den Rücken. »Ihr seid nicht der einzige Mann, der mich um meine Hilfe bittet oder ...«, er atmete tief ein, »... der getroffene Vereinbarungen bricht. Ich wünsche Euch einen guten Heimweg, Ahmad al-Yahrkun. Und denkt immer an meine Worte.«
Er verneigte sich, führte die Hand zu Mund und Stirn und verschwand dann mit schnellen leichten Schritten irgendwo in den undurchdringlichen Tiefen seines Zeltes.
Endlich brachte der Diener Ahmads Schuhe. Wie im Traum ging er durch die Zeltstadt dem Stadttor entgegen. Saddins Worte waren verleztend gewesen. Der Nomade hatte sich nicht einmal bemüht, seinen Hohn und seinen beißenden Spott wie üblich in Höflichkeit zu kleiden und somit zu mildern. Er hatte es sogar gewagt, ihm zu drohen. Dennoch hatte Ahmad den Eindruck, dass er nicht belogen worden war. Die Antworten des Nomaden hatten offen und ehrlich geklungen, offener und ehrlicher, als ihm, und vermutlich auch Saddin selbst, lieb war. Der Nomade hatte den Stein der Fatima also niemals in seinem Besitz gehabt, und er hatte Samira nicht getötet. Aber wenn weder er noch die Barbarin den heiligen Stein hatte – wo um alles in der Welt war er dann?
Langsam wie ein Schlafwandler setzte Ahmad einen Fuß vor den anderen. Als er den Emir so überstürzt verlassen hatte, war es um die dritte Stunde gewesen. Mittlerweile musste es weit nach Mittag sein. Unbarmherzig brannte die Sonne auf ihn nieder, die Hitze staute sich in den engen, staubigen Straßen und ließ die Luft vibrieren. Häuser, Türen und Fenster wurden verzerrt und wirkten wie Traumgebilde oder Erscheinungen aus der Geisterwelt, die ständig ihre Formen wechselten, um so den einsamen Wanderer zu verwirren und ins Verderben zu treiben. Weit und breit war kein Mensch und kein Tier zu sehen, alles was Beine hatte, hatte sich in den Schutz der Häuser zurückgezogen. Die Hitze war unerträglich. Langsam ging Ahmad die menschenleeren Gassen entlang. Der Schweiß rann ihm in Strömen über das Gesicht, seine Gewänder waren feucht, seine Zunge klebte am Gaumen. Ein dumpfer Schmerz pochte an seinen Schläfen, sein Gesicht glühte, tausend winzige Flammen schienen auf seiner Haut zu tanzen und ihn langsam zu verbrennen. Der Druck in seinem Schädel wurde immer stärker. Gleich würde sein Kopf platzen und wie ein überreifer Granatapfel sein Inneres nach außen schleudern, hier mitten auf die staubige Straße, den Raben und Geiern zum Fraß. Dennoch konnte er nur daran denken, dass er zum ersten Mal das Mittagsgebet versäumt hatte und dass er immer noch nicht wusste, wo der Stein der Fatima war. Während er sich mühsam unter der unbarmherzigen Sonne dahinschleppte, bat er Allah um Verzeihung für seine Verfehlungen. Die Perlen des Rosenkranzes rutschten durch seine feuchten Hände. Ihm wurde übel. Da hob er den Blick, und im gleißenden Sonnenlicht, direkt vor seinen Augen, sah er ein Schild. Ein Schild aus Messing. Ahmads Augen taten weh, und er konnte den Namen nicht lesen, der dort geschrieben stand. Doch er erkannte die daneben abgebildete Schlange, die sich anmutig um einen gekrümmten Stab wand. Und in diesem Augenblick wusste er, dass Allah ihm bereits verziehen hatte. Mit letzter Kraft schlug Ahmad al-Yahrkun gegen die schwere schlichte Tür des Hauses. Dann sank er in die Knie.
Ali war nicht wenig überrascht, als Selim ihm meldete, Ahmad al-Yahrkun, der Großwesir, liege direkt vor seinem Haus auf der Straße. Im ersten Augenblick hielt Ali es für einen Scherz, denn dass der Großwesir ihm gegenüber eine tiefe Abneigung empfand, war wohl niemandem in ganz Buchara entgangen. Dennoch lief er auf der Stelle hinunter. Ein bewusstloser Mann, der mitten auf der Straße direkt vor dem Tor eines Arztes lag, machte keinen günstigen Eindruck, ganz gleich, ob es sich nun tatsächlich um den Großwesir von Buchara handelte oder nicht.
»Wer hat ihn gefunden?«, fragte er Selim auf dem Weg.
»Der Torsklave, Herr«, keuchte der Diener, der mit seinem jungen Herrn kaum mehr Schritt halten konnte. »Er hat ein schwaches Klopfen an der Tür gehört und mehrmals nachgefragt, wer da sei. Als sich niemand meldete, hat er vorsichtig die Tür geöffnet. Und da lag der Mann – genau zu seinen Füßen. Der Torsklave hat sofort mich gerufen. Ich habe mir den Mann angesehen und mich dann sogleich auf den Weg gemacht, um Euch zu verständigen!«
Der Sklave, ein junger, kräftig gebauter Mann, ging vor dem geschlossenen Tor nervös auf und ab. Als er Ali und Selim kommen sah, blieb er stehen und verneigte sich fast bis zum Boden. Ali sah sich irritiert um. An einem Pfosten lehnte die säuberlich zusammengerollte Strohmatte, auf welcher der Torsklave während der Nacht schlief. Ansonsten war der Eingangsbereich leer.
»Wo ist der Mann?«
»Draußen, Herr«, antwortete der Sklave. »Ich habe ihn so liegen lassen, wie ich ihn vorfand.« Ali stieß einen tiefen Seufzer aus. Für einen kurzen Augenblick hatte er gehofft, dass es diesen rätselhaften Mann vor seinem Tor gar nicht gab.
»Dann öffne doch die Tür!«, sagte Ali schroffer, als er beabsichtigt hatte. Der junge Sklave beeilte sich, den fast eine Elle breiten, mit Eisenbeschlägen versehenen Riegel anzuheben und den schweren Torflügel aufzuziehen, so dass Ali auf die Straße treten konnte. Draußen wurde er von Gluthitze und grellem Sonnenlicht empfangen. Dann sah er den Mann. Regungslos lag er vor ihm im Staub. Ali blickte die Straße hinauf und hinunter, es war niemand zu sehen.
Natürlich nicht, dachte er. Wer auch immer den armen Kerl hier hingelegt haben mochte, war schon längst wieder über alle Berge. Ali schüttelte resigniert den Kopf. Bisher hatten die Einwohner Bucharas davon abgesehen, ihm die kranken und siechen Menschen einfach vor die Haustür zu legen. Hoffentlich blieb dies hier ein Einzelfall.
Ali wandte sich wieder dem Mann zu. Er trug weder einen Turban noch eine andere Kopfbedeckung, sodass sein kurz geschnittenes, bereits schütteres Haar sichtbar war. Der sorgfältig gestutzte Bart war ebenso hell vor Staub und Sand wie seine teuren Gewänder. Er sah aus, als wäre er tagelang zu Fuß durch die Wüste gewandert. Aber am meisten erschreckte Ali das Gesicht des Mannes. Er konnte sich zwar nicht vorstellen, wie Selim in diesem hochroten, schweißig glänzenden, verquollenen Gesicht mit den blutig aufgesprungenen Lippen Ahmad al-Yahrkun, den Großwesir, wiedererkannt haben wollte, aber eine gewisse Ähnlichkeit war nicht zu leugnen. Ali kniete neben dem Mann nieder und legte ihm behutsam eine Hand auf die Brust. Er atmete schnell und schwach. Dann prüfte er mit dem Handrücken die Stirn und die Wangen des Mannes; wie Ali bereits vermutet hatte, waren sie glühend heiß.
»Dieser Mann war lange schutzlos der Hitze und der Sonne ausgesetzt«, sagte er zu seinen beiden Dienern, die ihn neugierig beobachteten. »Tragt ihn vorsichtig hinein.«
Behutsam nahmen Selim und der Torsklave den bewusstlosen Mann an Armen und Beinen und schleppten ihn ins Innere des Hauses. Gedankenverloren ging Ali hinter ihnen her. Wenn das wirklich Ahmad al-Yahrkun war, weshalb war er dann in diesem Zustand? Er hatte doch genügend Diener und Sklaven, die ihn mit einer bequemen Sänfte jederzeit zu jedem Ort bringen würden. Warum hatte er stattdessen den Palast ausgerechnet während der größten Hitze verlassen und sich somit einer unnötigen Gefahr ausgesetzt? Weshalb war er zu ihm gekommen? Und vor allem – weshalb trug der Großwesir nur Kleidung, wie man sie im Inneren des Hauses anhatte? Seine leichten seidenen Pantoffeln waren schmutzig, die Sohlen von Sand und Steinen aufgerissen. Diese Schuhe waren bestenfalls für das Laufen auf Marmor oder weichen Teppichen geeignet, nicht aber für einen Marsch auf staubiger Straße. Hatte der Großwesir keine Zeit gehabt, seine Kleidung zu wechseln, bevor er auf die Straße ging? Hatte er vielleicht den Palast gar nicht freiwillig verlassen? Immer mehr Fragen tauchten auf, Fragen, die nur einer beantworten konnte – der Mann selbst.
Ali ließ den Kranken in das kleine Zimmer bringen, das direkt neben seinem Arbeitszimmer lag und von allen Dienern seines Haushalts nur Patientenkammer genannt wurde. Für gewöhnlich nutzte Ali den Raum, um Patienten zu beherbergen. Entweder wollte er sie nach einer Behandlung eine gewisse Zeit beobachten, oder sie waren so schwer krank, dass sie den Weg nach Hause nicht antreten konnten. Ali setzte sich neben den Mann auf die Kante des niedrigen Bettes und betrachtete ihn nachdenklich. Selim hatte Recht gehabt, es war tatsächlich Ahmad al-Yahrkun, der dort mit rotem Gesicht und überhitzt vor ihm lag. Ali stieß einen bekümmerten Seufzer aus. Es war nicht der Zustand des Großwesirs, der ihm Sorgen bereitete. Sie hatten ihn noch rechtzeitig gefunden. Das salzige Wasser, das sie ihm in kleinen Schlucken eingeflößt hatten, sowie die kühlenden Umschläge hatten bereits ihre Wirkung getan. Sein Atem wurde kräftiger, und schon bald würde der Großwesir aus seinem Hitzeschlaf erwachen.
Dennoch hatte Ali das ungute Gefühl, dass die Anwesenheit von Ahmad al-Yahrkun in diesem Hause Ärger mit sich bringen würde – jede Menge Ärger. Ohne genau sagen zu können, warum, mochte er Ahmad al-Yahrkun nicht. Er war noch nie mit ihm aneinander geraten, aber jedes Mal, wenn er dem Großwesir im Palast begegnete, hatte er das Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen – weshalb er nicht auch einen Rosenkranz um das Handgelenk geschlungen hatte, weshalb er es mit den Gebetszeiten nicht so genau nahm, weshalb er schon wieder nicht zum Freitagsgebet in der Moschee war. Und Humor war diesem Mann gänzlich fremd. Deshalb sah Ali Ahmad am liebsten von weitem – und nun lag er direkt vor ihm, hier in seinem Haus! Dabei hatte der Tag so gut begonnen.
Mit einem unbehaglichen Gefühl starrte Ali auf das Gesicht des Großwesirs hinunter und fragte sich, wer ihn vor seiner Haustür abgelegt haben konnte. Und aus welchem Grund? Eine Diebesbande, die den Emir warnen oder erpressen wollte? Ein Unbekannter, der den Großwesir irgendwo außerhalb der Stadt aufgelesen hatte? Jemand, der Ali Böses und seinen Ruf am Hofe des Emirs schädigen wollte, etwa ein eifersüchtiger Kollege, von denen es in Buchara genug gab? Oder war es einfach ein unerfreuliches Schicksal?
In diesem Augenblick regte sich Ahmad. Seine Lider zitterten, seine trockenen Lippen begannen sich zu bewegen, und er murmelte leise vor sich hin. Ali beugte sich vor und hielt sein Ohr dicht an den Mund des Großwesirs, um die geflüsterten Worte besser zu verstehen.
»Der Stein ... Wo ist der Stein? Allah, wo ist der Stein?«
Ali legte ihm beruhigend eine Hand auf die Stirn, und Ahmad schlug die Augen auf. Unstet wanderte sein Blick durch den Raum und blieb schließlich an Ali haften. Er konnte förmlich sehen, wie der Geist des Großwesirs von seiner Reise durch Traumwelten, in denen er offensichtlich auf der Suche nach irgendeinem Stein gewesen war, in die Wirklichkeit zurückkehrte. Von eine Sekunde zur nächsten wurde sein Blick klar.
»Ali al-Hussein!«, flüsterte Ahmad überrascht. »Wo bin ich? Wie komme ich hierher? Was ist geschehen?«
»Auf Eure beiden letzten Fragen kann ich Euch leider keine befriedigende Antwort geben, verehrter Ahmad al-Yahrkun«, sagte Ali mit einem Lächeln. »Ich weiß nur, dass Ihr Euch zu lange der Sonne ausgesetzt habt. Meine Diener haben Euch vor meinem Tor gefunden. Ihr wart bewusstlos, und so haben wir Euch in mein Haus gebracht, wo ich Euch behandelt habe. Und dort seid Ihr auch jetzt noch.«
»Ich würde jetzt gerne in den Palast zurückkehren, sofern Ihr es gestattet.«
»Natürlich«, erwiderte Ali. »Ich habe einen Boten zum Palast geschickt, damit man Euch abholt. Die Sänfte ist soeben eingetroffen.«
»Wer gab Euch das Recht, so eigenmächtig zu handeln?«, stieß der Großwesir derart wütend hervor, dass Ali erschrocken zurückwich. »Nun, jetzt lässt es sich wohl nicht mehr ändern ...« Ahmad schlug das dünne Laken zurück, mit dem er zugedeckt war, und erhob sich.
Ali runzelte verärgert die Stirn. Er hatte nur höflich sein wollen. Wenn der Großwesir seine Freundlichkeit nicht erwidern mochte, so war das seine Angelegenheit. »Ich werde einen Diener rufen, der Euch zur Tür begleitet.« Ali klatschte zweimal in die Hände, und gleich darauf erschien ein Junge. »Der edle Ahmad al-Yahrkun wünscht zu gehen. Geleite ihn zum Tor. Und sorge dafür, dass er ein paar neue Schuhe erhält.« Er wandte sich wieder an den Großwesir. »Eure Seidenpantoffeln sind durchgelaufen. Ihr würdet nur Euren Füßen Schaden zufügen, wenn Ihr darin zurückgehen würdet.«
»Ich danke Euch für Eure Pflege, Ali al-Hussein«, sagte Ahmad steif und deutete eine leichte Verbeugung an. »Allah möge Euch Eure Großherzigkeit hundertfach vergelten.« Noch bevor Ali etwas erwidern konnte, hatte der Großwesir auch schon das Zimmer verlassen und war dem Jungen gefolgt. Ali trat ans Fenster. Von hier aus konnte er die Straße gut überblicken. Erleichtert atmete er auf, als die Sänfte mit Ahmad al-Yahrkun endlich aus seinem Blickfeld verschwunden war. Dennoch hatte er ein ungutes Gefühl. Irgendetwas hatte den Großwesir gekränkt. Es wäre sonst nie zu diesem Wutausbruch gekommen. Ali war sich nicht sicher, was das zu bedeuten hatte. Im Gegensatz zu Nuh II. wurde Ahmad al-Yahrkun niemals zornig oder ausfallend. Aber so schrecklich die Wutanfälle des Emirs waren, so schnell vergaß er auch wieder seinen Zorn. Ahmad hingegen vergaß nichts. Ali starrte auf die Stelle, wo er eben noch die schmächtige Gestalt des Großwesirs gesehen hatte, und biss sich auf die Unterlippe. Er hatte Ahmad al-Yahrkun beleidigt, und dafür würde sich der Großwesir an ihm rächen – jetzt oder später, vielleicht sogar erst in einigen Jahren. Aber er würde es auf keinen Fall vergessen.