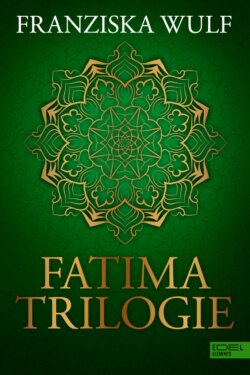Читать книгу Fatima Trilogie Gesamtausgabe - Franziska Wulf - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VIII
ОглавлениеAm folgenden Tag hatten sich Mirwat und Beatrice kurz nach dem Morgengebet im Bad verabredet. Das Bad, ein wahrer Luxus-Tempel, der es spielend mit jeder Wellness-Oase des ausgehenden 20. Jahrhunderts hätte aufnehmen können, gehörte zum Haremstrakt des Palastes und war allein den Frauen des Emirs vorbehalten. Sie nutzten das Bad nicht nur zur Reinigung, Entspannung und Schönheitspflege, es war obendrein ein viel besuchter gesellschaftlicher Treffpunkt. Insbesondere nach dem Morgengebet kam abgesehen von Sekireh jede Frau, die zum Harem des Emirs gehörte, hierher. Es wurden Neuigkeiten aus dem Palast und der Stadt ausgetauscht, Klatsch und Tratsch machten die Runde, Dienerinnen reichten kleine kulinarische Leckerbissen und frisch gepresste Säfte. Man zeigte sich, begutachtete gleichzeitig misstrauisch die anderen, registrierte jeden noch so kleinen Makel an den Rivalinnen und verteilte großzügig mit Sticheleien und Gemeinheiten versehene Komplimente. Dabei badete man in heißem, nach Rosen oder Orangenblüten duftendem Wasser oder ließ sich von einer Dienerin die Nägel feilen, eine Schönheitsmaske auflegen oder den Körper mit Duftölen massieren. Aber im Grunde genommen war die Schönheitspflege reine Nebensache. Eigentlich war das Bad nichts anderes als das Schlachtfeld, auf dem die Frauen ihre Bündnisse unter- und gegeneinander schlossen und ihre unblutigen, aber nicht minder verletzenden Kriege führten.
Als Beatrice den Vorraum des Bads betrat, in dem sich die Frauen ihrer Kleider entledigten, war dieser gerade leer. Anhand der bereits auf den hölzernen Bänken liegenden Kleidungs- und Schmuckstücke erkannte sie, dass Mirwat noch nicht im Bad war. Beatrice hasste es, allein in die runde Halle mit den Wasserbecken und Massagebänken zu gehen. Sogar in Hamburg hatte sie schon seit dem Kindesalter Schwimmbäder und ähnliche Anstalten gemieden. Sie mochte sich einfach nicht vor anderen im Badeanzug zeigen. Und hier war sie sogar splitternackt. Jedes Mal, wenn sie alleine ins Bad ging, hatte sie den Eindruck, dass die anderen Frauen sie voller Verachtung anstarrten, dass ihre Gespräche augenblicklich verstummten und mindestens eine von ihnen hinter vorgehaltener Hand über sie lachte. Wenn hingegen Mirwat sie begleitete, fühlte sie sich sicher, und der Besuch des Bads machte ihr sogar Spaß. Die Freundin war in dieser Hinsicht eine starke Verbündete.
Natürlich lag es unter anderem an der herausragenden Stellung, die Mirwat wegen ihres Rangs als Lieblingsfrau des Emirs unter den Frauen innehatte, aber das war nicht der einzige Grund. Mirwat hatte ein geradezu unerschütterliches Selbstbewusstsein und eine Grazie, um die Beatrice sie nur beneiden konnte. Die junge Frau hatte nicht nur in den Augen der Orientalinnen eine perfekte Figur. Ihre langen, leicht gewellten Haare waren voll und glänzten wie poliertes Ebenholz. Nicht der kleinste Makel verunstaltete ihre glatte, leicht gebräunte Haut und gab Anlass zu Spott. Wenn sie lachte, strahlten und funkelten ihre dunklen Augen, und wenn sie den Mund öffnete, waren ihre weißen, ebenmäßigen Zähne zu sehen. Selbst für die Maßstäbe des 21. Jahrhunderts wäre Mirwat eine Schönheit gewesen – hier, in einem Zeitalter ohne die Möglichkeiten von Zahnkorrekturen, Fettabsaugung und Silikonimplantaten, war sie eine Göttin. Nicht einmal die hinterhältigsten Weiber wagten es, ihr zu nahe zu treten. Wo sie hinkam, zog sie sofort alle Blicke auf sich.
Beatrice beschloss im Vorraum auf Mirwat zu warten. Betont langsam zog sie sich ihre Kleider aus, verbarg den Schmuck sorgfältig zwischen den Falten ihres Gewands und betrachtete dabei eingehend die mit farbenfrohen Mosaiken geschmückten Wände. Sekireh hatte ihr erzählt, dass aus religiösen Gründen die bildliche Darstellung von Pflanzen, Tieren und Menschen nicht gern gesehen wurde. Mittlerweile konnte Beatrice nur noch den Einfallsreichtum der Künstler bewundern, die mit schier unerschöpflicher Fantasie immer neue Muster erfanden. Beatrice hatte im ganzen Palast, der vom Fußboden bis zur Decke mit Mosaiken und Stuckarbeiten verziert war, bisher noch keine zwei Ornamente entdeckt, die einander glichen.
Die Tür öffnete sich. Mirwat betrat sichtlich gut gelaunt den Raum.
»Guten Morgen, Beatrice. Warum bist du noch nicht im Bad?«
»Ich habe mir das Mosaik angesehen«, antwortete sie. »Ist dir schon mal aufgefallen, wie schön es ist?«
Mirwat, die sofort damit begonnen hatte, sich ihrer Kleider zu entledigen, warf einen kurzen Blick auf die Wand und zuckte gleichgültig mit den Schultern. »Du willst mir noch nicht etwa erzählen, dass du hier sitzt und die Wand anstarrst, während jenseits dieser Tür heißes Wasser und die geschickten Hände einer Dienerin auf dich warten?« Mirwat schüttelte lachend den Kopf. »Du bist wirklich merkwürdig, Beatrice. Ich kann es kaum erwarten, ins Bad zu kommen.«
Beatrice horchte auf. Ohne Frage liebte Mirwat das Bad und genoss die Stunden dort in vollen Zügen, aber heute war sie anders, irgendwie freudig erregt, so als würde sie eine Sensation erwarten.
»Ist etwas los, Mirwat?«, fragte Beatrice.
Doch Mirwat antwortete nicht, sondern nahm ihre zahlreichen Armreife ab und legte sie auf ihr Kleid.
»Kommst du jetzt endlich mit, oder willst du noch länger die Wände anstarren?«, neckte sie Beatrice und ging zur Tür, die ins Bad führte.
»Nein, nein, ich komme schon«, sagte Beatrice und erhob sich. Langsam und nachdenklich folgte sie der Freundin.
In der runden Halle bot sich das gewohnte Bild. In dem großen, mit heißem Wasser gefüllten Becken badeten bereits etwa ein halbes Dutzend Frauen, verschwommene, unwirkliche Gestalten in den aufsteigenden Dämpfen. Ein paar Frauen kühlten sich in dem kleineren Becken ab, einige saßen am Beckenrand und ließen ihre Beine in dem kühlen Wasser baumeln. Dienerinnen huschten zwischen den Marmorsäulen hin und her und reichten den Frauen saubere Tücher. Alle lachten über die Späße von Jambala, einer sehr jungen dunkelhäutigen Sklavin, die gerade eine Parodie der Eunuchen zum Besten gab. Das Mädchen hatte Talent; sie ahmte nicht nur Gesten und Mimik der Männer hervorragend nach, sondern auch die Stimmen und benutzte sogar ihre bevorzugten Redewendungen. Die Frauen kreischten vor Vergnügen.
Beatrice genoss das heiße Wasser, das ihr, wenn sie sich auf den Boden des Beckens setzte, bis knapp zu den Schultern reichte. Sie lehnte sich gegen die Beckenwand und schaute Jambala zu. Obwohl Mirwat es so eilig gehabt hatte, ins Bad zu kommen, schien sie heute wenig Lust zu haben, in das heiße Wasser zu steigen. Sie hatte sich ein Tuch um den Oberkörper wickeln lassen, saß am Beckenrand, trank ein Glas Granatapfelsaft und ließ ihre Beine ins Wasser hängen. Sie lachte so sehr über Jambala, dass sie beinahe in das Becken gefallen wäre, wenn Beatrice sie nicht festgehalten hätte.
Jambala begann gerade damit Jussuf nachzuahmen, als plötzlich alle wie auf ein geheimes Zeichen hin verstummten.
»Dann stimmt es also wirklich«, sagte Mirwat leise zu Beatrice. »Ich hätte nicht gedacht, dass sie es wagt, heute ins Bad zu kommen.«
Beatrice hatte sich nur auf Jambala konzentriert und sich gewundert, weshalb die Kleine ihre Späße nicht fortsetzte. Überrascht sah sie nun ebenfalls zur Tür, in deren Richtung mindestens dreißig Augenpaare starrten, und schnappte entsetzt nach Luft.
In der Tür stand Fatma. Aber wie sah sie aus! Ihre Arme, ihre Beine und ihr Bauch waren mit blutroten Striemen übersät, und ein hässlicher blauer Fleck von der Größe einer Männerfaust verunstaltete ihre rechte Gesichtshälfte.
Beatrice biss sich auf die Lippen. Sie schämte sich dafür, dass sie die arme, geschundene Frau ebenso anstarrte wie die anderen. Obwohl Fatma sich wie in einer Zirkusarena fühlen musste, ließ sie sich nichts davon anmerken. Trotzig erwiderte sie den Blick der anderen. Langsam, mit hoch erhobenem Kopf durchquerte sie die Halle und drehte den anderen ihren Rücken zu, der noch schlimmer aussah. Sie sagte kein Wort, ihr Gesicht war starr, als wäre es aus Stein gemeißelt. Dennoch schien es Beatrice, als würde ihr jeder Schritt Schmerzen bereiten. Schließlich ließ sich Fatma auf der am weitesten von der Tür entfernten Massagebank nieder, vorsichtig, langsam und umständlich.
»Die Ärmste!«, stieß Beatrice hervor und wollte aufspringen, um Fatma zu helfen, aber Mirwat ergriff ihren Arm und hielt sie zurück.
»Bleib hier«, sagte sie leise.
»Aber man muss ihr doch helfen«, widersprach Beatrice. »Ich bin Ärztin, Mirwat. Ich muss zu ihr. Vielleicht hat sie sich etwas gebrochen. Ich muss sie wenigstens untersuchen.«
»Das musst du nicht«, entgegnete Mirwat energisch. »Sie hat es verdient.«
Beatrice starrte ihre Freundin sprachlos an. Da war wieder diese Härte in Mirwats Stimme, diese Gehässigkeit.
»Du weißt etwas darüber?«, hakte Beatrice nach. Sie hatte den Verdacht, dass Mirwat sich aus diesem Grund so sehr auf das Bad gefreut hatte. »Was ist passiert? Wer oder was hat Fatma so zugerichtet?«
Mirwat hob eine Augenbraue, ihre Lippen umspielte ein schadenfrohes Lächeln.
»Fatma hat die letzte Nacht mit Nuh II. verbracht. Mir ist zu Ohren gekommen, dass er ein wenig verärgert gewesen sein soll.«
»Woher weißt du das?«
»Nirman hat es mir erzählt. Durch Zufall sah sie heute früh, wie Jussuf Fatma in ihr Gemach zurückgebracht hat. Sie war nicht einmal mehr in der Lage, alleine zu gehen. Er musste sie tragen.«
»Also durch Zufall hat Nirman das mit angesehen? Sie hat nicht etwa so lange gewartet, bis sie ...«
»Möchtest du auch, Beatrice?«, unterbrach Mirwat sie und hielt ihr eine Messingschale mit Datteln und Feigen unter die Nase.
Über den Rand der Schale trafen sich ihre Blicke. In Mirwats dunklen Augen lag eine boshafte Freude und Kälte, die Beatrice Schauer über den Rücken jagte. Sie wusste zwar, dass zwischen Fatma und Mirwat nicht gerade eine tiefe Freundschaft herrschte – Fatma hatte Mirwat immer noch nicht verziehen, dass diese ihren Platz als Lieblingsfrau des Emirs eingenommen hatte, und überschüttete die jüngere Frau daher oft mit Gemeinheiten –, aber dass der Hass auch bei Mirwat so tief ging, das hatte sie nicht gewusst. Nun, wahrscheinlich musste sie noch zwanzig Jahre hier im Harem leben, um dieses komplizierte Gesellschaftsgefüge zu begreifen.
Wortlos nahm Beatrice eine Dattel. Anscheinend fand es keine der anderen Frauen anstößig, dass Nuh II. es gewagt hatte, eine von ihnen zusammenzuschlagen. Lediglich ein paar Frauen schienen Fatma ehrlich zu bedauern, die meisten reagierten mit Spott oder ignorierten den Vorfall einfach, als hätte Fatma sich die blauen Flecke und blutunterlaufenen Striemen selbst zugefügt. Vielleicht hatte Mirwat Recht, vielleicht fehlte ihr wirklich das Verständnis für diese Situation. Aber Beatrice hoffte von ganzem Herzen, dass sie in diesem Punkt immer eine Fremde bleiben würde. Sie wollte nicht akzeptieren, dass ein Mann ungestraft eine Frau schlagen durfte. Beatrice legte die Dattel wieder auf die Schale zurück, ihr war der Appetit gründlich vergangen.
In der Zwischenzeit hatte Jambala wieder mit ihren Späßen angefangen. Die Frauen lachten und klatschten begeistert Beifall, als wäre nichts geschehen. Am lautesten aber lachte Mirwat. Beatrice warf einen Seitenblick auf die Freundin, der vor Lachen die Tränen über die Wangen liefen. Diese Frau wollte sie nicht als Feindin haben.
Als Beatrice und Mirwat das Bad wieder verließen, hatte die Sonne bereits ihren höchsten Stand erreicht. Durch die vergitterten Fenster des Harems konnten sie in den Garten sehen. Die Luft flimmerte über den Beeten, so dass Blumen und Bäume ständig ihre Formen zu verändern schienen. Nicht der leiseste Windhauch regte sich. Beatrice war froh, dass sie während der Mittagshitze im Palast bleiben konnte. Verglichen mit dem Brutofen da draußen war es hier drinnen herrlich kühl. Und nach der ausgedehnten Massage mit Minzöl im Bad fühlte sie sich erfrischt.
»Hast du für den heutigen Tag noch besondere Pläne?«, fragte Mirwat.
Beatrice zögerte einen Augenblick. Sie hatte zwar nichts vor, aber ihr lag immer noch die Sache mit Fatma im Magen, und sie wollte während der Mittagsruhe zu Fatma gehen und die arme Frau untersuchen. Vielleicht konnte sie ja doch etwas für sie tun. Aber davon brauchte Mirwat nichts zu wissen.
»Ich bin unheimlich müde und möchte mich gleich hinlegen«, antwortete Beatrice langsam. »Die Kleine hat mich heute ziemlich durchgeknetet. Ich fühle mich, als wäre eine ganze Karawane über mich hinweggetrampelt.«
Ein Lächeln glitt über Mirwats Gesicht. Wenn sie etwas von Beatrice' Zurückhaltung oder ihrer Lüge mitbekommen hatte, so ließ sie es sich wenigstens nicht anmerken.
»Schade, wir hätten zusammen einen Mokka trinken können.«
»Ja, wirklich schade«, erwiderte Beatrice. »Lass es uns auf morgen verschieben.«
»Dann also morgen. Schlaf gut, Beatrice.«
Mit gerunzelter Stirn sah Beatrice Mirwat nach, die mit beschwingten Schritten davonging. Ahnte Mirwat etwas? Und wenn schon. Wenn sie zu Fatma gehen wollte, so war es allein ihre Sache.
Beatrice war in ihrem Zimmer gerade dabei, sich umzukleiden, um sich gleich darauf zu Fatma zu begeben, als es leise an der Tür klopfte. Yasmina war nicht da, so dass sie selbst öffnete. Draußen stand Hannah, Sekirehs Dienerin.
»Verzeiht, Herrin, meine Herrin Sekireh schickt mich ...«
»Sekireh?« Beatrice drehte sich der Magen um. Ging es der alten Frau etwa schon so schlecht, dass sie nicht mehr selbst zu ihr kommen konnte? Hoffentlich nicht. Sie hatte immer noch keine geeigneten schmerzstillenden Mittel auftreiben können, um in der Lage zu sein, ihr Versprechen, Sekireh das Ende zu erleichtern, zu erfüllen. »Geht es ihr nicht gut?«
Über das vom Leben gezeichnete Gesicht der Dienerin glitt ein beinahe zärtliches Lächeln. Egal, was alle anderen im Palast von Sekireh halten mochten, Hannah war ihr ganz offensichtlich treu ergeben. Sie schien ihre Herrin, diese schwierige, unbequeme Frau, zu lieben.
»Meine Herrin ist zwar schwach, aber sie ist wohlauf – den Umständen entsprechend. Sie hat mir aufgetragen, Euch zu grüßen und Euch zu sagen, dass es so weit ist. Ich soll Euch jetzt zu Samira führen.«
In wenigen kurzen Sätzen erklärte Hannah der überraschten Beatrice, dass Sekireh alles für ihren Besuch bei Samira arrangiert hatte – die Dienerinnen waren alle beschäftigt, die Frauen und die Eunuchen schliefen. Mit welchen Mitteln Sekireh das gelungen war, darüber wollte Hannah nichts erzählen. Aber Beatrice vermutete, dass es sich um etwas handelte, das man in ihrer Zeit als »nicht ganz legal« bezeichnet hätte.
»Kommt, Herrin!«, forderte die Dienerin Beatrice auf. »Wir müssen uns beeilen, uns bleibt nicht viel Zeit.«
Hannah öffnete die Tür und schaute rechts und links den Gang hinunter. Es war niemand zu sehen.
»Leise«, flüsterte sie. »Wir dürfen niemanden wecken.«
Beatrice folgte Hannah durch zahllose menschenleere Flure, treppauf und treppab durch Teile des Palastes, die ihr unbekannt erschienen. Bereits nach kurzer Zeit hatte sie die Orientierung verloren. Sie stolperte fast über die Dienerin, als diese plötzlich vor einer mannsgroßen Vase stehen blieb.
Hannah sah sich hastig um, zog einen rostigen Schlüssel aus ihrem Ärmel und trat dann hinter die Vase. Erst in diesem Augenblick fiel Beatrice die kleine Tür auf, die von der Vase fast vollständig verborgen wurde und durch ein Mosaik aus farbigen Steinen getarnt war. Die Dienerin entfernte einen der kleinen Steine und steckte den Schlüssel in das zum Vorschein tretende Schloss.
Beatrice rechnete mit einem Quietschen der alten Scharniere und war überrascht, wie lautlos sich die Tür öffnen ließ. Offensichtlich wurde sie häufiger benutzt, als es auf den ersten Blick schien. Rasch gingen sie hindurch. Die Hitze auf der anderen Seite der Tür traf Beatrice wie ein Keulenschlag, und sie blieb wie angewurzelt auf der Schwelle stehen. Es mussten mindestens vierzig Grad sein, die ihr innerhalb von Sekunden den Schweiß auf die Stirn trieben. Von dieser Seite wurde die Tür von dichten Hibiskussträuchern verborgen, aber durch die Zweige hindurch konnte Beatrice den kleinen Teich sehen, an dem sie und Mirwat immer besonders gern saßen und der sich etwa eine halbe Wegstunde entfernt in einem entlegenen Winkel des Gartens befand. Auf welchen verschlungenen Wegen Hannah sie auch hierher geführt haben mochte, es musste eine gewaltige Abkürzung sein. Die Dienerin schloss sorgfältig die Tür hinter ihnen ab und hastete weiter.
Erst als Beatrice ihr folgte, erkannte sie den schmalen Weg, der sich durch dichtes Gebüsch an der Rückseite von Brunnen und Lauben entlangschlängelte. Oft kamen sie dabei an Stellen vorbei, die Beatrice kannte, weil sie dort jeden Abend spazieren ging. Dennoch war ihr der schmale Pfad bisher noch nie aufgefallen. Schon nach kurzer Zeit endete der Weg abrupt vor einer Mauer. Beatrice sah sich um und stellte fest, dass sie bei einem der entlegenen Brunnen im Garten angelangt waren. Es handelte sich um eine gemauerte, mit Marmor verkleidete treppenähnliche Konstruktion, über die eine Wasserkaskade in ein halbrundes Becken floss. Beatrice wischte sich mit dem Ärmel den Schweiß von der Stirn. Obwohl sie lediglich ein leichtes Kleid aus Seide trug, fühlte sie sich darin wie in einem Backofen.
»Hannah, warum ...?«
»Leise!«, flüsterte die Dienerin und legte beschwörend einen Finger auf die Lippen. »Es könnte uns jemand hören.«
Beatrice beobachtete, wie Hannah die Steine der Treppe abtastete. Was sollte das werden? Wozu ... Doch Beatrice fielen fast vor Staunen die Augen aus dem Kopf, als sich plötzlich auf den Druck von Hannahs Hand ein Teil der Wand vor ihnen bewegte und ein schmaler Spalt zu sehen war. Sie schüttelte ungläubig den Kopf. Spielten ihr die Sinne auf Grund der mörderischen Hitze einen Streich? Oder war sie doch in einem Märchen gelandet, einem Abenteuer aus Tausendundeine Nacht?
»Kommt mit, Herrin!«, flüsterte Hannah und verschwand in der Dunkelheit.
Als Beatrice sich durch den schmalen Spalt gezwängt hatte, wunderte sie sich erneut. Hinter der Tür befand sich eine kleine, kaum vier Quadratmeter große fensterlose Kammer. Hannah hatte bereits eine Öllampe angezündet, so dass Beatrice sich umsehen konnte, während die Dienerin einen langen hölzernen Hebel betätigte und sich der Spalt mit lautem Knirschen wieder schloss. Die Luft in der Kammer war abgestanden, aber der Boden war sauber, und anhand der Kratzspuren auf den steinernen Fliesen konnte Beatrice erkennen, dass die Geheimtür oft benutzt wurde.
»Wo sind wir hier? Und was ist das für eine Kammer?«
»Dieser Geheimweg ist nur wenigen im Palast bekannt. Er dient allein der Sicherheit des Emirs und seiner Blutsfamilie«, erklärte Hannah bereitwillig. »Wenn unser Gebieter Nuh II. ibn Mansur, der edle Sohn meiner Herrin, in Zeiten der Gefahr den Palast verlassen muss, kann er es auf diesem Wege unbemerkt tun.« Hannah deutete auf eine Nische. »Dort in der Truhe werden ein paar unauffällige Kleider, Geld und Nahrungsmittel aufbewahrt. Innerhalb kurzer Zeit kann Nuh II. ibn Mansur sich in einen unscheinbaren Bewohner Bucharas verwandeln und in den Gassen der Stadt entkommen. Wenn er dereinst, Allah möge gnädig sein, einen Thronfolger hat, wird Nuh II. dieses Wissen mit dessen Mutter teilen, die wiederum das Geheimnis an den Thronfolger weitergibt, sobald er alt genug ist. Auf diese Weise wird die Nachfolge der Familie geschützt.«
Beatrice nickte anerkennend. »Wie ich sehe, wurde an alles gedacht.«
Hannah zuckte mit den Schultern. »Wo Macht ist, gibt es auch Intrigen, Herrin. Der edle Sohn meiner Herrin muss ständig damit rechnen, dass man versucht ihn und seine Familie zu stürzen und die Macht an sich zu reißen«, sagte die Dienerin, als wäre dies eine Selbstverständlichkeit. Sie reichte Beatrice ein Bündel, das sie unter ihrem Kleid versteckt hatte. »Ich habe ein paar Kleider mitgebracht. Zieht Euch um, Herrin.«
Beatrice packte das Bündel aus. Es waren schäbige, mehrfach geflickte Kleider, die aussahen, als hätten sich bereits die Motten darüber hergemacht. Sie erinnerten sie an die, welche die Frauen im Kerker getragen hatten. Sie hob die Lumpen mit den Fingerspitzen hoch und betrachtete sie angeekelt.
»Bist du sicher, dass die nicht völlig verlaust sind oder dass ich mir die Lepra hole?«
»Seid unbesorgt, Herrin«, antwortete Hannah. »Die Kleider sehen zwar ärmlich aus, aber sie sind sauber. Auch meine Herrin trägt diese Kleider, wenn sie Samira aufsuchen will. So angezogen wird niemand uns in den Gassen Bucharas erkennen.«
Widerwillig schlüpfte Beatrice in die zerlumpten Kleider. Als sie endlich beide fertig waren, drückte Hannah ihr einen flachen Weidenkorb in die Hand und nahm selbst einen. Dann betätigte sie einen zweiten Hebel. Ein neuer Spalt tauchte in der Wand auf, und Tageslicht fiel in die kleine Kammer.
»Geht hinaus, Herrin«, sagte Hannah zu Beatrice und löschte die Lampe. Beatrice machte einen Schritt nach draußen und befand sich inmitten einer Baumgruppe. Die Sonne stand so hoch am Himmel, dass die großen Bäume nur spärliche Schatten warfen. In Beatrices Rücken erhob sich die Palastmauer, vor ihr lag ein kleiner, mit ausgetretenen staubigen Steinen gepflasterter Platz. In der Mitte des Platzes war eine zum Schutz gegen die Hitze mit Brettern abgedeckte Zisterne, und schäbige Häuser mit geschlossenen schiefen Fensterläden standen um den Brunnen herum. Weit und breit war kein Mensch zu sehen, nur eine graue Katze schlich träge über den Platz und verschwand schließlich in einem Spalt unter einer Tür.
»Wo sind wir, Hannah?«, fragte Beatrice die Dienerin, die gerade die Geheimtür wieder schloss.
»Mitten in Buchara«, antwortete sie und zog ihren schmutzigen Schleier fester über das Gesicht. »Nehmt Euren Korb, Herrin. Jeder, der uns sieht, wird glauben, wir seien zwei arme Weiber, die Brot auf dem Markt verkauft haben und nun auf dem Weg nach Hause sind.«
Zügig überquerten sie den Platz und gingen eine der schmalen Gassen entlang. Zwischen den Häusern war es ein wenig kühler, und dennoch lief Beatrice der Schweiß über den Rücken. Schon nach ein paar Schritten klebte ihr das Untergewand am Körper, und sie war heilfroh, dass sie nicht ihre eigenen Schleier trug, sondern diese Lumpen aus leichter, billiger Baumwolle. In den lichtundurchlässigen dicken Stoffen, welche die Haremsfrauen anhatten, wenn sie in der Öffentlichkeit unterwegs waren, wäre sie bei dieser mörderischen Hitze vermutlich langsam erstickt. Dennoch genoss sie diesen »Spaziergang« in vollen Zügen und saugte die Eindrücke in sich auf.
Wegen der Mittagshitze begegneten ihnen nur wenig Menschen. In den Hauseingängen saßen zuweilen ältere Männer, die sich unterhielten und dabei Kürbiskerne kauten. Hin und wieder kamen ihnen Männer und Frauen mit Körben entgegen, in denen sich Wäsche, Brot, Früchte oder Brennholz befanden. Zwei kleine Jungen trieben ein paar magere, staubige Ziegen vor sich her – Alltagsleben in einer mittelalterlichen, arabischen Stadt.
Beatrice konnte sich nicht mehr daran erinnern, wann sie das letzte Mal den Palast verlassen hatte. Einmal hatte sie mit Mirwat und fünf anderen Frauen in Begleitung von fünf Eunuchen einen kurzen Bummel durch die Gassen von Buchara machen dürfen. Aber damals waren sie tief verschleiert gewesen, und der Emir hatte zuvor die beiden Straßen, auf denen die Frauen unterwegs waren, von den Palastwachen absperren lassen. Mit Ausnahme der Händler, die ihnen überaus zuvorkommend ihre Waren angeboten hatten, hatten sie keine Menschenseele getroffen. Es war alles gestellt und unwirklich gewesen. Beatrice nahm an, dass auch die Händler nur Statisten in dieser Inszenierung waren. Vermutlich waren die Männer in Wirklichkeit ebenfalls Eunuchen oder Angehörige von Nuhs Leibgarde. Dies hier hingegen war das wahre Leben. Hannah und Beatrice waren gekleidet wie die Menschen, die hier lebten, und sie gingen durch die schmalen Gassen, ohne dass jemand Notiz von ihnen nahm.
Nuh II. sollte eigentlich davon erfahren, dachte Beatrice. Vielleicht würde er daraus lernen und seinen Frauen mehr Freiheit einräumen.
Je weiter Hannah und Beatrice den Palast hinter sich ließen, umso ärmlicher wurde die Gegend, bis sie schließlich ein Viertel erreichten, das man selbst mit viel Wohlwollen nur als Slum bezeichnen konnte. Die Häuser waren alt und baufällig, Putz und Mörtel bröckelten von den Mauern, Fensterläden und Türen waren oft nur notdürftig mit Brettern geflickt oder fehlten ganz. Die Gassen waren düster und so eng, dass Beatrice beim Gehen mit beiden Schultern rechts und links gegen die Häuser stieß. Die Straßen waren hier nicht gepflastert, sondern bestanden aus festgestampfter gelblicher Erde, die dort, wo Frauen ihre Waschschüsseln oder Töpfe entleert hatten, zu einem glitschigen Schlamm aufgeweicht war. Es stank nach Urin, Kot und verfaulenden Abfällen. In den Hauseingängen lagen in schmutzige Lumpen gehüllte Gestalten und schliefen, ohne sich, wie es schien, von den Fliegen stören zu lassen, die sich auf ihnen tummelten. Beatrice sah einen Mann, dessen Beine knapp oberhalb der Knie amputiert waren. Er bewegte sich mühsam auf den beiden mit Lappen umwickelten Stümpfen vorwärts und stützte sich auf eine notdürftig aus Stöcken zusammengezimmerte Krücke. Als Hannah und Beatrice an ihm vorbeikamen, streckte er ihnen seine Hände entgegen und flehte um Brot und Geld. Beatrice wandte sich beschämt ab. Ihr waren die Kleider, die sie jetzt trug, ärmlich erschienen. In den Augen dieses Mannes waren sie trotzdem zwei wohlhabende Frauen.
Eine Häuserecke weiter stritten sich zwei magere Kinder mit einem struppigen Hund um etwas, das der Hund wohl in einem stinkenden Abfallhaufen gefunden hatte und von dem Beatrice vermutete, dass es essbar war. Die beiden Jungen versuchten mit Holzknüppeln den Hund zu vertreiben, aber das Tier, dem bereits aus früheren Kämpfen ein Ohr und ein Auge fehlten, verteidigte verbissen seine Beute. Knurrend und zähnefletschend sprang er die beiden Jungen an. Erst als Beatrice und Mirwat sich ihnen näherten, stoben alle drei erschrocken davon und ließen das Streitobjekt zurück – einen halb verfaulten Schafskopf.
Beatrice wurde übel. Sie hatte schon so lange den Luxus des Palastlebens genossen, dass sie vergessen hatte, dass es außerhalb der Palastmauern notgedrungen auch arme Menschen gab. Während sie beinahe zu jeder Tageszeit von den feinsten und köstlichsten Speisen so viel essen konnte, wie sie wollte, balgten sich hier Kinder mit einem Hund um ungenießbare Abfälle. Doch Hannah ließ ihr keine Zeit, lange darüber nachzudenken. Die Dienerin zupfte ungeduldig an ihrem Ärmel.
»Kommt, Herrin«, flüsterte Hannah, so dass die Kinder, wo sie sich auch verstecken mochten, sie nicht hören konnten. »Wir sind gleich da, und die Zeit drängt.«
Als Beatrice der Dienerin in einen schmalen dunklen Durchgang folgte, hörte sie, wie hinter ihnen die Kinder und der Hund wieder aus ihren Verstecken krochen und ihren Kampf um den Schafskopf fortsetzten.
Hannah und Beatrice bogen um eine Ecke und betraten eine besonders schmutzige Gasse. Schmale, völlig verwahrloste Häuser neigten sich den beiden Frauen entgegen, als wollten sie sie unter sich begraben. In einigen der dunklen dicht an dicht liegenden Hauseingängen standen Frauen. Ohne Hannah und Beatrice zu beachten, unterhielten sie sich miteinander und ließen dabei den billigen Blechschmuck an ihren Hand- und Fußgelenken klimpern. Ausgerechnet in dieser Gasse blieb Hannah stehen.
»Hier ist es«, sagte sie und deutete auf den Eingang. »Wir sind am Ziel. Hier wohnt Samira.«
Es war das baufälligste Haus, das Beatrice jemals gesehen hatte. Die Steine schienen nicht mehr vom Mörtel gehalten zu werden, sondern nur noch lose aufeinander zu liegen. Türen und Fensterläden gab es nicht, stattdessen hatte jemand verdreckte Laken und alte, von Motten zerfressene Teppiche vor die schmalen Fensteröffnungen gehängt.
»Hierher kommt Sekireh?«, fragte Beatrice ungläubig.
»Gewiss, Herrin«, antwortete Hannah mit einem Lächeln. »Mindestens einmal im Monat. Und ich begleite sie jedes Mal seit mittlerweile über dreißig Jahren.«
Hannah hob die schmutzige Decke hoch, hinter der sich eine Tür befand, und ging hinein. Nur zögernd folgte ihr Beatrice. Der Gestank, der ihnen im Inneren des Hauses entgegenschlug, war kaum zu ertragen. Es war eine ekelhafte Mischung aus allen nur vorstellbaren Ausdünstungen des menschlichen Körpers, verfaulenden Abfällen, schimmelndem Holz und verwesendem Aas.
Wenn ich mir die Pest hole, dann hier, dachte Beatrice und zog schaudernd die Schultern zusammen.
Langsam gewöhnten sich ihre Augen an das Dämmerlicht, und Beatrice erkannte, dass sie sich in einem engen Flur befanden.
»Wo ist denn Samira?«, fragte sie Hannah und begann unwillkürlich zu flüstern aus Angst, jedes laute Geräusch könnte die schiefen Mauern zum Einsturz bringen.
»Habt Geduld, Herrin«, flüsterte Hannah zurück. »Schon bald werdet Ihr sie sehen.«
Sie führte Beatrice quer durch das Haus, vorbei an Räumen, aus denen Kindergeschrei und Frauenstimmen drangen. Dabei bewegte sie sich so sicher durch das Halbdunkel, als ginge sie hier täglich ein und aus. Schließlich blieben sie in einem schmalen Flur stehen, der blind vor einem Teppich endete. Hannah klopfte dreimal mit einem Stock, der an der Wand lehnte, auf den Boden. Während sie warteten, betrachtete Beatrice bewundernd den alten verschlissenen Teppich, der die ganze Wand ausfüllte. Trotz seines jämmerlichen Zustands hatten die Farben nichts von ihrer Leuchtkraft eingebüßt. Das Bild auf dem Teppich stellte den Baum des Lebens dar, ein beliebtes Symbol im arabischen Raum. Ungewöhnlich war nur, dass der Künstler entgegen der muslimischen Tradition den Baum detailgetreu abgebildet hatte. Die Vögel in seinen Zweigen sahen so lebensecht aus, dass Beatrice förmlich darauf wartete, ihr Gezwitscher zu hören oder sie davonfliegen zu sehen. Sie konnte sich nicht vorstellen, wie das kostbare Stück in dieses verfallene Haus gekommen war. Und weshalb es immer noch hier hing, ohne dass einer der armen Teufel, die hier lebten, es zu Geld gemacht hatte.
Der Teppich bewegte sich, und eine etwa dreißigjährige Frau trat aus dem dahinter verborgenen Raum. Ihre Kleidung war sauber und sah teuer aus, eine seltsame Überraschung zwischen dem Gestank und Verfall um sie herum. Allerdings passten die einzelnen Kleidungsstücke weder in der Farbe noch in Stoff oder Schnitt zueinander, so als hätte die Frau sie irgendwo gefunden. Zahlreiche goldene Armreife schmückten ihre Hand- und Fußgelenke und gaben ihr trotz ihrer Korpulenz die Ausstrahlung einer Tänzerin. Oder war sie etwa eine Zigeunerin? Mit mürrischem Gesicht taxierte sie Hannah und Beatrice von Kopf bis Fuß.
»Was wollt ihr?«, fragte sie und gab sich dabei keine große Mühe, freundlich zu sein.
»Wir wollen Samira sprechen«, antwortete Hannah überraschend forsch.
Belustigt bemerkte Beatrice, dass die Dienerin bewusst oder unbewusst Sekirehs Ton nachahmte, wenn sie anderen Befehle erteilte. Aber die Frau vor ihnen ließ sich nicht so leicht einschüchtern.
»Samira will aber nicht mit euch sprechen«, entgegnete sie barsch. »Und nun packt euch!«
»Samira erwartet uns«, widersprach Hannah rasch. »Außerdem werden wir Samiras Dienste selbstverständlich entlohnen – und deine natürlich auch.«
Die Frau runzelte die Stirn und blickte noch finsterer drein als zuvor. »Und womit?«
Mit dem siegessicheren Lächeln eines Kartenspielers, der seinen besten Trumpf auf den Tisch legte, zog Hannah einen kleinen ledernen Beutel unter ihrem Gewand hervor.
»Sieh selbst!«
Geschickt fing die Frau den Beutel auf, öffnete ihn und ließ den Inhalt auf ihre Hand gleiten. Trotz des trüben Lichts glänzten die goldenen Münzen auf ihrer Handfläche. Sie stieß ein zufriedenes Grunzen aus.
»Ich werde sehen, was ich für euch tun kann. Wartet hier.«
Die Frau verschwand wieder hinter dem Teppich.
»Wer ist diese Frau, Hannah?«, fragte Beatrice. »Wieso können wir nicht einfach zu Samira gehen, wenn wir mit ihr sprechen wollen? Muss Sekireh auch jedes Mal warten, bis sie vorgelassen wird? Und weshalb ...«
»Seid bitte leise, Herrin«, wisperte Hannah ängstlich. »Die beiden können uns bestimmt hören.«
»Und wenn schon, was soll uns diese Samira anhaben können?«
»Samira hat große Macht, Herrin. Man munkelt, dass sogar der edle Nuh II. ihren Rat sucht. Natürlich kommt er nicht selbst, sondern schickt eine Frau ...« Hannah machte eine Pause. »Es ist nicht gut, wenn man Samira verärgert.«
Seufzend fügte sich Beatrice. Was blieb ihr auch anderes übrig? Also standen sie schweigend nebeneinander in dem schmalen düsteren Flur. Sie mussten lange warten, und Beatrice hatte ausreichend Gelegenheit, den Schmutz und den Verfall um sich herum zu betrachten. Sie entdeckte zwei Löcher in einer Wand, groß genug, um Mäusen oder sogar Ratten Unterschlupf zu gewähren. Und tatsächlich ragte aus einem der Löcher ein dicker unbehaarter Schwanz hervor, der plötzlich in der dunklen Öffnung verschwand. Ratten! Beatrice schüttelte sich. Sie mochte diese Nagetiere nicht. Selbst beim Anblick der eigentlich niedlichen weißen Ratten in den Laboren und Zoohandlungen hatte sie nie vergessen können, dass ihre Verwandten die Überträger widerlicher Krankheiten waren, die die Menschen des Mittelalters immer wieder heimgesucht hatten. Eine Horde Kinder jagten sich im Stockwerk über ihnen laut lärmend über die engen dunklen Flure, so dass Staub und Putz von der Decke rieselten. Wie viele Menschen mochten allein in diesem Haus leben? Fünfzig, oder noch mehr?
Wenn man sich die Lebensbedingungen der Menschen hier, den Schmutz, die Enge und die schlechte Ernährung vor Augen führte, konnte man nachvollziehen, weshalb sich Seuchen in den Städten des Mittelalters in rasender Geschwindigkeit auszubreiten vermochten. Ein Pestkranker in einem dieser Häuser reichte aus, um Buchara in ein Leichenschauhaus zu verwandeln und mehr als die Hälfte der Bevölkerung hinwegzuraffen. Beatrice erschauerte. Hoffentlich würde sie nie den Ausbruch einer Seuche miterleben. Der Gedanke, Krankheiten ausgeliefert zu sein, die im 21. Jahrhundert als ausgerottet galten oder wenigstens therapierbar waren, erschien unerträglich. Aber war sie wirklich so hilflos? Natürlich hatte sie hier keine moderne medizinische Ausrüstung, aber sie hatte ihr Wissen. Und mit diesem Wissen konnte sie vielleicht besser helfen als Ärzte wie dieser Ali, die über die Ursachen und Hintergründe vieler Erkrankungen nichts oder nur sehr wenig wussten. Bei diesem Gedanken richtete Beatrice sich kerzengerade auf, ihr Herz begann schneller zu schlagen. Weshalb nur hatte sie noch nicht daran gedacht, die heimischen Kräuter und Arzneien zu studieren, um ihre Wirkungen kennen zu lernen? Vielleicht ließen sich einige von ihnen als Ersatz für moderne Medikamente verwenden. Außerdem konnte sie die Menschen über Risiken aufklären und so dem Ausbruch von Seuchen vorbeugen. Weshalb nur war ihr die Idee nicht viel eher gekommen? Das war eine sinnvolle Aufgabe, die sie restlos ausfüllen würde. Vielleicht gelang es ihr sogar, Nuh II. davon zu überzeugen ...
»Kommt jetzt, ihr zwei!« Die Stimme der dicken Frau riss Beatrice aus ihren Gedanken. »Samira ist gewillt, euch anzuhören.«
»Was, ich soll auch mitkommen?« Hannahs Augen weiteten sich vor Entsetzen.
»Ja, du auch.«
»Aber ich ...«
»Samira will euch beide sehen. Oder hast du etwa vor, Samiras Wunsch nicht nachzukommen?«
Die drohende Stimme der Frau schien die arme Hannah völlig einzuschüchtern. Beatrice war nicht ganz klar, wovor Hannah sich eigentlich fürchtete, aber dass sie Angst hatte, war unverkennbar. Die arme Frau zitterte plötzlich am ganzen Körper.
»Du hast Samira noch nie zuvor gesehen, nicht wahr?«, fragte Beatrice leise, während sie der Frau unter dem Teppich hindurch einen engen, düsteren Gang entlang folgten.
Hannah schüttelte den Kopf. »Nein, Herrin. Jedes Mal, wenn meine Herrin Samira aufsucht, lässt sie mich vor dem Teppich warten.«
»Hab keine Angst«, sagte Beatrice und ergriff die Hand der Dienerin. »Sekireh würde sich wohl kaum so oft an diese Samira wenden, wenn die Frau gefährlich wäre. Glaube mir, sie wird uns schon nicht verspeisen.«
Doch als sie wenige Augenblicke später hinter der dicken Frau einen Raum betrat und zum ersten Mal Samira sah, war Beatrice sich dessen nicht mehr so sicher.
Vor ihren Augen lag eine Szenerie wie aus einem Albtraum – ein niedriger fensterloser Raum mit rußgeschwärzten Wänden, der sie unwillkürlich an eine Grotte erinnerte, an eine unheimliche Höhle, die nur einer Hexe als Unterschlupf dienen konnte. Beatrice blieb wie angewurzelt auf der Schwelle stehen und starrte wie hypnotisiert die Gestalt an, die auf einem Berg von Kissen an der Stirnseite des Raums thronte. Brennende Kerzen, deren Wachs auf den Boden tropfte, Räucherschalen, seltsame archaisch anmutende Statuen, Körbe und Gefäße standen um sie herum, als wäre der Boden zu ihren Füßen ein Altar, auf dem ihr die Anhänger eines düsteren geheimnisvollen Kults Opfergaben darbrachten. Dabei war die Frau – Beatrice nahm wenigstens an, dass es sich um eine Frau handelte – unbeschreiblich hässlich. Ihr Körper war schwammig und aufgedunsen, eine unförmige Masse Haut, Fett und Fleisch ohne jegliche Konturen. Der kahl geschorene Kopf war mit dunklen Altersflecken übersät. Die Frau saß dort auf ihren Kissen wie eine fette, schleimige Kröte oder wie eine Spinne in ihrem Netz, gemästet von ungezählten Opfern, die sich unvorsichtigerweise in ihre Nähe gewagt hatten. Beatrice war drauf und dran, sich einfach umzudrehen und wieder zu gehen. War das wirklich Sekirehs Ernst? Hatte Hannah sie deshalb durch halb Buchara geschleift? War das etwa Samira, die so viel Weisheit besitzen sollte, dass sogar die Herrscherfamilie um ihren Rat bat?
»Du kannst deinen Augen trauen, ich bin Samira. Wissen und Weisheit lassen sich nur schwer mit dem ersten Blick entdecken«, sagte die Frau, als könnte sie Beatrices Gedanken lesen. »Nun komm schon her, dann redet es sich leichter.«
Die Stimme der Frau war tief und voll und umschmeichelte Beatrice wie Samt. Ohne länger nachzudenken, trat sie näher und erschrak im nächsten Augenblick über sich selbst. Irgendein Zauber ging von dieser Stimme aus, dem Beatrice nicht widerstehen konnte. Wahrscheinlich hätte diese Stimme sie in den sicheren Tod schicken können, und sie wäre ihr willenlos gefolgt.
»Siehst du, es ist doch gar nicht so schwer«, sagte Samira und lachte.
Wenn irgendein Lachen auf dieser Welt in der Lage war, einen Menschen zu umarmen, so war es dieses Lachen. Von einer Sekunde zur nächsten fühlte sich Beatrice sicher und geborgen. Hatte sie wirklich diese Frau hässlich und abstoßend gefunden? Hatte sie allen Ernstes geglaubt, diese Frau würde sie in eine Falle locken wollen? Sie war wunderschön, auf eine bizarre, ungewöhnliche Weise zwar, aber schön. Sie war eine gütige Mutter, eine liebevolle Schwester, eine verständnisvolle Freundin ...
»Wie ich sehe, verlierst du allmählich deine Scheu«, sagte Samira, lachte wieder und schwemmte mit diesem Lachen Beatrices letzte Zweifel fort, die sich ohnehin nur noch zaghaft tief in ihrem Inneren geregt hatten. »Nun kommt schon und setzt euch.«
Auch Hannah schien unter dem Zauber der Stimme ihre Furcht vergessen zu haben. Gehorsam und vertrauensvoll wie zwei Kinder ließen sich Hannah und Beatrice auf den Kissen nieder, die zu Samiras Füßen lagen.
»Seht ihr, so ist es doch viel besser. Und nun erzählt mir, weshalb ihr den weiten Weg vom Palast zu mir unternommen habt.«
Hannah öffnete überrascht den Mund. »Aber woher ...?«
»Ich kenne dich, du kommst oft an diesen Ort«, sagte Samira zu Hannah und lachte wieder. »Seit über dreißig Jahren begleitest du Sekireh, die Mutter des edlen Nuh II. ibn Mansur, auf ihrem Weg zu mir. Also lasst diese Heimlichtuerei, ihr macht euch nur lächerlich. Wie heißt ihr?«
»Ich bin Hannah, und Sekireh ist in der Tat meine Herrin«, antwortete Hannah stotternd und wurde dunkelrot im Gesicht. »Und dies ist Beatrice.«
»Beatrice«, wiederholte Samira und nickte zufrieden. »Die Frau aus dem barbarischen Norden. Jene Frau, von der man erzählt, dass sie eine Heilkundige sei, die mit ihrer Kunst sogar der Lieblingsfrau des Emirs das Leben gerettet hat.« Sie lächelte freundlich. »Es freut mich, dich endlich bei mir zu sehen. Ich habe schon lange auf dich gewartet.«
»Du hast auf mich gewartet?«, platzte Beatrice überrascht heraus. »Aber wieso ... woher ...?«
Samira winkte lächelnd ab. »Dies ist eine lange Geschichte, meine Tochter, die ich dir vielleicht noch erzählen werde – später. Allein. Aber ich denke, dass ich dir helfen kann.« Sie klatschte zweimal in die Hände, und die jüngere Frau erschien wieder.
»Ja?«
»Bring Hannah hinaus, Mahtab«, befahl sie. »Ich möchte mit der edlen Dame allein sprechen.«
Hannah sprang erfreut auf, als hätte sie insgeheim gehofft, den Raum verlassen zu dürfen. Doch schon im nächsten Augenblick zeichnete sich deutlich das schlechte Gewissen auf ihrem Gesicht ab, und Beatrice konnte förmlich sehen, wie ihre Angst vor Samira gegen ihre Verantwortung für Beatrice kämpfte.
»Geh schon, Hanna«, sagte Beatrice und lächelte der Dienerin aufmunternd zu. »Ich muss mit Samira ein Gespräch unter vier Augen führen. Du kannst mir dabei nicht behilflich sein.«
Hannah warf einen scheuen Blick auf Samira. »Herrin, seid Ihr sicher?«
»Ja.«
Es gelang Hannah nur schwer, ihre Erleichterung zu verbergen.
»Gut, Herrin, wie Ihr wollt. Aber wenn Ihr mich braucht, so ruft nach mir, ich werde dann sofort ...«
»Ich weiß. Danke!«
Beatrice sah der Dienerin lächelnd nach. Vermutlich würde Hannah viel zu viel Angst haben, um ihr zu Hilfe zu eilen, selbst wenn sie wie am Spieß schreien sollte.
Als sie sich Samira wieder zuwandte, war der rätselhafte Zauber verflogen, der bisher über allem gelegen hatte. Sie fühlte sich zwar benommen, als würde sie aus einer Narkose oder einem Tiefschlaf erwachen, aber sie nahm die Dinge so wahr, wie sie wirklich waren. Sie sah wieder die alten, baufälligen Mauern, in denen es vor Ratten nur so wimmelte, der Boden starrte vor Dreck, und Samira war nichts weiter als eine dicke alte Frau mit einem Mund voller schiefer brauner Zähne. Die Situation war grotesk. Warum sollte sie sich ausgerechnet dieser fetten, unförmigen Samira anvertrauen?
»Weil Samira von Dingen weiß, die sonst niemand in Buchara kennt.«
Erschrocken starrte Beatrice die alte Frau an. Wieso hatte sie ihr geantwortet? Hatte sie etwa laut gedacht?
»Glaub, woran du glauben willst, Beatrice«, fuhr Samira ungerührt fort. »Vielleicht hilft es dir, mir zu vertrauen.«
Beatrice dachte kurz nach. Warum eigentlich nicht? Warum sollte sie nicht Samira alles anvertrauen? Es wäre sicherlich eine Erleichterung, endlich jemandem alles zu erzählen, diese ganze verrückte Geschichte. Was hatte sie schon zu verlieren?
»Du hast nichts zu verlieren, Beatrice«, sagte Samira mit der sanften Stimme einer Mutter, die ein verängstigtes Kind tröstet. »Aber erzähle mir jetzt, weshalb du hier bist. Ich kann nicht alles erraten.«
»Das ist es ja eben!«, platzte Beatrice verblüfft heraus. Die Alte hatte schon wieder den Nagel auf den Kopf getroffen. Wahrscheinlich war es nichts weiter als ein Trick, aber er funktionierte. Gegen ihren Willen war Beatrice beeindruckt. »Ich weiß eben nicht, weshalb ich hier bin.«
Und stockend erzählte sie Samira alles von Anfang an. Von der alten Frau Alizadeh, von ihrem seltsamen Erlebnis in der Schleuse, ihrem Erwachen im Kerker des Sklavenhändlers bis hin zu dem Zeitpunkt, als sie durch die Landkarte herausgefunden hatte, dass sie sich in einem anderen Zeitalter befand.
Schweigend und mit halb geschlossenen Augen hörte Samira zu. Dennoch wurde Beatrice das Gefühl nicht los, dass die Alte sie beobachtete, sie taxierte, sie mit ihren dunklen Augen durchbohrte und bis auf den Grund ihrer Seele vordrang. Beatrice wurde von Sekunde zu Sekunde nervöser. Es wäre ihr lieber gewesen, Samira hätte ihr offen in die Augen gesehen. Sie fühlte sich wie in ihrer Prüfung zum dritten Staatsexamen. Als sie schließlich ihren Bericht beendet hatte, war sie außer Atem. Unruhig knetete sie ihre schweißnassen Hände, wobei sich ihr Nacken noch mehr verspannte.
Samira schwieg eine Weile. »Zeige mir den Stein«, sagte sie schließlich.
Gehorsam holte Beatrice den Stein aus einer geheimen Tasche hervor und legte ihn in Samiras große fleischige Hand. Die Alte schloss ihre Hand um den Stein, befühlte ihn, betrachtete ihn eingehend und hob ihn schließlich gegen das Licht einer Kerze.
»Es ist gut, dass du zu mir gekommen bist«, sagte sie und nickte langsam. »Es gibt nicht viele Menschen hier in Buchara, die von diesem Stein wissen. Vielleicht bin ich sogar die Einzige ...«
»Dann hat es tatsächlich etwas mit diesem Stein zu tun?«, fragte Beatrice und vergaß für einen Augenblick sogar ihre Skepsis. »Ich dachte schon, dass ich mir das nur einbilde. Was ist das für ein Stein? Woher kommt er? Wie hat er mich hierher gebracht? Und kann er mich auch wieder zurückbringen? Was muss ich tun, um ...«
»Geduld, Geduld!«, unterbrach Samira Beatrice mit einem geheimnisvollen Lächeln. »Eins nach dem anderen. Zuerst muss ich den Stein prüfen. Dann kann ich vielleicht deine Fragen beantworten.«
Samira zündete ein paar Kohlestückchen in einer Messingschale an, riss einige Blätter von einem Kräuterbündel ab, das von der Decke herabhing, zerbröselte sie in der Hand und warf sie auf die Glut. Die trockenen Kräuter fingen sofort an zu brennen, und Samira blies die Flamme aus. Dichter graublauer Rauch stieg aus der Schale auf und erfüllte den Raum mit einem schweren, etwas süßlichen Duft.
»Was für Kräuter sind das?«, fragte Beatrice interessiert und sog prüfend die Luft ein. Irgendwie kam ihr der Geruch bekannt vor. Vor einiger Zeit hatte sie einen Patienten in dessen Zimmer beim Kiffen erwischt. Dieser Geruch hier hatte eine entfernte Ähnlichkeit damit. Er erinnerte an Marihuana. »Ist das etwa ...«
»Schscht!« Samira legte einen Finger auf die Lippen. »Störe mich jetzt nicht. Sage kein Wort, bis ich dich dazu auffordere.«
Die Alte beugte sich tief über die Schale und inhalierte den Rauch.
Aha, das ist also tatsächlich eine Droge, dachte Beatrice.
Offensichtlich sollte das hier eine Séance oder etwas Vergleichbares werden. Beatrice glaubte nicht ans Pendeln, Tischerücken, mediale Fähigkeiten, Geister und Ähnliches. Diese Dinge gehörten höchstens in düstere Kriminalromane oder Horrorgeschichten. Es waren die richtigen Zutaten, um dem Leser einen wohligen Schauer über den Rücken rieseln zu lassen. Allerdings musste sie sich eingestehen, dass sie bis vor kurzem auch nicht an die Möglichkeit von Zeitreisen geglaubt hatte. Vielleicht war an diesem ganzen Humbug doch etwas Wahres dran? Eine gewisse Neugier konnte sie nicht leugnen. Also hielt Beatrice den Mund und wartete gespannt darauf, was als Nächstes passieren würde.
Mit der Zeit breitete sich der betäubende Rauch im ganzen Raum aus. Beatrice fühlte eine wohlige Wärme in sich aufsteigen. Ihr Kopf und ihre Glieder verloren ihr Gewicht, den Lehmboden unter sich spürte sie kaum noch. So ähnlich hatte sie sich immer die Schwerelosigkeit vorgestellt. Sie fühlte sich federleicht, und als sie auf ihre im Schoß liegenden Hände blickte, glaubte sie durch ihren Körper hindurch auf den Boden sehen zu können. Vielleicht war sie doch nur ein Geist oder ein Traumgebilde. Vielleicht war sie gar nicht hier, in diesem Raum, in dieser Zeit, vielleicht war sie nichts anderes als ein Gedanke. Ihr Körper verlor allmählich seine Konturen, aber sie war nicht entsetzt, sie hatte keine Angst. Im Gegenteil, sie fühlte sich so leicht, so frei, so unabhängig von allem Materiellen. Sie war reiner Geist.
Samira hob ihren Kopf und begann mit tiefer dunkler Stimme in einer fremden Sprache zu singen. Ihre glasigen Augen waren auf Beatrice gerichtet. Sie sah durch sie hindurch, und dennoch hatte Beatrice den Eindruck, dass dieser Blick sie zusammenhielt, verhinderte, dass sie sich mit dem Rauch vermischte und irgendwo in den Sphären des Unstofflichen verlor. Sie war nicht sicher, ob sie sich darüber freute oder ärgerte. Doch das war unwichtig. Sie fühlte sich gut. Und dieses Gefühl sollte nicht durch negative Schwingungen beeinflusst werden. Samira sang weiter, und Beatrice begann sich im Rhythmus dieses Liedes zu bewegen. Wie eine Kobra wiegte sie den Oberkörper hin und her und schloss dabei die Augen. Hinter ihren Lidern bekamen die Töne Farben – warme, satte Farben voller Leben und Leidenschaft. Die Farben schienen jedoch ihren Ursprung nicht in Samiras Stimme zu haben, sondern aus dem Stein hervorzusprudeln wie frisches Wasser aus einer klaren, reinen Quelle. Beatrice öffnete die Augen und wurde fast geblendet von dem gleißenden Blau, das der Stein auf Samiras Handfläche ausstrahlte.
Die Alte zog einen Korb heran und hob den Deckel. Eine Woge von Dunkelheit stieg aus dessen Inneren auf. Beatrice bekam unerklärliche Angst. Eine eiskalte Hand schien ihre Kehle zu umklammern und langsam zuzudrücken. Sie keuchte und griff sich instinktiv an den Hals. In diesem Augenblick warf Samira den Stein in den Korb. Wie in Zeitlupe sah Beatrice die Kurve, die der Stein in der Luft beschrieb. Sie wollte aufschreien und ihn auffangen. Dieser wunderschöne, vollkommene Stein sollte nicht in die Finsternis stürzen. Sie musste das verhindern, um jeden Preis. Aber etwas hielt sie zurück und lähmte sie. War es eine Stimme, eine Hand oder ein Zauber? Sie bekam keinen Ton heraus und war nicht in der Lage, sich zu rühren. Hilflos musste Beatrice mit ansehen, wie der Stein langsam und unausweichlich in die Dunkelheit fiel. Doch dann hörte sie den Aufschrei hunderter greller Stimmen aus dem Inneren des Korbs. Es klang nach Schmerz, nach Wut, nach Todesangst. Widerliche dunkle schwarze Käfer, Schlangen, schleimige Würmer und riesige dicht behaarte Spinnen, ganze Hundertschaften ekelhafter Kreaturen schossen in wilder Panik aus dem Korb heraus, um im nächsten Augenblick kreischend zu verenden. Ihre Leiber zischten, und nach wenigen Sekunden blieben nur noch kleine rauchende Aschehaufen übrig. Aus dem Inneren des Korbs jedoch leuchtete es strahlend blau, und Beatrice lachte befreit auf. Sie konnte gar nicht mehr damit aufhören. Sie lachte so sehr, dass ihr die Tränen über die Wangen liefen und ihr Zwerchfell zu schmerzen anfing. Der Stein hatte gesiegt.
Beatrice sah sich überrascht um. Der Stapel Kissen, der ihr gegenüberlag, war leer. Samira saß nicht mehr auf ihrem Platz. In der Messingschale lagen nur noch wenige erkaltete Kohlestückchen, die unter dem feinen gelben Sand hervorragten. Samira musste die Glut erstickt haben. Daneben stand der kleine Korb, der Deckel war geschlossen. Hatte sie etwa geschlafen und dabei diese wilden Sachen geträumt? Tatsächlich hatte Beatrice das Gefühl, aus einem lebhaften Traum erwacht zu sein, wenn da nicht der seltsame bittere Geschmack auf ihrer Zunge gewesen wäre und die zahlreichen Brandflecken auf dem Lehmboden.
Ein Geräusch ließ Beatrice herumfahren. In einer Ecke des Raums stand Samira und hantierte mit einem kupferfarbenen Kessel, der über einer Feuerstelle hing. Beatrice sah Samira an. Ihr selbst war übel, ihr Kopf hatte mindestens ein Volumen von einem Kubikmeter, und sie fror so erbärmlich, dass ihre Zähne klappernd aufeinander schlugen. Die Alte hingegen schien überhaupt keine Nachwirkungen des Rausches zu spüren. Aber wahrscheinlich war sie an die Wirkung der Kräuter durch jahrzehntelangen regelmäßigen Gebrauch gewöhnt, während Beatrice der Droge hilflos ausgeliefert gewesen war. Fasziniert beobachtete sie, wie Samira mit ruhigen Händen in zwei Gläser Tee einschenkte. Wer war diese alte, dicke, hässliche Frau? War sie wirklich eine Hexe?
Langsam und schwerfällig kam Samira näher. Sie war noch korpulenter, als es im Sitzen den Anschein gehabt hatte. Beatrice vermutete, dass sie mindestens hundertzehn Kilo wog. Sie watschelte heran wie eine gemästete Ente kurz vor dem Schlachttermin. Dennoch hatten ihre Bewegungen eine gewisse Grazie, und jeder ihrer Schritte wurde begleitet vom leisen Klingeln der Glöckchen an ihrem Rocksaum.
»Hier, trink«, sagte Samira mit einem freundlichen Lächeln und reichte Beatrice eines der Gläser. »Das wird dich wärmen und dir helfen, wieder einen klaren Kopf zu bekommen.«
Gehorsam nippte Beatrice an der dunklen Flüssigkeit. Der Tee war süß und stark und so heiß, dass sie sich fast die Zunge daran verbrannte. Schon nach wenigen Schlucken merkte sie, wie er ihre Glieder wärmte und ihr Kopf wieder auf sein normales Maß zusammenschrumpfte. Aber entgegen ihrer Erwartungen blieb die Erinnerung an ihren Traum. Ja, je mehr die körperlichen Nachwirkungen des Rausches von ihr abfielen, umso klarer sah sie alles wieder vor sich.
Samira wartete geduldig, bis Beatrice ihren Tee ausgetrunken hatte.
»Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, deine Fragen zu stellen«, sagte sie und lächelte Beatrice aufmunternd zu.
Beatrice runzelte die Stirn. Ihr gingen hunderte von Fragen durch den Kopf. Am meisten interessierte sie die Bedeutung dessen, was sie im Rausch gesehen hatte. Aber sollte sie wirklich Samira danach befragen? Das war doch Quatsch! Das waren nichts anderes als Halluzinationen, hervorgerufen durch eine ihr unbekannte Droge. Die Alte würde sie nur auslachen.
»Was waren das für Kräuter, die du in der Räucherschale verbrannt hast?«, fragte Beatrice stattdessen.
Samira lachte. »Ich glaube nicht, dass es das ist, was du wirklich wissen willst. Du solltest mehr auf deine innere Stimme hören, Beatrice. Außerdem ist die Herkunft der Kräuter ein Geheimnis, das in meiner Familie seit Generationen von der Mutter auf die Tochter weitervererbt wird. Nicht einmal wenn ich wollte, dürfte ich es dir mitteilen. Stelle eine andere Frage.«
Beatrice dachte kurz nach. Es fiel ihr immer noch schwer zu glauben, dass dieser Hokuspokus ernst gemeint war. Sollte sie sich wirklich vor Samira zum Gespött machen, indem sie ihr von den Farben, den Spinnen und Käfern erzählte? Andererseits schien die Alte genau dafür bezahlt worden zu sein. Und unter Umständen konnte Samiras Deutung ganz amüsant werden.
»Ich habe eine Menge seltsamer Dinge gesehen«, sagte sie langsam. »Ich muss berauscht gewesen sein, denn etwas Derartiges ist mir noch nie passiert. Was hat das zu bedeuten?«
»Siehst du, das ist doch eine vernünftige Frage.« Samira nickte zufrieden. »Ich werde dir jetzt etwas erzählen. Nur wenige Menschen auf der Welt wissen überhaupt davon, und von denen sagen die meisten, es handle sich um ein Märchen, um eine Legende.« Samira faltete ihre dicken Hände auf ihrem Schoß. »Mohammed, unser Prophet, Allah sei gepriesen, hatte viele Kinder. Er war ihnen ein guter und liebevoller Vater. Aber von allen war es Fatima, die Vielgeliebte, der er seine größte Zuneigung schenkte. Sie war schön von Gestalt und Antlitz, dabei voller Liebreiz, Tugend und Klugheit. Stolz, Hochmut und Eitelkeit waren ihr fremd. Schon in früher Kindheit führte sie ein Allah gefälliges Leben. Und jedem, der sie nur sah oder ihre liebliche Stimme hörte, schien es, als hätte Allah selbst einen Strahl Seiner unendlichen Güte und Barmherzigkeit durch dieses Mädchen auf die Erde gesandt. Besonders außergewöhnlich aber waren Fatimas Augen. Groß und leuchtend waren sie und so blau wie der Himmel. Sie half ihrem Vater, unserem Propheten, bei der Verbreitung des heiligen Wortes Allahs, und die Menschen nahmen es freudig auf. Doch nicht lange nachdem Allah, Sein Name sei gepriesen, in Seiner großen Güte seinen Propheten Mohammed zu sich geholt hatte, wurden die Gläubigen unzufrieden und mürrisch. Wie Menschen eben sind, begannen sie das heilige Wort Allahs nach ihren eigenen Bedürfnissen auszulegen. Sie stritten sich und bildeten Gruppen, die miteinander nichts mehr zu tun haben wollten. Sie bestimmten ihre eigenen Oberhäupter, und jede der Parteien behauptete von sich, allein im Besitz der Weisheit Allahs zu sein.
Fatima sah diese Entwicklung voller Traurigkeit mit an. Man sagt, dass es jedes Mal regnete, wenn sie aus Kummer über die Zwietracht, die unter den Gläubigen herrschte, weinte. Und in dieser Zeit regnete es sehr oft. Der Schmerz zehrte an der Tochter des Propheten, und schließlich war sie dem Tode nahe. Bevor Fatima, die Vielgeliebte, starb, betete sie in ihrem unendlichen Kummer zu Allah. Sie riss sich ein Auge heraus und bat Allah darum, dass dieses Auge die Weisheit und den Frieden zu den Gläubigen zurückbringen sollte. Und Allah in Seiner unermesslichen Güte erhörte ihr Gebet. Er verwandelte das Auge in einen Saphir, so groß und vollkommen und schön, wie die Welt ihn noch nie gesehen hatte.
Doch kaum dass Allah, Sein Name sei gepriesen, Fatima, die Vielgeliebte, zu sich ins Paradies genommen hatte, begann der Streit unter den Gläubigen von neuem. Jede Gruppe wollte das Auge für sich haben und so die Herrschaft über alle Gläubigen erringen. Zudem dünkten sie sich erhaben über Juden und Christen, die solch ein kostbares Kleinod nicht besaßen. Als Allah das sah, wurde Er zornig über die Gier und den Hochmut der Menschen. Er schleuderte einen Blitz auf die Erde hinab, der das Auge der Fatima in viele Stücke zersprengte. Diese verteilte Er über die ganze Welt. Die Menschen sollten sie mühevoll wieder zusammensuchen müssen. Und erst, wenn ihnen dies eines fernen Tages gelungen sein würde und sie genügend Weisheit erlangt hätten, würden die Gläubigen sich wieder vereinen. Sie würden gemeinsam mit Juden und Christen Allah dienen, und es würde endlich Friede herrschen.«
Als Samira ihre Erzählung beendet hatte, verfiel sie eine Weile in Schweigen. Beatrice war fasziniert. Sie liebte die orientalischen Geschichten. Sie waren so bildlich und blumig in ihrer Sprache.
»Eine wunderschöne Legende«, sagte sie. »Aber was hat das mit mir zu tun?«
Samira lächelte. »Weißt du das wirklich nicht?«, fragte sie sanft. »Hast du nicht gesehen, wie dieser Stein das Dunkel vertrieben und das Böse vernichtet hat? Es ist ein Teil des Auges.« Ihre Stimme wurde zu einem ehrfürchtigen Flüstern. »Einer der Steine der Fatima.«
Für einen Moment war Beatrice sprachlos. Eine hübsche Erzählung zu hören und sich daran zu erfreuen, war eine Sache. Etwas ganz anderes war es jedoch, wenn eine unförmige orientalische Hexe andeutete, dass man selbst mitten darin steckt. Vermutlich hätte Samira Beatrice ebenso gut sagen können, bei einem der Gefäße zu ihren Füßen handle es sich um den Heiligen Gral. Sie vermochte es nur schwer zu glauben.
»Was soll ich dazu sagen«, murmelte sie und schüttelte fassungslos den Kopf. Wollte Samira sie auf den Arm nehmen, oder glaubte die Alte wirklich an das, was sie ihr erzählt hatte?
»Wem hast du schon etwas von deinem Stein gesagt?«, fragte Samira.
»Niemandem.«
»Das ist gut.« Samira nickte zufrieden. »Und so solltest du es auch weiter halten. Zeige ihn niemandem, sprich mit keinem darüber. Du musst die Existenz des Steins unbedingt geheim halten. Wenn es sich auch nur um ein Teil des Auges handelt, so birgt der Stein doch große Macht. Und es gibt genügend Menschen, die alles tun würden, um in seinen Besitz zu gelangen.«
»Nun, er muss zwangsläufig große Macht haben, wenn es ihm gelungen ist, mich tausend Jahre durch die Zeit zu schicken«, entgegnete Beatrice bitter. »Du scheinst viel über diesen Stein zu wissen. Vermagst du mir auch zu sagen, wie er mich wieder nach Hause bringen kann? Muss ich auf irgendeine bestimmte Planetenkonstellation warten oder bei Vollmond ...«
»Das alles kann ich dir nicht beantworten«, unterbrach Samira sie. »Du musst es selbst herausfinden. Mein Wissen über die Steine der Fatima ist lückenhaft, und dabei weiß ich mehr als die meisten. Man erzählt sich, dass die Macht der Steine ihren Hütern die Fähigkeit verleiht, große Reisen zu unternehmen. Und in der Legende heißt es, dass derjenige, der sich würdig erweist, die Geheimnisse der Steine ergründen kann.«
Beatrice stöhnte auf. »Ich hatte gehofft, ich würde von dir einen Rat erhalten, dabei gibst du mir nur noch mehr Rätsel auf.«
»Ich gab dir bereits einen Rat. Rede mit niemandem über den Stein. Selbst jenen, die du deine Freunde nennst, kannst du nicht vertrauen. Das Streben nach dem Wissen und der Macht, die der Stein seinem Hüter verspricht, kann schnell in Gier umschlagen. Und Gier ist in der Lage, selbst ein gutes Herz zu verführen«, erwiderte Samira ernst. »Aber wenn du es möchtest, werfe ich einen Blick in deine Zukunft. Vielleicht sehe ich etwas, das dir nützlich sein kann.«
Beatrice zuckte gleichmütig mit den Schultern. »Warum nicht?«
»Bedenke aber, seine Zukunft zu kennen ist eine schwere Bürde. Uns Menschen gelingt es nicht, unserem Schicksal zu entfliehen oder es zu ändern, wir müssen mit dem Wissen leben. Nicht jeder Mensch kann dies ertragen und dabei noch sein Glück finden. Willst du das?«
Beatrice zuckte erneut mit den Schultern. Sie glaubte ohnehin nicht an solchen Hokuspokus. Was konnte es also schaden? »Ja, ich will.«
Samira lächelte.
»Dann reiche mir deine Hände, Beatrice.«
Samira blickte angespannt und ernst in Beatrices Handflächen und erzählte ihr schließlich von einer bevorstehenden Dunkelheit, vier Männern in ihrem Leben, einer großen Gefahr und einer großen Herausforderung.
Beatrice musste sich bemühen, ernst zu bleiben. Vermutlich hätte sie ähnliche Voraussagen selbst machen können, dazu brauchte man nur ein bisschen gesunden Menschenverstand. Die große Herausforderung war schon darin gegeben, dass sie in einem fremden Zeitalter und einer fremden Kultur lebte. Und dass ihr Gefahr drohte, falls wirklich jemand an die Legende vom Stein der Fatima glaubte, dazu brauchte man nun wahrlich keine hellseherischen Fähigkeiten. Mit der Dunkelheit konnte alles gemeint sein – eine Krankheit, ein geistiges Problem, das sich nicht lösen ließ, Traurigkeit über einen Verlust –, es kam lediglich auf die Interpretation an und würde sich schon allein deshalb erfüllen. Das Einzige, was Beatrice ein Rätsel blieb, war die Zahl vier. Jeder Wahrsager vermied es, so genaue Aussagen zu machen, dass man ihn später darauf festlegen konnte. Wieso also hatte Samira diese Zahl genannt? Andererseits ließ sich die Wahrheit dieser Aussage schlecht nachprüfen. Wenn sie sich bei Samira irgendwann einmal erkundigen würde, wo denn der vierte Mann bliebe, würde sie ihr einfach sagen, sie müsse noch Geduld haben.
Als Beatrice wieder zu Hannah in den Flur vor dem Teppich ging und das angstvolle Gesicht der Dienerin sah, bekam sie ein schlechtes Gewissen. Offensichtlich war sie viel länger bei Samira geblieben, als sie gedacht hatte.
»Herrin, endlich seid Ihr zurück!«, rief Hannah erleichtert aus. »Ich begann schon mir Sorgen um Euch zu machen.«
»Es tut mir Leid, Hannah«, erwiderte Beatrice, »aber ich habe einfach die Zeit vergessen. Schaffen wir es denn, rechtzeitig wieder im Palast zu sein?« Hannah nickte eifrig. »Natürlich, Herrin, doch wir sollten uns beeilen. Es ist schon spät.«
Schweigend liefen die beiden durch die engen, verwinkelten Gassen Bucharas zu dem geheimen Eingang an der Palastmauer zurück. Es war immer noch heiß, obwohl die Sonne nicht mehr ganz so hoch am Himmel stand, und schon nach kurzer Zeit rann Beatrice der Schweiß förmlich in Bächen am Körper hinab. Außer Atem und völlig erschöpft erreichten sie wieder die Palastmauer, zogen in der Geheimkammer ihre eigenen Kleider an und hasteten zum Palast zurück. Dort herrschte immer noch Mittagsstille. Niemand begegnete ihnen auf den Fluren. Unbemerkt kehrte Beatrice in ihr Zimmer zurück.
Es war spät an diesem Abend. Ahmad al-Yahrkun hatte gerade sein Nachtgebet beendet und sich auf dem schmalen Bett in seinem Arbeitszimmer ausgestreckt, um ein paar Stunden zu schlafen, als er plötzlich ein leises Geräusch hörte. Augenblicklich war er hellwach. Er kannte dieses Geräusch sehr gut, es war das Flattern und Kratzen von Flügeln am Fenstergitter. Rasch erhob sich Ahmad und öffnete das Fenster. Gurrend empfing ihn die unscheinbare graue Taube. Er nahm sie in die Hand und streichelte ihr zärtlich über das Gefieder.
»Allah sei Dank, dass du wohlbehalten zurückgekehrt bist«, flüsterte er der Taube zu und band die kleine Röhre von ihrem Bein los. »Mal sehen, welche Nachrichten du mir bringst.«
Ahmad setzte die Taube wieder auf den Fenstersims und schloss das Gitter. Dann zündete er eine Öllampe an und entrollte die Botschaft, die in der ledernen Röhre gesteckt hatte. Sein Herz klopfte bis zum Hals. Voller Unruhe las er die Zeilen.
»Ich muss dringend mit Euch sprechen. Ich erwarte Euch morgen zur gewohnten Zeit.«
Das war alles. Ahmad las die wenigen Worte wohl hundertmal, rätselte immer wieder an ihrer Bedeutung herum. Aber mehr, als dort stand, konnte er ihnen nicht entnehmen. Sein Kontakt war klug und vorsichtig, Eigenschaften, die er schätzte. Selbst wenn die Taube Jägern in die Hände gefallen wäre, würde niemand außer Ahmad mit der Nachricht etwas anzufangen wissen. Dennoch ärgerte er sich. Wenn es um wichtige Angelegenheiten ging, hasste er es zu warten. Noch einmal betrachtete er das kleine Stück Papier von allen Seiten. Es handelte sich um teures Papier von ausgezeichneter Qualität, wie man es nur selten kaufen konnte. Die schöne, charaktervolle Handschrift darauf machte es sogar zu einer Kostbarkeit. Ahmad seufzte und hielt das Papier in die Flamme der Öllampe, bis es Feuer fing. Schweren Herzens sah er dabei zu, wie es in einer Messingschale langsam zu Asche verbrannte. Er sammelte mit Leidenschaft schöne Handschriften; das einzige Laster, das er sich in seinem sonst eher asketischen Leben gönnte. Es tat ihm in der Seele weh, eine solche Kostbarkeit zu verbrennen, aber er hatte keine andere Wahl. Niemand durfte die Nachricht finden.
Ahmad löschte die Lampe und streckte sich wieder aus. Es dauerte jedoch lange, bis er endlich den wohlverdienten Schlaf fand. Denn er grübelte darüber nach, welche Neuigkeiten es nötig machten, seinen Kontakt persönlich zu treffen. Unruhig warf Ahmad sich von einer Seite zur anderen. Und es tröstete ihn nicht, dass nur noch wenige Stunden bis zum Morgengebet blieben.