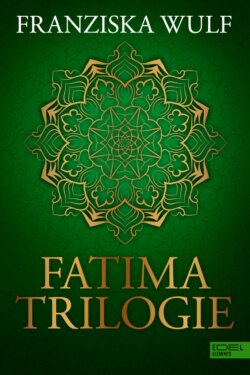Читать книгу Fatima Trilogie Gesamtausgabe - Franziska Wulf - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
XIII
ОглавлениеBeatrice saß allein in ihrem Zimmer im Schneidersitz auf dem Bett, hatte einen dünnen Baumwollfaden an einen der Bettpfosten gebunden und war damit beschäftigt, an den freien Enden chirurgische Knoten zu machen – immer einen nach dem anderen, mal mit rechts, mal mit links. Sie kam sich dabei vor, als befände sie sich wieder in ihrer Studienzeit. Da hatten sie alle in den Vorlesungen und in der Mensa gesessen und mit Wollfäden oder Nähgarn die verschiedenen Knoten geübt. Sie hatte sogar ihrer Freundin ein auf diese Art geknüpftes Armband aus dünnem Leder zum Geburtstag geschenkt. Beatrice stieß einen Seufzer aus. Damals waren sie alle ein bisschen verrückt gewesen, keiner von ihnen hatte es erwarten können, wirklich im OP zu stehen. Und dann war es endlich so weit, und sie sollte zum ersten Mal eine Hautnaht machen. Sie konnte sich noch genau daran erinnern. Es war eine Sprunggelenksfraktur gewesen, und ihre Hände hatten so gezittert, dass ihr fast der Nadelhalter in das Operationsgebiet gefallen wäre. Jetzt machte sie chirurgische Knoten, um die Langeweile totzuschlagen und ihre Finger beweglich zu halten. Dabei war es unwahrscheinlich, dass sie je wieder die Gelegenheit haben würde, Gefäße abzubinden und Wunden zu nähen. Plötzlich wurde die Tür aufgerissen.
»Das muss aufhören, Beatrice, und zwar sofort! Du musst endlich etwas dagegen tun!«
Überrascht sah Beatrice Mirwat an, die wie eine Furie in ihr Zimmer gestürmt kam. Es war das erste Mal seit vielen Tagen. Sie, die seit einiger Zeit als unzertrennlich galten, hatten schon lange kein Wort miteinander gewechselt. Seit kurzem ging Mirwat Beatrice sogar regelrecht aus dem Weg. Sie nutzte das Bad zu ungewöhnlichen Zeiten, blieb während der »Stunde der Frauen« in ihrem Gemach, statt im Garten spazieren zu gehen, und an den gemeinsamen Mahlzeiten der Frauen nahm sie auch kaum noch teil. Und wenn sie sich durch Zufall im Palast begegneten, kehrte Mirwat ihr schon von weitem den Rücken zu. Beatrice hatte es mittlerweile aufgegeben, den Kontakt zu Mirwat zu suchen. Dennoch ärgerte sie sich über dieses Verhalten. Vielleicht war Mirwat nur eifersüchtig, denn seit sie sich gegen den Emir zur Wehr gesetzt hatte, wurde Beatrice von den jüngeren Frauen regelrecht verehrt. Überall, wo sie erschien, stand sie im Mittelpunkt, und manche der Jüngeren ahmten ihre Frisur, ihre Kleidung, ja, sogar ihre Gesten nach. Mirwat hingegen, um die sich sonst immer alle geschart hatten, wurde kaum noch beachtet.
»Mirwat, verzeih, aber ich habe dein Klopfen wohl überhört«, sagte Beatrice kühl.
Mirwat machte eine abwehrende Geste. »Ich habe nicht angeklopft. Doch das ist jetzt nicht wichtig. Ich ...«
»Danke, mir geht es recht gut«, unterbrach Beatrice sie. Sie fühlte sich von der Freundin im Stich gelassen, und sie war nicht bereit, das ohne weiteres zu vergessen, nur weil Mirwat sich dazu herabließ, wieder mit ihr zu sprechen. »Die Dunkelhaft hat mir zwar zugesetzt, aber zum Glück hatte ich ja eine treue Freundin an meiner Seite, die mich nach meiner Rückkehr wieder aufgebaut hat.«
»Mitleid oder Bewunderung wirst du von mir nicht bekommen«, entgegnete Mirwat herausfordernd. »Du hast diese Strafe verdient.«
»Wie bitte? Ich glaube, ich habe mich verhört.«
»Du hast ein Verbrechen begangen«, sagte Mirwat ungerührt. »Du hast Nuh II. angegriffen und ihm die Nase gebrochen. Ich an seiner Stelle hätte dich für immer in den Kerker gesperrt.«
Beatrice schüttelte aufgebracht den Kopf. »Hör zu, Mirwat. Als du damals im Bad zu mir sagtest, Fatma habe es verdient, dass Nuh II. sie zusammengeschlagen hat, konnte ich dein Verhalten nicht verstehen. Ich vermochte nicht zu begreifen, wie man es als gerecht empfinden kann, wenn jemand einem anderen absichtlich Schmerzen zufügt. Aber es ist kein Geheimnis, dass du Fatma nicht besonders magst und sie dich auch nicht und dass ihr zwei immer noch um den ersten Platz neben Nuh II. streitet. Aber wir beide, Mirwat, du und ich, waren Freundinnen. Und das, was Nuh II. mir angetan hat ...«
»Du hast doch eben selbst gesagt, dass es falsch ist, jemand anderem absichtlich Schmerzen zuzufügen«, unterbrach Mirwat sie heftig. »Dabei bist du doch diejenige, die Nuh II. die Nase gebrochen hat, oder etwa nicht?«
Beatrice sprang wütend auf. »Das Schwein wollte mir Gewalt antun. Hätte ich mich nicht so erfolgreich gewehrt, wäre er über mich hergefallen und hätte mich vielleicht noch übler zugerichtet als Fatma. Du kannst doch Nuhs willkürliche, ungezügelte Gewalt beim besten Willen nicht mit Notwehr vergleichen.«
Mirwat schüttelte den Kopf. »Ich glaube, du verstehst vieles nicht, Beatrice. Du bist Nuhs Frau. Wenn er dich bittet ...«
»Er hat mich aber nicht gebeten, er wollte mich zwingen«, fiel Beatrice Mirwat ins Wort. »Und das lasse ich nicht mit mir machen! Er hat kein Recht dazu!«
»Du irrst dich, Beatrice. Natürlich hat er das Recht, von dir zu verlangen, ihm zu Willen zu sein. Du bist seine Frau, und deshalb hast du die Pflicht ...«
»Nein!«, stieß Beatrice empört hervor. »Ich bin nicht freiwillig in seinem Harem. Er hat mich erworben, gekauft wie ein Stück Vieh auf dem Markt. Doch damit besitzt er noch lange nicht die Rechte an mir. Es ist immer noch meine Entscheidung, ob und mit wem ich schlafen will. Und niemand, hörst du, niemand hat das Recht, mich dazu zu zwingen!«
»Ich verstehe dich nicht. Was ist denn schon so schlimm daran?«
»Ganz einfach! Es ist erniedrigend, entwürdigend. Es ist so ekelhaft, dass ich mich jetzt noch am liebsten übergeben würde, wenn ich daran zurückdenke.«
Mirwat schüttelte erneut den Kopf. »Und warum gehst du dann hin und lässt dich von den anderen als Heldin feiern? Wenn du dich nicht berühren lassen willst, so ist es deine Sache. Aber weshalb verdirbst du die anderen Frauen mit deinen seltsamen Ideen? Weißt du, dass sich immer mehr von ihnen weigern, mit Nuh II. zusammen zu sein? Er weiß schon gar nicht mehr, was er tun soll.«
»Der Ärmste, mir kommen gleich die Tränen.« Beatrice verschränkte die Arme vor der Brust. »Mirwat, beantworte mir doch bitte eine Frage. Wenn es den anderen Frauen bislang so viel Freude bereitet hat, mit Nuh II. das Bett zu teilen, weshalb weigern sie sich dann jetzt?«
Mirwat dachte eine Weile nach. »Wahrscheinlich sind sie deinen Einflüsterungen erlegen. Du hast sie verhext, ihnen den Verstand verwirrt und ...«
»O Mirwat, wenn du dich nur hören könntest!« Beatrice schüttelte lächelnd den Kopf. »Du bist doch eine kluge junge Frau. Wenn du nachts allein in deinem Bett liegst, kommt dir dann nicht auch manchmal der Gedanke, dass du Unsinn erzählst? Soweit ich es beurteilen kann, bist du hier die Einzige weit und breit, die Nuh II. liebt. Den anderen ist er bestenfalls gleichgültig, viele hassen ihn sogar, er widert sie an. Du magst dich auf das Zusammensein mit ihm freuen und es genießen, aber damit stehst du fast alleine da. Für die meisten anderen sind die Nächte mit ihm eine Zumutung. Und so war es schon lange, bevor der Emir überhaupt auf die Idee kam, mich zu kaufen. Diese Frauen brauchten nur jemanden, der ihnen klar macht, dass sie sich nicht alles gefallen lassen müssen, dass sie Rechte haben, die sie durchzusetzen in der Lage sind. Und dass sie das, was ich kann, ebenfalls können.«
»Soll ich dir mal sagen, was ich glaube?«, erwiderte Mirwat nach einer kurzen Pause. »Ich glaube, du bist den Umgang mit Männern nicht gewohnt. Du hast Angst vor ihnen. Weiß man in deiner Heimat nichts von den Freuden der Liebe? Hast du sie noch nie kennen gelernt?«
Beatrice schüttelte heftig den Kopf. »Das ist doch völliger Unsinn. Du ...«
»Ich habe Recht, nicht wahr?«, sagte Mirwat verächtlich. »Dich hat noch nie ein Mann berührt. Bislang wollte keiner etwas von dir wissen. Und weil du das nicht ertragen kannst, versuchst du auch uns die Freude zu verderben.«
»Du kennst doch weder mich noch mein Leben, und von meiner Heimat weißt du schon gar nichts. Also hör auf damit, die Hellseherin zu spielen und irgendwelche Dinge zu erfinden.«
»Aber es ist doch so, nicht wahr?«, fuhr Mirwat mit einem bösartigen Lachen fort. »Du bist immer noch Jungfrau. Du weißt nicht, wie es ist, wenn ein Mann deinetwegen derart in Ekstase gerät, dass er für dich sein Leben geben würde. Du hast keine Ahnung davon, welche Macht die Liebe einer Frau verleiht. Und das ärgert dich.«
Beatrice war einen Augenblick lang sprachlos. Was sollte sie darauf noch erwidern? Mirwat war verstockt und Argumenten ganz offensichtlich nicht zugänglich. »Ich glaube, wir sollten dieses Gespräch beenden«, sagte sie und schüttelte resigniert den Kopf. »Ich habe den Eindruck, dass es zu nichts führt.«
»Eine Frau ist nicht dazu geschaffen, unberührt zu sterben oder sich den Freuden der Liebe zu verschließen, Beatrice. Tut sie es doch, dann verbittert sie, sie wird hässlich und alt. Schau dir nur mal Sekireh an. Und wenn du nicht bereit bist, diese Wahrheit zu begreifen, kannst du mir nur leidtun. Du magst dich in der Heilkunde auskennen, aber abgesehen davon weißt du gar nichts. Du bist erbärmlich. Du hast ...«
»Das reicht jetzt, Mirwat!«, unterbrach Beatrice sie. Sie kochte innerlich vor Wut. »Wenn du nur gekommen bist, um mich zu beleidigen, solltest du jetzt besser wieder gehen.«
»Ja, ich glaube auch, dass es besser ist. Du bist ...«
In diesem Augenblick öffnete sich die Tür erneut, und Sekireh stand auf der Schwelle.
»Ich störe euch wirklich nur ungern in eurer angeregten Unterhaltung, aber ich muss etwas Wichtiges mit dir besprechen, Beatrice.«
»Du störst keineswegs, Sekireh«, erwiderte Beatrice, die den Anblick der kleinen zarten aufrechten Gestalt selten als so wohltuend empfunden hatte wie gerade in diesem Moment.
»Wir haben alles gesagt, was zu sagen ist, und Mirwat wollte ohnehin gerade gehen.«
Mirwat warf Sekireh und Beatrice einen wütenden Blick zu und rauschte ohne ein weiteres Wort davon.
Beatrice schloss sorgfältig die Tür hinter ihr und atmete erleichtert auf. Unterdessen trat Sekireh langsam zum Bett. Wie immer stützte sie sich auf ihren Stock, und sicherlich riss sie sich zusammen, um sich keine Blöße zu geben, aber dennoch fiel Beatrice auf, dass die alte Frau stärker humpelte als gewöhnlich.
»Wie geht es dir, Sekireh?«, erkundigte sie sich besorgt.
»Nicht besser, aber auch nicht schlechter – zumindest nicht wesentlich.« Sekireh setzte sich vorsichtig auf Beatrices Bett und verzog das Gesicht. »Sieh mich nicht so an. Du bist eine Plage, Beatrice. Nichts kann ich vor dir verbergen.«
Beatrice lächelte. Sie mochte die alte Frau von Tag zu Tag mehr. Und der Gedanke, dass sie in absehbarer Zeit sterben würde, schien sie mehr zu belasten als Sekireh selbst.
»Weshalb wolltest du mit mir sprechen?«, fragte sie.
»Ach, nicht so wichtig«, erwiderte Sekireh und winkte ab. »Eigentlich kam ich, um ein bisschen mit dir zu plaudern. Jetzt, zum Ende meines Lebens, werde ich redselig. Dann merkte ich, dass du bereits anderweitig beschäftigt warst, und ich dachte mir, dass ich euch beiden die Gelegenheit geben sollte nachzudenken. Sonst fallen unter Umständen noch Worte, die sich nicht mehr zurücknehmen lassen.« Sie stützte sich auf den Knauf ihres Stocks und sah Beatrice mitfühlend an. »Das war wohl ein ziemlich übler Streit?«
»Ja, in der Tat«, antwortete Beatrice und ließ sich neben Sekireh auf das Bett fallen. Plötzlich fühlte sie sich ausgepumpt und erschöpft. »Hast du mitbekommen, worum es ging?«
»Nun, ich mag zwar schon mit einem Bein im Grab stehen, aber mein Gehör funktioniert immer noch tadellos. Außerdem habt ihr laut und deutlich gesprochen.«
Beatrice sah Sekireh entsetzt an. »Dann hast du auch gehört ...«
»Was Mirwat über mich gesagt hat?« Sekireh lachte herzlich. »Natürlich habe ich das. Aber das waren keine Neuigkeiten!«
Beatrice schüttelte den Kopf. Warum? Warum nur war Mirwat auf einmal so bösartig? Sie hatte ihr doch gar nichts getan? Und weshalb musste sie zusätzlich noch eine schwer kranke, sterbende Frau verletzen?
»Mach dir nichts daraus«, meinte Sekireh und legte ihr aufmunternd eine Hand auf das Knie. »Mirwats Sicht von dieser Welt ist sehr eingeschränkt. Ich will damit nicht sagen, dass sie dumm ist. Mirwat weiß genau, was sie will und wie sie es bekommen kann. Aber es existiert nur ihr Leben, so wie sie es führt. Alles andere, was außerhalb ihrer eigenen Welt geschieht, sind nichts als Geschichten, Märchen, die man sich anhört, vor denen man sich vielleicht fürchtet oder über die man lacht. Aber sie sind nicht real. Sie begreift einfach nicht, dass viele Frauen hier im Harem ein zutiefst unerfülltes Leben führen. Sie selbst ist glücklich und liebt Nuh II., und deshalb müssen auch alle anderen Frauen so empfinden. Das ist Mirwats Sicht der Welt.« Sekireh seufzte. »Aber dieses Problem ist keinesfalls neu. Es ist eine Tatsache, dass selten die besten Männer auf dem Thron sitzen. Junge, schöne, wohlgestaltete Prinzen gibt es eigentlich nur in den Geschichten des Märchenerzählers auf dem Bazar. Wenigstens wissen sich die meisten Frauen zu helfen.«
Beatrice sah Sekireh erstaunt an. »Aber ...«
»Es fällt dir wohl schwer, mir zu glauben?« Sekireh lachte. »Nuh II. ist zum Glück nicht der einzige Mann hier im Palast. Es gibt Diener, Soldaten, junge Beamte, die noch keine Familie haben, ganz zu schweigen von den vielen Männern außerhalb der Palastmauern. Selbst die Eunuchen sind, sofern sie Geschick und Fantasie besitzen, durchaus in der Lage, einer Frau die eine oder andere Gefälligkeit zu erweisen.«
»Aber wie soll das funktionieren? Nuh II. lässt seinen Harem doch nie aus den Augen.«
»Natürlich ist es nicht ungefährlich«, antwortete Sekireh. »Doch vielleicht ist auch gerade das der Reiz in einem ansonsten tristen Leben. Die Gefahr ist anziehend, attraktiv und niemals langweilig. Manche riskieren sogar ihr Leben dabei.« Sie machte eine kurze Pause. »Söhnen aus vornehmen Häusern droht die Verbannung. Alle anderen werden entweder dem Scharfrichter vorgeführt oder verschwinden für den Rest ihres Lebens im Kerker. Frauen werden nur selten hingerichtet. Sie werden meistens ausgepeitscht oder gezwungen, der Hinrichtung ihres Geliebten beizuwohnen.«
»Aber das ist doch ...«
»Grausam?« Sekireh neigte den Kopf zur Seite. »Vielleicht hast du Recht. Doch jeder hier kennt diese Regeln. Und wer dennoch das Risiko eingehen will, ob aus wahrer Liebe oder bloßem Vergnügen, der muss bereit sein, die Konsequenzen zu tragen.« Sie stützte sich auf ihren Stock und erhob sich schwerfällig. »Aber ich habe dich genug mit meinem Geplauder gelangweilt. Ich werde jetzt wieder in mein Gemach zurückkehren.«
»Du hast mich noch nie gelangweilt, Sekireh«, erwiderte Beatrice. »Von mir aus kannst du gern länger bleiben.«
»In Wahrheit fühle ich mich müde und erschöpft. Ich sehne mich danach, mich in mein Bett zurückzuziehen. Aber das wollte ich eigentlich nicht zugeben«, sagte Sekireh mit einem traurigen Lächeln. »Von Tag zu Tag ermüde ich schneller. Ich glaube, der Tag ist nicht mehr fern, an dem ich aus dem Schlaf nicht mehr erwache.«
Als sie gemeinsam auf den Gang hinaustraten, war dieser menschenleer. Weit und breit war weder eine der anderen Frauen noch eine der Dienerinnen zu sehen. Nicht einmal einer der Eunuchen, die sonst die Frauen auf Schritt und Tritt verfolgten, ließ sich blicken. Es war fast beängstigend still, wie ausgestorben.
»Was ist denn hier los?«, wunderte sich Beatrice. »So ruhig habe ich es hier ja noch nie erlebt.«
»Ist es etwa schon so spät, dass die anderen bereits alle im Garten sind? Vielleicht haben wir den Gong überhört.«
»Möglich, aber ...«
Zweifelnd schüttelte Beatrice den Kopf. Der Gong, der jeden Abend die »Stunde der Frauen« ankündigte, wurde dreimal geschlagen und war so laut, dass er bis in den letzten Winkel des Palastes deutlich zu hören war.
»Du hast Recht«, stimmte Sekireh zu. »Das ist sehr unwahrscheinlich.«
»Aber wo sind sie dann alle?«
Sekireh zuckte mit den Schultern. »Das ist mir egal. Ich bin müde und will in mein Bett.«
Ohne auf Sekirehs Proteste zu achten, hakte Beatrice die alte Frau unter. »Ich komme mit«, sagte sie mit einem Lächeln. Sekireh hatte einen ziemlich weiten Weg zurückzulegen, bei ihren Knochenschmerzen eine wahre Tortur.
Sekireh schimpfte zwar noch eine Weile über die Starsinnigkeit der Frauen aus dem Norden, stützte sich aber dennoch dankbar auf Beatrices Arm. Langsam und bedächtig gingen sie den verlassenen stillen Gang entlang. Doch als sie in den Gang einbogen, der zu der Galerie führte, von der aus man in die Halle hinunterschauen konnte, sahen sie sie schon. Alle Frauen, Dienerinnen und Eunuchen schienen sich hier versammelt zu haben. Sie drängten sich um die hölzernen Gitter und steckten eng ihre Köpfe zusammen. Obwohl sie nur wenige Worte miteinander wechselten, war die allgemeine Nervosität und Anspannung deutlich spürbar. Da war etwas, das an das Summen eines Bienenschwarms erinnerte.
So schnell Sekireh es vermochte, traten sie näher. Sie drängten sich zu den anderen durch bis an das Gitter und schauten hinunter.
Unter ihnen lag die Halle. Beatrice sah sich neugierig nach allen Seiten um, aber sie konnte nichts Ungewöhnliches entdecken. Die Brunnen plätscherten wie immer, der herrliche Duft der Blüten stieg zu ihnen empor, und eine Hand voll junger Männer, vermutlich Beamte oder Soldaten des Emirs, spazierten gerade zwischen den Bäumen entlang und unterhielten sich leise.
»Kläre uns bitte auf, Fatma«, wandte sich Sekireh an die ihnen am nächsten Stehende. »Ist einer der jungen Männer dort unten ein Prinz aus einem fernen Reich? Oder was sonst erregt eure Aufmerksamkeit?«
Fatma sah Sekireh und Beatrice überrascht an. »Ja habt ihr denn nicht davon gehört?«
»Wovon?«
»Die Frauen haben heute während einer Versammlung beschlossen, dass der Versuch gewagt werden soll, sich unverschleiert und zur selben Zeit wie die Männer in der Halle aufzuhalten. Es wurde diese Stunde festgelegt.«
»Soll das etwa heißen, dass eine von euch tatsächlich ohne Schleier unter die Augen der Männer treten will?«, fragte Beatrice ungläubig. »Habt ihr denn bedacht, dass ihr wahrscheinlich dafür schwer bestraft werdet? Nuh II. wird euch einsperren oder ...«
»Dessen sind wir uns durchaus bewusst«, unterbrach Fatma sie würdevoll. »Aber wir sind bereit, jede Strafe hinzunehmen und sie mit Gelassenheit zu erdulden, sofern sie unseren Zielen dienlich ist. Du hast uns das Beispiel gegeben, Beatrice, du hast die zehn Tage Dunkelhaft durchgestanden. Du hast uns von den Frauen erzählt, die in deiner Heimat für ihre Rechte gekämpft haben. Dazu sind auch wir bereit. Und Jambala, die sogleich als erste Frau im Harem eines Emirs von Buchara unverschleiert vor die Augen der Männer treten wird, wird jede Strafe mit Freuden auf sich nehmen.«
»Geht sie denn wenigstens freiwillig?
»Natürlich. Es haben sich so viele Frauen gemeldet, dass das Los entscheiden musste, welche diesen denkwürdigen Schritt wagen darf.«
Voller Beunruhigung registrierte Beatrice den nahezu fanatischen Glanz in Fatmas dunklen Augen. Vermutlich hatte auch sie sich gemeldet. Fassungslos schüttelte sie den Kopf. Was war nur geschehen? Das alles klang verdächtig nach den Suffragetten, die in England für das Frauenwahlrecht gestritten hatten. Auch sie hatten Komitees gebildet und Sitzungen abgehalten, auf denen über ihr weiteres Vorgehen abgestimmt wurde. Etliche der Frauen hatten in den schweren Kämpfen, die mit Schlägereien, Inhaftierungen, Hungerstreiks und Zwangsernährung einhergegangen waren, den Tod gefunden; viele andere waren nach dem Ende des Kampfs körperlich und seelisch schwer traumatisiert. Aber das geschah zu Anfang des 20. Jahrhunderts. Hier befanden sie sich im Mittelalter, noch dazu in einem islamischen Land. Welche Lawine mochten die Frauen jetzt lostreten? Vor Beatrices geistigem Auge erschienen die Horrorvisionen von Massenhinrichtungen und einem Kerker voller schreiender, verzweifelnder Frauen, die über Jahre hinweg in Dunkelhaft gehalten wurden. Ihr wurde übel. Was hatte sie nur getan, als sie mit den anderen über die Gleichberechtigung von Mann und Frau gesprochen und ihnen dabei auch von den Suffragetten erzählt hatte? Welche Katastrophe hatte sie heraufbeschworen? Beatrice wagte nicht, Sekireh anzusehen. Sie ahnte, dass die alte Frau nicht übertrieben hatte, als sie sie vor einiger Zeit vor den Folgen der »Krankheit, die sich unter den Frauen immer weiter ausbreitet« gewarnt hatte. Nun war es schon zu spät. Oder konnte sie vielleicht doch noch etwas tun? Konnte sie Jambala daran hindern, diesen schweren Fehler zu begehen und nicht nur sich selbst, sondern auch die anderen ins Unglück zu stürzen? Sicherlich, vom humanistischen Standpunkt war es richtig und vernünftig, was die Frauen verlangten, aber sie wollten es zu schnell. Die Männer würden sie alle grün und blau prügeln – und es dabei wahrscheinlich nicht belassen.
»Fatma, wo ist Jambala?«, fragte Beatrice. »Wir sollten noch einmal alle darüber reden. Ich weiß nämlich nicht, ob ihr euch über die Konsequenzen im Klaren seid und ...«
»Da!«, unterbrach Fatma sie und deutete nach unten in die Halle. »Da ist Jambala! Soeben hat sie die Halle betreten.«
Ein Raunen ging durch die versammelten Frauen, als Jambala zwischen den Büschen und Bäumen auftauchte – tatsächlich unverschleiert. Die junge Schwarze trug ein schlichtes kurzärmliges Kleid aus leuchtend gelber Seide, das ihre dunkle Haut besonders gut zur Geltung brachte. Ihre Haare waren mit einem seidenen Band in derselben Farbe zurückgebunden. Im ersten Moment wirkte sie ein wenig unsicher, und Beatrice hegte die Hoffnung, Jambala würde der Mut verlassen und sie würde umkehren, bevor einer der Männer auf sie aufmerksam geworden war. Doch dann blickte die junge Frau empor. Beatrice war sicher, dass sie nichts sehen konnte außer den dichten hölzernen Gittern. Aber Jambala wusste von der Anwesenheit der anderen Frauen, sie wusste, dass mehr als vierzig Augenpaare zu ihr hinunterstarrten und gespannt darauf warteten, dass sie den entscheidenden Schritt tat. Beatrice sah, dass Jambala ihre Schultern straffte, ihren Kopf hob und ihr Kinn vorstreckte – und mit ruhigem Schritt ihren Weg durch die Halle fortsetzte. Eine Weile geschah nichts. Jambala schlenderte durch die Halle, ohne einem der Männer zu begegnen. Mit jedem Schritt schien sie sich sicherer zu fühlen, und schließlich begann sie leise zu summen. Mehr als vierzig Frauen auf der Galerie hielten die Luft an und wagten kaum zu atmen. Da bog einer der jungen Männer hinter einem der Brunnen hervor und stand plötzlich direkt vor Jambala.
»Showtime!«, flüsterte Beatrice.
Am liebsten hätte sie sich die Augen zugehalten, aber das wäre feige gewesen. Was auch immer dort unten geschehen würde, sie trug zu einem nicht unerheblichen Teil die Schuld daran. Hätte sie den anderen nicht von Emanzipation und Frauenbewegungen erzählt, wäre es niemals so weit gekommen.
Sie alle sahen, wie dem jungen Mann vor Überraschung die Kinnlade auf die Brust fiel. Mit weit aufgerissenen Augen starrte er Jambala an, als fürchtete er, sie wäre ein Dschinn oder eine Hexe, die ihn verzaubern wollte. Vermutlich war das von seinem Standpunkt aus wahrscheinlicher als der Gedanke, dass eine Frau aus dem Harem es wagen würde, unverschleiert in der Halle des Emirs herumzuspazieren. Noch ehe der junge Mann etwas sagen oder tun konnte, stieß der zweite auf Jambala. Er blieb wie angewurzelt stehen, jeder Tropfen Blut wich aus seinem Gesicht. Voller Angst deutete er mit dem Finger auf Jambala und stammelte dabei unverständliches Zeug.
»Der Friede sei mit euch! Würde mir bitte einer von euch einen Pfirsich pflücken?«
Die erstaunlich tiefe, raue Stimme der jungen Frau war bis zur Galerie hinauf deutlich zu hören. Es war eine simple Bitte, höflich vorgetragen, auf die man nur mit Ja oder Nein zu antworten brauchte. Doch die beiden jungen Männer sagten gar nichts. Einen Moment lang starrten sie Jambala an, dann stießen beide einen wilden Schrei des Entsetzens aus und rannten in unterschiedliche Richtungen davon.
Jambala sah zu den anderen Frauen hoch und lächelte breit. Auf der Galerie begannen die Frauen zu jubeln. Sie lachten und lagen sich in den Armen und dankten Allah, als hätten sie bereits einen entscheidenden Sieg errungen. Nur Sekireh und Beatrice stimmten in den Jubel nicht mit ein. Viel sagend sahen sie sich an. Beide waren davon überzeugt, dass der Jubel viel zu früh kam. Betrübt schüttelte Sekireh den Kopf, ihr Gesichtsausdruck sprach Bände. Die alte Frau befürchtete Schlimmes. Beatrices Puls beschleunigte sich, ihr Magen begann Purzelbäume zu schlagen. Diese Geschichte war mit Sicherheit noch lange nicht vorbei, der eigentliche Tanz würde jetzt erst beginnen.
Als sollten Beatrices Gedanken bestätigt werden, hörte man plötzlich vom anderen Ende der Halle her das laute Klirren und Rasseln von Säbeln. Soldaten! Einer der beiden jungen Männer musste die Soldaten zu Hilfe gerufen haben. Wie auf ein geheimes Zeichen hin verstummte der Jubel der Frauen. Voller Entsetzen starrten sie auf Jambala hinunter, die die Soldaten zwar hören, aber noch nicht sehen konnte und sich unsicher in alle Richtungen umschaute. Alle hielten den Atem an. Dann erblickte Jambala den ersten Soldaten – es war ein riesiger breitschultriger Kerl mit einem brutalen Gesicht und einem eisenbeschlagenen Knüppel in der Hand. Sie schrie vor Angst auf, drehte sich um und lief zu einem der Ausgänge.
»Ich muss hinunter«, sagte Beatrice in dem Moment, in den sie sah, dass Jambala vergeblich an einer der Türen rüttelte. Diese Kerle wollten der jungen Frau nicht einfach nur Angst einjagen, sie waren gekommen, um sie zu verprügeln, und das musste sie verhindern, egal wie. Doch Sekireh hielt Beatrice zurück.
»Wozu?«
»Vielleicht kann ich die Männer aufhalten. Jambala trifft keine Schuld, sie ...«
»Beatrice, Jambala ist freiwillig ohne Schleier vor die Augen der Männer getreten. Wenn du jetzt hinuntergehst, wirst du gar nichts erreichen, außer dass die Soldaten dich auch noch bestrafen. Sei vernünftig und bleibe hier.«
»Aber sie haben Knüppel!«, rief Beatrice aus. »Sie werden ...«
»Und genau aus diesem Grund musst du hier bleiben. Was willst du gegen die Waffen der Soldaten ausrichten?« Sekireh stieß einen Seufzer aus und schüttelte verzweifelt den Kopf. »Ich empfinde genauso wie du, aber wir können zurzeit nichts tun. Es hilft Jambala nicht, wenn du dich auch noch in Gefahr begibst.«
»Aber ...«
»Was auch immer gleich vor unseren Augen geschehen wird, es wird schrecklich genug sein. Wir können nur hoffen, dass es die anderen wieder zur Vernunft bringt.«
Beatrice wollte sich von Sekireh losreißen, aber die alte Frau umklammerte ihren Arm so fest, dass es ihr nicht gelang. Schließlich gab sie es auf. Mit Tränen in den Augen verfolgte sie Jambalas Flucht quer durch die Halle. Wie ein Tier hetzte die junge Frau durch den Garten, sprang über Beete, schlug sich durch Büsche. Aber sie hatte von Beginn an keine Chance. Die Soldaten liefen nicht einmal hinter ihr her. Das hatten sie gar nicht nötig – die Tore waren schließlich alle versperrt. Ruhig und gelassen warteten sie auf Jambala wie Jäger auf ihre Beute. Knüppelschwingend und mit schrillen Schreien trieben sie sie einander zu und bildeten dabei mehr und mehr einen Kreis. Ein Kreis, der sich wie eine tödliche Schlinge immer mehr um Jambala zuzog. Verzweifelt rannte die junge Frau hin und her, schrie auf, wenn sie wieder einem Soldaten begegnete, änderte die Richtung und lief weiter, bis sie auf den nächsten stieß. Schließlich hatten die Soldaten sie so eng umringt, dass ihr keine Fluchtmöglichkeit mehr blieb. Schwer atmend stand Jambala in ihrer Mitte, der Schweiß rann ihr über das Gesicht, ihre Arme waren zerkratzt, der Saum ihres Kleids war zerrissen. Voller Panik drehte sie sich im Kreis und starrte die Männer an, die sich ihr drohend näherten. Schließlich packte einer der Soldaten sie von hinten. Und während Jambala schrie und um sich trat und schlug, stülpte ihr ein anderer einen Sack über den Kopf.
»Jetzt bist du endlich sittsam verhüllt«, sagte er höhnisch.
Unter dem johlenden Gelächter der anderen Soldaten fesselte er Jambala mit einem dicken Tau und stieß sie von sich. Blind und ohne dass sie ihre Arme bewegen konnte, stolperte sie in einen anderen Soldaten, der ihr einen Hieb mit seinem Knüppel versetzte und sie dann wieder von sich stieß, in die Arme des nächsten. Sprachlos vor Entsetzen sahen die Frauen das grausige Schauspiel mit an. Jambala wurde hin und her gestoßen, geschlagen und getreten. Ihr schmerz- und angstvolles Weinen wurde zuerst immer schriller und ging schließlich in ein klägliches Wimmern über. Erst als sie sich nicht mehr auf den Beinen halten konnte, sondern mühsam auf allen vieren vorankroch, um den Hieben zu entgehen, ließen die Soldaten von ihr ab. Einer von ihnen hob sie hoch und warf sie sich wie einen Stoffballen über die Schulter. Lachend verließen sie die Halle, die Knüppel hin und her schwingend wie Baseballspieler nach einem erfolgreichen Match.
Auf der Galerie war es still geworden. Die Frauen hielten sich aneinander fest, viele weinten still vor sich hin, andere schüttelten immer wieder stumm den Kopf oder waren einfach erstarrt in ihrem Entsetzen. Keine von ihnen konnte so recht glauben, was dort unten in der Halle geschehen war, keine sagte ein Wort. Die Träume von einer besseren Zukunft, von Gleichberechtigung schienen sich von einem Augenblick zum nächsten verflüchtigt zu haben. Langsam und still löste sich die Menge auf, wie eine Schar von Gespenstern zogen sich die Frauen in ihre Gemächer zurück. Auch Sekireh und Beatrice machten sich schweigend auf den Weg. Als sie schließlich vor ihrer Zimmertür standen, wandte Sekireh sich doch noch einmal an Beatrice.
»Dich trifft keine Schuld.«
Beatrice seufzte. »Da wäre ich mir nicht so sicher.« Sie biss sich auf die Lippe. »Ich habe ihnen schließlich immer wieder von ihren Rechten erzählt und damit das Ganze erst in Gang gebracht.«
»Dennoch war es ihre Entscheidung. Sie leben schon länger hier als du, Beatrice. Sie sind hier aufgewachsen, wurden hier erzogen. Sie kennen unsere Sitten, sie kennen die Männer in unserem Land. Wären sie klug gewesen, hätten sie mit diesen Konsequenzen gerechnet und ihre Entscheidung vielleicht noch einmal überdacht.«
Beatrice schüttelte den Kopf. »Ja aber ich hätte ebenfalls daran denken müssen. Ich hätte mich zurückhalten sollen. Immerhin kenne ich die Geschichte ...«
Sekireh runzelte die Stirn. »Was hast du vor, Beatrice?«, fragte sie besorgt. »Du willst doch nicht ...«
»Ich weiß noch nicht, was ich tun werde«, erwiderte Beatrice heftiger als beabsichtigt. »Aber ich werde auf keinen Fall zusehen, wie man Jambala für etwas zur Rechenschaft zieht, das ich zu verantworten habe.«
Sekireh sah Beatrice lange an. »Ganz gleich, was ich jetzt sage, du wirst das tun, was du für richtig hältst. Dennoch bitte ich dich, denke noch einmal in Ruhe darüber nach. Überstürze nichts. Gehe in dein Zimmer zurück und schlafe eine Nacht, bevor du etwas unternimmst. Ich möchte nicht, dass auch du dich ins Unglück stürzt, nur um einer Frau zu helfen, die es hätte besser wissen müssen.«
»Wir werden sehen ...«
Sekireh seufzte. »Ich mache mir Sorgen, Beatrice. Ich fürchte, du wirst eine Dummheit begehen. Bitte, sei vernünftig.«
Sie drückte Beatrices Hand und ging dann in ihr Zimmer. Eine Weile blieb Beatrice noch vor der verschlossenen Tür stehen. Was sollte sie jetzt tun? Sollte sie sich direkt zum Emir begeben und vor Nuh II. die Verantwortung für alles übernehmen? Ratlos strich sie sich das Haar aus dem Gesicht. Wahrscheinlich hatte Sekireh in einem Punkt Recht, sie sollte sich erst einmal zurückziehen und über alles in Ruhe nachdenken. Und dann würde sie entscheiden, was sie tun konnte, um ihre Schuld abzutragen.
»Wo war Jussuf? Verflucht soll er sein, dieser Versager, dieser Taugenichts! Wozu habe ich ihn zum Ersten Eunuchen meines Harems ernannt, wenn er seine Aufgabe nicht erfüllt? Und wo waren die anderen Eunuchen? Warum um alles in der Welt füttere ich diese nutzlosen Kerle durch, wenn sie nicht einmal in der Lage sind, die Frauen in Schach zu halten und so etwas zu verhindern?«
Nuh II. tobte. Das Gesicht des Emirs war dunkelrot angelaufen, auf seinem Seidenhemd hatten sich dunkle Schweißflecken gebildet. Er raste förmlich durch das Zimmer, und was ihm im Weg lag, erhielt einen Tritt oder wurde zur Seite geschleudert.
Diesmal vermochte Ahmad den Zorn des Emirs sogar zu verstehen. Auch er bebte vor Entrüstung. Wie konnten es die Frauen wagen, eines der Gebote des Propheten zu verletzen? Wer hatte ihnen die Idee eingepflanzt, sie müssten sich wie die Unreinen und Ungläubigen, wie Huren und Barbarinnen unverschleiert vor den Männern zeigen? Wo sollte ein derartig sündhaftes Verhalten hinführen, wenn nicht direkt zu den Pforten der Hölle?
»Ich will den Kerl sehen!«, schrie der Emir. »Ich will wissen, was er zu seiner Verteidigung vorzubringen hat!«
Wieder flog ein Gegenstand quer durch den Raum, diesmal eine Messingschale mit Datteln. Ein Diener, der nur wenige Schritte neben der Stelle stand, wo die Schale die Wand traf, sprang erschrocken zur Seite.
»Hast du mich nicht verstanden?«, brüllte Nuh II. den völlig Verängstigten an. »Bringe mir diesen Halunken! Und zwar sofort!«
»Herr, meint Ihr Jussuf, den Eunuchen?«, fragte der Diener schüchtern.
»Nein, den Scheich von Bagdad!« Nuh II. riss sich seinen Turban vom Kopf und schlug damit wie von Sinnen auf den Diener ein. »Hat Allah dich mit Dummheit geschlagen? Natürlich meine ich Jussuf! Von wem habe ich denn die ganze Zeit gesprochen?«
Verzweifelt verbarg der Diener seinen Kopf zwischen seinen Armen und duckte sich unter den Schlägen.
»Ja, Herr, sofort, Herr!«, stammelte er. »Ich werde Jussuf zu Euch bringen, Herr!«
»Dann nimm die Beine in die Hand und verschwinde endlich!«, schrie Nuh II. hinter dem armen Diener her, der hinauslief, als würde er von mindestens einem Dutzend Dämonen verfolgt.
Schwer atmend ließ sich Nuh II. auf eines der Sitzpolster fallen und wischte sich erschöpft den Schweiß von der Stirn.
»Womit habe ich das verdient, Ahmad?«, fragte er und schüttelte resigniert den Kopf. »Ich tue doch alles für diese Frauen. Ich bin gutmütig. Ich bin großzügig. Ich überhäufe sie mit Geschenken – und was ist der Dank dafür? Sie verhöhnen mich, ihren Wohltäter. Sie begehren gegen mich auf und machen sich lustig über mich.«
»Vor allem verhöhnen sie Allah, Seinen Propheten und Seine heiligen Gebote, Herr«, erwiderte Ahmad düster. Seine Hände zitterten so sehr vor Empörung, dass die Perlen des Rosenkranzes leise aneinander schlugen. »Glaubt mir, mein Gebieter, diese Weiber werden für ihren Frevel noch bestraft werden. Sie werden dafür bezahlen.«
Nuh II. nickte nachdenklich, doch Ahmad hatte den Eindruck, dass er ihm gar nicht richtig zugehört hatte. Dem Emir schien das ganze Ausmaß dieser Ungeheuerlichkeit immer noch nicht bewusst zu sein. Aber was sollte man auch von Nuh II. erwarten. Er dachte immer nur an sich selbst. Das sich zu seinen Füßen ein Sündenpfuhl auftat, der in der Lage war, alle Gläubigen Bucharas in seinen Schlund zu reißen, das schien er gar nicht bemerkt zu haben – oder aber es war ihm einfach egal.
»Glaubst du, dass alle Weiber an dieser Sache beteiligt waren?«, fragte der Emir plötzlich. »Oder hat diese Jambala das ganz allein ausgeheckt?«
Ahmad seufzte. »Ich weiß nicht, Herr ...«
»Ich habe auch nicht gefragt, ob du es weißt!«, schrie Nuh II. »Beim Barte des Propheten, hört mir hier eigentlich niemand zu, wenn ich etwas sage?«
Ahmad spürte, wie eine heiße Zorneswelle in ihm emporstieg. Am liebsten hätte er Nuh II. einen Tritt in seinen breiten Hintern gegeben und ihm gesagt, dass alles ganz allein seine Schuld sei. Hätte er nicht in seiner maßlosen Gier und seinem unersättlichen Verlangen diese Sklavin aus dem Norden in seinen Harem geholt, wäre das alles niemals geschehen. Niemand anders als Nuh II. selbst trug die Verantwortung dafür, dass die Sünde in den Palast Einzug gehalten hatte und dass der heilige Name Allahs geschändet worden war. Natürlich stand es Ahmad nicht zu, dem Emir von Buchara all diese Dinge ins Gesicht zu sagen. Er war nur der Berater, verpflichtet, seinem Herrn zu dienen und, sofern möglich, Schaden von ihm und von der Stadt fern zu halten.
»Ich glaube nicht, dass es allein Jambalas Idee war«, sagte Ahmad schließlich, als er seine Stimme wieder unter Kontrolle hatte. »Dazu gehört mehr als das Ungestüm einer jungen Sklavin. Es bedarf eines scharfen Verstands und einer boshaften Kraft, um das Gemüt einer jungen Frau so zu verwirren, dass sie nicht mehr in der Lage ist, Recht von Unrecht und Anstand von Unsitte zu unterscheiden.«
»Du meinst, da steckt jemand dahinter?«, fragte Nuh II. und kniff seine kleinen Augen zusammen. »Vielleicht eine Verschwörung? Wer bei allen Heiligen Allahs könnte das sein?«
Ahmad tat, als würde er einen Augenblick scharf nachdenken. Dann zuckte er mit den Schultern. »Ich wüsste nicht, wem ein derart boshaftes Vorgehen zu Lasten gelegt werden könnte, außer ...« Er machte eine Pause.
»Nun sprich endlich!«, rief Nuh II. ungeduldig. »Du hast doch einen Verdacht, oder? Das sehe ich dir doch an deiner Stirn an. Also heraus mit der Sprache!«
Ahmad holte Luft. »Nun, derjenige muss in ständigem Kontakt zu den Frauen stehen. Er muss ...«
Nuh II. riss die Augen auf. »Du meinst doch nicht etwa Jussuf?«
Zweifelnd wiegte Ahmad den Kopf hin und her. »Jussuf? Schon möglich. Aber an ihn hatte ich nicht gedacht. Er dient Euch bereits seit vielen Jahren. Weshalb sollte er gerade jetzt, zu diesem Zeitpunkt, eine Verschwörung anzetteln? Außerdem glaube ich nicht, dass einer der Eunuchen genügend Einfluss in Eurem Harem hätte.« Er schüttelte überzeugt den Kopf. »Nein, Jussuf steckt meiner Meinung nach nicht dahinter.«
Nuh II. rang die Hände. »Dann, bei allen Heiligen, Ahmad, ich flehe dich an, sag es endlich!«
Doch Ahmad zögerte noch. Er wollte diesen kostbaren Augenblick so lange wie möglich ausdehnen, diesen Moment, der ihm uneingeschränkte Macht über Nuh II. verlieh. Im Stillen bat er Allah um Vergebung für die niederen Motive, die ihn zu seiner Handlungsweise verleiteten, aber die Rache schmeckte süß, und sie wärmte sein Herz. Er beugte sich vor, bis er dem Gesicht des Emirs so nahe war, dass er die winzigen Schweißperlen auf dessen Stirn voneinander unterscheiden konnte.
»Ich denke an jemanden, der noch nicht so lange in Eurem Harem lebt, an jemanden, der hier fremd ist, von dem wir nicht einmal die Herkunft kennen, jemand, der Euch bereits Schaden zugefügt hat«, sagte er und senkte seine Stimme zu einem geheimnisvollen Flüstern. »Ich denke an die goldhaarige Sklavin.«
Nuh II. sah Ahmad scharf an. »Du meinst ...«
In diesem Augenblick öffnete sich die Tür.
»Was ist denn nun schon wieder?«, brüllte Nuh II.
«Ich bitte vielmals um Vergebung, Herr«, sagte ein Diener und verneigte sich tief. »Eure Gemahlin wünscht Euch zu sprechen. Darf ...«
Der Emir knirschte mit den Zähnen. »Ich, glaube nicht, dass ich in der Stimmung bin, eines dieser verruchten Weiber zu sehen. Welche ist es denn?«
»Es ist Mirwat, Herr«, antwortete der Diener und verneigte sich erneut. »Sie bat Euch zu sprechen. Es sei von großer Wichtigkeit.«
Ahmad konnte sehen, wie die angespannten Züge des Emirs bei Mirwats Namen weich wurden. Selbst in dieser Stunde vermochte er seine Zuneigung zu dieser Frau nicht zu verbergen.
»Nun, dann schick sie zu mir«, sagte er und versuchte seiner Stimme einen barschen Klang zu verleihen – vergeblich, wie Ahmad fand.
Verständnislos schüttelte Ahmad den Kopf. Wenn Nuh II. eines Tages seinen Thron verlieren würde, dann bloß wegen einer Frau. Der alte Trottel war nicht in der Lage, auch nur einen Augenblick lang seine Triebe zu zügeln.
Und dann trat Mirwat ein. Und Ahmad vergaß, woran er eben noch gedacht hatte, seine Empörung über die gotteslästerliche Tat der Frauen, sein mangelndes Verständnis für den Emir, alles.
Mirwat war verschleiert, so wie es der Koran verlangte. Weder ihre Hand- noch Fußgelenke waren zu sehen, kein einziges Haar lugte unter dem undurchsichtigen schweren Stoff hervor. Lediglich ihre Augen waren sichtbar, groß, dunkel und betörend schön. Allein diese Augen waren in der Lage, den Verstand eines Mannes zu verwirren und ihn zu verzaubern. Mirwat verbeugte sich mit einer Anmut vor ihrem Gemahl, die Ahmads Herz höher schlagen ließ. Welch eine Tugend! Nur Allah in seiner großen Güte und unermesslichen Barmherzigkeit konnte ein derart vollkommenes Geschöpf erschaffen. Der Anblick dieses Weibes war eine Wohltat für die geschundene Seele eines Mannes.
»Verzeiht, mein Gebieter, dass ich Euch derart ungebeten belästige.« Sie verneigte sich erneut. Ihre Stimme klang süßer als der Gesang einer Nachtigall.
»Wie könnte mich dein Anblick belästigen, meine Rose?«, erwiderte Nuh II., erhob sich und ergriff ihre Hand. »Allah selbst muss deine Schritte zu mir gelenkt haben. Dass du mich ausgerechnet in dieser schwarzen Stunde aufsuchst, ist ein willkommenes Geschenk für einen armen, schwer vom Unglück heimgesuchten Mann.«
»Eben darum bin ich gekommen«, sagte Mirwat. »Ich muss mit Euch darüber sprechen.«
Ahmad wollte sich erheben, um den Raum zu verlassen, doch Mirwats süße Stimme hielt ihn zurück.
»Wenn mein Gebieter es gestattet, so bleibt, Ahmad al-Yahrkun, verehrter und geschätzter Freund meines Herrn.« Sittsam senkte sie den Blick, als Ahmad sie überrascht ansah. »Verzeiht mein ungebührliches Verhalten, aber diese besorgniserregende Situation erfordert es. Nuh II., mein Gebieter, braucht jetzt jeden Beistand, den er bekommen kann. Und Euer kluger Rat, Eure Weisheit wird in dieser heiklen Angelegenheit besonders willkommen sein.«
Ahmad sah Nuh II. fragend an. Der Emir nickte kurz, und Ahmad ließ sich wieder auf seinem Polster nieder.
Nuh II. führte Mirwat zu einem der Sitzpolster und gab ihr die Erlaubnis, sich zu setzen.
»Was hast du mir zu sagen, meine Rose?«, fragte er, und in seinem Blick und seiner Stimme lag eine Zärtlichkeit, die Ahmad nachvollziehen konnte. Diese Frau, dieses vollkommene liebreizende Geschöpf war in der Tat ein Geschenk Allahs.
Mirwat hielt ihre Hände in den weiten Ärmeln ihres Gewands verborgen und sah zu Boden. »Verzeiht, aber ich musste kommen, mein Gebieter. Was heute in der Halle geschehen ist, ist entsetzlich. Es beschämt mich zutiefst, wie eine Frau es wagen konnte, jeden Anstand und die Gebote unseres Propheten mit Füßen zu treten und ohne ...« Ihre Stimme brach, und sie schloss die Augen, als würde sie nicht einmal wagen, an diese Ungeheuerlichkeit zu denken. »Verzeiht, aber ich kann es immer noch nicht fassen.«
Nuh II. ließ sich neben sie auf das Sitzpolster nieder, nahm ihre Hand und tätschelte sie beruhigend, während er Ahmad einen Wink gab, einen Becher mit Wasser zu füllen.
»Nicht doch, nicht doch, meine Rose. Das hat doch nichts mit dir zu tun«, versuchte Nuh II. sie zu trösten. »Dich trifft doch keine Schuld.«
Mit zitternder Hand nahm Mirwat den Becher entgegen und trank einen Schluck.
»Aber das Licht der Schande fällt durch diese ruchlose Tat auf jede Einzelne von uns und somit auch auf mich!«, stieß sie heftig hervor. Dann schüttelte sie den Kopf. »Das Verhalten dieses Weibes lässt sich durch nichts entschuldigen.«
»Willst du damit sagen, dass Jambala diesen Streich allein ausgeheckt hat?«, fragte Nuh II.
»Jambala?« Überrascht sah Mirwat ihn an. »O nein, mein Gebieter, Jambala trifft keine Schuld. Sie ist lediglich ein Opfer, ebenso wie die anderen. Sie ist den Einflüsterungen dieser Hexe erlegen, hat ihren Lügen Glauben geschenkt und ihren Hetztiraden ihr Ohr geliehen. Wenn man Jambala etwas zur Last legen kann, dann, dass sie sich verblenden ließ von den Worten eines bösartigen Weibes.«
Nuh II. schüttelte verständnislos den Kopf.
»Ich weiß noch immer nicht, von wem du sprichst.«
»Ich meine Beatrice, diese blonde Hexe aus dem Norden.«
Mirwat sah über ihre Schultern nach hinten und beugte sich dann vor. Sie sprach jetzt schnell, ihre Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. Es machte den Eindruck, als fürchtete sie, belauscht zu werden. »Dieses böse Weib hat sich in Euren Harem geschlichen, mein Gebieter, um uns alle zu verderben. Es ist schwer, sich ihren Worten zu verschließen und ihr nicht zu glauben. Sie sind verführerisch wie Nymphengesänge, sie hüllen den Verstand ein und lassen jeden Anstand vergessen. Sie hat die Frauen verzaubert, damit sie sich gegen Euch auflehnen. Auch ich wäre beinahe ihrem Zauber erlegen, wenn ich sie nicht rechtzeitig durchschaut hätte. Seither hat sie keine Macht mehr über mich, aber die anderen Frauen hat sie fest in ihren Klauen.« Sie fiel vor Nuh II. auf die Knie und ergriff seine Hände. »Mein Gebieter, ich flehe Euch an, unternehmt etwas gegen dieses bösartige Weib, bevor es zu spät ist.«
Ahmad drehte sich das Herz im Leib herum, als er in Mirwats wunderschönen Augen Tränen schimmern sah. Mehr denn je war er überzeugt davon, dass die Barbarin für ihr Verhalten bezahlen musste – zur Not mit dem Leben.
Nuh II. warf Ahmad einen langen Blick zu. »Beruhige dich, meine Teure, meine Schöne«, sagte er leise. »Auch Ahmad liegt mir schon lange damit in den Ohren, dass ich die Sklavin aus meinem Harem verbannen soll. Vermutlich hätte ich auf ihn hören sollen.« Er seufzte. »Ich verspreche, nein, ich schwöre dir, dass ich alles in meiner Macht Stehende tun werde, um dem Treiben dieses Weibes ein Ende zu bereiten. Die Frage ist nur, wie? Soll ich sie in die Verbannung schicken?«
Mirwat schüttelte heftig den Kopf. »Das wird nichts nützen, mein Gebieter. Sie verfügt über beträchtliche Zauberkräfte und wird wahrscheinlich wiederkehren, sobald Ihr die Tore der Stadt hinter ihr geschlossen habt und wir uns alle in Sicherheit wähnen.«
Nuh II. runzelte nachdenklich die Stirn. »Was bleibt uns dann noch?«
»Der Tod.« Ahmad und Mirwat antworteten wie aus einem Munde.
Der Emir nickte nachdenklich. Dennoch verzog er das Gesicht, als hätte man soeben von ihm verlangt, sein Lieblingspferd zu töten. »Doch auch hier ist Vorsicht geboten«, gab Mirwat zu bedenken. »Diese Hexe besitzt einen Stein, der ihr große Macht verleiht. Er sieht aus wie ein Saphir, und sie trägt ihn immer bei sich, sowohl bei Tag als auch bei Nacht. Durch Zufall habe ich einmal einen kurzen Blick auf ihn werfen können, als er ihr beim Entkleiden im Bade aus einer verborgenen Tasche gerutscht ist. Vermutlich hatte auch deshalb ihr Zauber keine Macht über mich. Dieser Stein hat die Größe einer Walnuss und sieht aus wie ein ungewöhnlich schöner Saphir. Er verstärkt ihre Zauberkraft, und ich fürchte, dass er sie auch vor Angriffen schützt.«
»Aber was können wir tun?«, fragte Nuh II. und warf Ahmad einen hilflosen Blick zu.
»Zuerst müssen wir dieser Hexe den Stein entwenden«, sagte Ahmad und hätte am liebsten gejubelt. Er konnte sein Glück kaum fassen. Gepriesen sei Allah für seine Größe und Barmherzigkeit! Endlich, nach all den Tagen der Qual und der Unsicherheit wusste er, wo der Stein der Fatima zu finden war.
»Wenn diese Hexe durch den Verlust des Steins geschwächt ist, können wir sie töten. Und dann ist endlich der Friede im Palast wieder hergestellt.« Ahmad dachte einen Augenblick nach. »Aber das darf nicht hier geschehen, nicht unter Eurem Dach, Herr.«
Nuh II. runzelte erneut die Stirn. »Und warum nicht?«
»Bedenkt, dass diese Hexe große Macht besitzt. Sobald sie merkt, dass Ihr hinter dem Anschlag steckt, wird sie Euch verfluchen und Euch vielleicht eine Schar Dämonen auf den Hals hetzen.«
»Beim Barte des Propheten!«, rief Nuh II. entsetzt aus.
»Zuerst müssen wir diese Hexe unauffällig aus dem Palast schaffen. Wie könnte uns das gelingen, ohne dass sie Verdacht schöpft?« Ahmad strich sich durch den Bart. Er hatte noch keinen genialen Einfall, aber er vertraute darauf, dass Allah schon alles lenken würde. »Vielleicht, indem Ihr sie einem Eurer Untertanen zum Geschenk macht? Es müsste allerdings jemand sein, der nicht täglich im Palast ein und aus geht. Und gleichzeitig darf dieser Mann dem Zauber dieses Weibes natürlich nicht hilflos ausgeliefert sein. Jemand mit einem hohen Verstand und weitreichender Bildung ...«
»Wie Ali al-Hussein, mein Arzt?«
Allah sei gepriesen! Heute war wirklich sein Glückstag. »Das ist ein guter Gedanke, Herr«, antwortete Ahmad und versuchte seine überschäumende Freude zu verbergen. Dieser Einfall hätte auch von ihm selbst stammen können.
»Der Arzt ist klug, gebildet und soviel ich weiß auch nicht abergläubisch. Er wird sich schon vor dieser Hexe zu schützen wissen. Außerdem wird er sie nicht lange unter seinem Dach beherbergen müssen. Sobald sie nämlich in seinem Haus wohnt, werden wir ihr den Stein entwenden, sie anschließend töten lassen und ihren Kadaver in der Wüste verscharren. Sie soll niemals wieder die Gelegenheit haben, Buchara mit ihren Hexenkünsten heimzusuchen. Natürlich kann keiner Eurer Soldaten diese Aufgabe übernehmen, Herr. Es muss jemand von außerhalb des Palastes sein. Eure Hände dürfen auf keinen Fall mit dem Blut dieses Weibes beschmutzt werden.«
»Allah segne Euch für Eure Klugheit und Eure weisen Worte, Ahmad al-Yahrkun!«, rief Mirwat aus. »Ich wusste, dass Euer Rat Gold wert ist, verehrter Freund meines Gebieters. So und nur so kann es gelingen, dieser Hexe ein für alle Mal das Handwerk zu legen.«
Ahmad stutzte. Für einen kurzen Moment gewann er den Eindruck, dass er genau das tat, was Mirwat schon von Anfang an im Sinn gehabt hatte. Sollte sie ihn nur benutzt haben, um ihre eigenen Ziele zu verfolgen? Doch ihre Augen strahlten so voller ehrlicher, tief empfundener Freude, dass sich seine Zweifel sofort wieder in Luft auflösten. Wie konnte er diesem vollkommenen Geschöpf, dieser reinen Tugend, diesem Geschenk Allahs eine solche Hinterlist zutrauen?
Nuh II. nickte eifrig. »Dies ist auch meine Meinung, Ahmad. Du sprichst mir aus der Seele, Mirwat. Ich beauftrage dich, Ahmad, geschätzter Freund, jemanden ausfindig zu machen, der diese heikle Aufgabe für uns übernimmt. Ich bin bereit, jede Summe zu zahlen, wenn nur diese Angelegenheit schnell und ohne viel Aufheben aus der Welt geschafft wird. Und halte meinen Namen da heraus.« Dann runzelte er wieder die Stirn. »Was ist jedoch mit Ali al-Hussein? Sollen wir ihn einweihen oder ...«
»Nein!«, riefen Ahmad und Mirwat erneut wie aus einem Munde. Sie sahen sich an, und Ahmad ergriff das Wort.
»Herr, wir wissen nicht, ob dieses Weib nicht in der Lage ist, in die Gedanken eines Menschen einzudringen. Wenn Ali al-Hussein von unseren Absichten weiß, so gefährdet das unter Umständen nicht nur ihn selbst, sondern auch unseren Plan. Und welche Konsequenzen wir dann zu befürchten haben, das wage ich mir gar nicht auszumalen.«
»Schon gut, schon gut!«, wehrte Nuh II. ab. »Ihr habt mich überzeugt. Dann sollten wir jedoch auch so schnell wie möglich handeln, damit dieses hinterlistige Weib erst gar nicht die Gelegenheit bekommt, unseren Plan zu entdecken.«
Ahmad nickte. »Wenn Ihr erlaubt, würde ich mich jetzt gern entfernen, Herr«, sagte er und erhob sich. »Ich möchte auf der Stelle alles Nötige in die Wege leiten.«
»Natürlich, Ahmad, geh nur«, erwiderte Nuh II. gnädig. »Aber vergiss nicht, zu keinem Menschen ein Wort! Diese Angelegenheit muss unbedingt unter uns bleiben.«
Ahmad verneigte sich und ließ Nuh II. mit seiner Gemahlin allein. Er war so guter Stimmung, dass er fast glaubte zu schweben. "Welch ein Geschenk hatte Allah ihm heute bereitet. Er wusste, wo der Stein war. Sie würden endlich diese unselige Sklavin, der er vom ersten Tag an nicht getraut hatte, loswerden. Und gleichzeitig würde dem arroganten Ali al-Hussein eine Lektion erteilt werden, die er sicher nicht so schnell vergessen würde.
Ahmad eilte in sein Arbeitszimmer, setzte sich an den niedrigen Tisch und begann damit, ein Schreiben an Ali al-Hussein zu verfassen. Als er fertig war, fügte er diesem noch eine Einladung zu einem Festessen bei, rief einen Diener zu sich, der beide Schreiben zu Nuh II. bringen sollte, damit dieser sie unterzeichnen und mit seinem Siegel versehen konnte. Während der Diener noch unterwegs war, nutzte Ahmad die Zeit und begab sich persönlich zur Küche. Die Küchensklaven, die gerade mit Aufräumen, Putzen und den Vorbereitungen für den kommenden Tag beschäftigt waren, erschraken, als sie den Großwesir so unverhofft vor sich stehen sahen. Sie beugten ihre Köpfe noch tiefer über das Gemüse und kneteten den Teig noch eifriger als zuvor. Ahmad hörte fast das Aufatmen der Sklaven, als er lediglich den Koch zu sich winkte, um dem beleibten, glatzköpfigen Mann Anweisungen für ein Festmahl am folgenden Abend zu geben. Als er die Küche wieder verließ, traf er den Diener, den er zum Emir geschickt hatte, mit den unterzeichneten Schriftstücken. Ahmad sah sie sich noch einmal gründlich an, rollte sie dann zusammen und übergab sie einem Boten mit dem Auftrag, sie auf der Stelle und ohne Verzögerung zu Ali al-Hussein ibn Abdallah ibn Sina, dem Leibarzt des Emirs von Buchara, zu bringen.
Als Ahmad soweit alles erledigt hatte und endlich wieder sein Arbeitszimmer betrat, war es bereits Nacht. Doch er konnte sich noch nicht zur Ruhe begeben, eine Sache musste zuvor erledigt werden. Rasch schrieb er die Nachricht auf ein kleines Stück Papier. Morgen noch vor dem Morgengebet würde er Saddin treffen und ihm den Auftrag erteilen, der Sklavin den Stein abzunehmen, sie zu töten und alle Spuren zu verwischen.
Ahmad glaubte nicht recht daran, dass es sich bei der blonden Frau tatsächlich um eine Hexe handelte. Hexen waren Märchengestalten, die in der Welt eines Gläubigen keinen Platz hatten. Aber er glaubte an die geheimnisvolle Macht des heiligen Steins. Wer konnte schon sagen, in welcher Weise sich der Stein der Fatima missbrauchen ließ und welche bösartigen Kräfte er verlieh, sobald er in die falschen Hände geriet? Nicht mehr lange, dann würde er selbst der Hüter des Steines sein. Er würde sich der Verantwortung gegenüber den Gläubigen bewusst sein, der Aufgabe, die zerstrittenen Söhne Allahs wieder zu vereinen. Er würde dieses heilige Kleinod verwahren und behüten und falls es sein musste – sogar mit seinem Leben beschützen.
Ahmad rollte die Nachricht zusammen und steckte sie in eine kleine lederne Röhre. Dann ging er zum Fenster. Es war schon spät. Über dem Palast stand der Mond, und die Sterne funkelten am nächtlich dunklen Himmel. Es war still, die Lichter hinter den Fenstergittern waren erloschen, alle Bewohner des Palastes schienen zu schlafen. Lediglich ein paar Fledermäuse flatterten auf der Jagd nach Insekten um die Türme herum. Die Tauben auf dem Sims schliefen, die Köpfe unter ihre Flügel gesteckt. Als Ahmad jedoch das hölzerne Gitter öffnete, erwachten sie. Sie erkannten ihren Herrn, gurrten, kamen näher, rieben zutraulich ihre Köpfe an seiner Hand und pickten die Hirsekörner, die er ihnen hinhielt. Ahmad sprach eine Weile leise mit den Tauben und langte schließlich nach der grauen. Mit schnellen, geübten Handgriffen band er ihr die kleine Röhre ans Bein, streichelte ihr noch einmal zärtlich über das Gefieder und ließ sie auf. Er sah zu, wie sie höher und höher stieg, einen Kreis über der im Mondschein golden schimmernden Kuppel des Palastes drehte und schließlich gen Westen davonflog. Welch ein Wunder, dass Tauben auch während der Nacht in vollkommener Dunkelheit ihr Ziel fanden. Wie großartig und wunderbar war doch Allahs Schöpfung.
Ahmad schloss das Fenstergitter und entrollte seinen Gebetsteppich. Es war zwar außerhalb jeder Gebetszeit, aber er musste Allah danken, jetzt auf der Stelle. Wieder einmal hatte Er Seine unergründliche Weisheit gezeigt und Seinem unwürdigen Diener bewiesen, dass Er alles zum Wohle der Seinen richten würde. Ahmad sank auf dem kostbaren Teppich auf die Knie und verneigte sich voller Demut vor der Macht und der Größe Allahs, bis seine Stirn den Boden berührte.