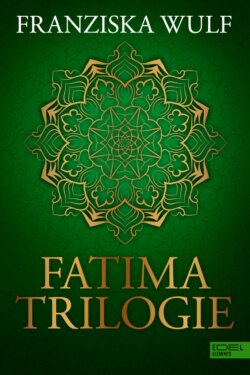Читать книгу Fatima Trilogie Gesamtausgabe - Franziska Wulf - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VII
ОглавлениеÜber den Bergen ging die Sonne auf und überzog die schroffen Gipfel mit königlichem Purpur. Der Muezzin trat auf das Minarett hoch über den Kuppeln Bucharas und begann mit dem Lobpreis Allahs. Seine klare Stimme hallte durch die morgendliche Stille, schwebte über den Dächern der schlafenden Stadt, glitt durch die Ritzen in Fenster und Türschwellen in die Häuser der Armen und Reichen und drang sogar bis in den Palast des Emirs und den finstersten Winkel der Souks vor.
Ali stand am Fenster seines Schlafgemachs und lauschte dem Weckruf der Gläubigen. Als er noch ein kleiner Junge war, hatte er sich manchmal vorgestellt, die Stimme des Muezzins sei in Wahrheit ein eigenständiges Wesen; vielleicht ein Dschinn oder gar ein Dämon, der durch die Luft flog und durch Schlüssellöcher und Mauerritzen in die Häuser der Menschen kroch. In seiner Furcht hatte er sogar an einem Abend sämtliche Löcher seines Zimmers mit wachsgetränkten Lappen verstopft, um diesem Geist den Zutritt zu verwehren. Natürlich war er trotzdem am folgenden Morgen vom Gesang des Muezzins geweckt worden. Und den Rest jenes Tages hatte er damit verbracht, die Wachsspuren von Tür, Fenster und Wänden zu entfernen.
Ali musste über seine kindliche Torheit lächeln. Damals hatte er noch an Geister geglaubt, die Welt der Dschinnen und Dämonen war lebendig für ihn gewesen. Aber obwohl diese Zeit längst vergangen war, hatte die Stimme des Muezzins nichts von ihrer Zauberkraft eingebüßt. Besonders in den frühen Morgenstunden hatte der Gesang etwas Magisches. Als der letzte Ton verklungen war, wandte sich Ali vom Fenster ab und schraubte sein Fernrohr wieder auseinander. Ohne ersichtlichen Grund war er mitten in der Nacht aufgewacht und hatte nicht wieder einschlafen können. Wie so oft, wenn ihn Grübeleien wach hielten und er nicht schlafen konnte, hatte er sein Fernrohr genommen und die Sterne beobachtet. Das tat er bereits, seit er in seinem zehnten Lebensjahr sein erstes Fernrohr von seinem Vater geschenkt bekommen hatte. Natürlich war jenes Fernrohr einfach gewesen. Es hatte lediglich aus zwei Linsen und einem Stück Leder bestanden, das man zu einer Röhre formen konnte. Es war ein Instrument, wie es die Nomaden und Karawanenführer bei sich trugen, wenn sie in der Wüste unterwegs waren. Es ließ sich schnell auseinander bauen und leicht in den Taschen verstauen.
Ali hatte dieses Fernrohr geliebt. Jeden Abend hatte er den Sternenhimmel damit betrachtet und sich gefragt, ob er wohl irgendwann einmal dorthin reisen könnte, um sich die Sterne aus der Nähe anzusehen. Oft genug hatte er darüber die Zeit vergessen, so dass sein Vater ihn hatte ermahnen müssen, endlich schlafen zu gehen. Gewissenhaft hatte er schon damals jede seiner Beobachtungen aufgeschrieben. Mittlerweile besaß Ali ein viel besseres und präziseres Fernrohr. Er hatte es aus dem Nachlass eines der berühmtesten Sternendeuter aus Bagdad erworben. Wenn er jedoch seine Aufzeichnungen von damals durchging, wunderte er sich oft, wie sehr seine Beobachtungen mit denen, die er schon als Kind gemacht hatte, übereinstimmten.
Ali putzte eine der Linsen und hielt sie gegen das Licht der aufgehenden Sonne. Unter ihm in den Straßen Bucharas erwachte langsam der neue Tag. Die ersten Händler verluden ihre Waren auf Karren, um damit zum Marktplatz zu fahren. Frauen holten in großen Tonkrügen frisches Wasser vom Brunnen oder trugen schmutzige Wäsche in Weidenkörben zum Waschplatz. Ali hörte ihre Stimmen und das Lachen, wenn sie den neuesten Klatsch und Tratsch aus der Nachbarschaft austauschten. Dann vernahm er die schnellen, schweren Schritte von Männern mit festen Schuhen auf dem steinernen Pflaster der Straße. Vermutlich war das die Sänfte, die der Emir ihm schicken wollte. Und richtig, kurz darauf hörte er ein lautes Pochen an der Tür. Ali prüfte nochmals, ob die Linse sauber war, und ließ sie dann behutsam in einen Beutel aus schwarzem Samt gleiten. Während er die zweite Linse putzte, drangen Stimmen aus der Halle zu ihm. Wahrscheinlich hatte Selim nur einem der Männer, dem Boten, Zutritt ins Haus gewährt. Ali hörte die schleppenden Schritte seines Dieners, als dieser mühsam die Treppe erklomm, um seinem Herrn von der Ankunft der Sänfte zu berichten.
Ali wandte sich nicht einmal um, als sich die Tür zu seinem Schlafgemach öffnete.
»Herr, verzeiht, die Sänfte ...«
»Ich weiß«, unterbrach er den alten Diener. Er war es leid, immer wieder Dinge zu hören, von denen er schon lange wusste. »Sage dem Boten, ich komme hinunter, sobald ich hier fertig bin. Er soll sich einen Augenblick gedulden.«
»Aber Herr, Ihr ...«
»Ich habe mich bereits während der Nacht angekleidet!«
Ali wandte sich um. Er sah das Missfallen, mit dem Selim den geöffneten Kasten betrachtete, in dem er das Fernrohr aufbewahrte. Für den alten Diener war dieses Instrument das Werk von Dämonen, die damit die Seelen der Menschen verzaubern und ihnen den Weg zum Paradies versperren wollten. Meistens verbarg Ali deshalb das Fernrohr vor den Augen des alten Mannes, um ihn nicht unnötig zu beunruhigen. Aber manchmal, so wie heute, bereitete es ihm geradezu Vergnügen, seinen Diener zu provozieren. Selim war so einfältig. Wie konnte ein harmloses Gerät, bestehend aus ein wenig Metall und Glas, den Seelen der Menschen ein Leid zufügen?
»Halte dies!«, sagte er und drückte dem Alten mit spöttischem Lächeln das Metallrohr in die Hände. Bedächtig und viel sorgfältiger als nötig faltete er die Tücher auseinander, mit denen der Kasten ausgeschlagen war. Selim stand gehorsam neben ihm. Er rührte sich nicht und beschwerte sich auch nicht, aber er sah das Metallrohr an, als hielte er eine giftige Schlange in den Händen. Ali wusste, dass der Alte, sobald er das Haus verlassen hatte, sich ausgiebig reinigen und Allah um Vergebung bitten würde. Er stieß einen Seufzer aus und nahm Selim das Fernrohr ab. Behutsam wickelte er es in die Tücher und legte es zusammen mit den Linsen in den Kasten. Er hörte, wie Selim erleichtert aufatmete, als er den Deckel zuklappte.
Ob die Menschheit sich auch in der Zukunft derart vom Aberglauben leiten lassen würde? Oder war man in hundert oder tausend Jahren so weit, dass Vernunft und Verstand die Geschicke der Menschen bestimmten? Ali seufzte erneut. Manchmal wünschte er sich, er könnte mit seinem Fernrohr nicht nur die Sterne beobachten, sondern auch in die Zukunft sehen. Zum Glück wusste Selim nichts von diesen Gedanken. Den alten Mann hätte vermutlich auf der Stelle der Schlag getroffen.
»Ich bin jetzt fertig.«
Gemächlich folgte er Selim die Treppe hinunter in die Halle, wo der Bote des Emirs bereits auf ihn wartete. Nuhs Diener, ein gut gekleideter junger Mann, verneigte sich zur Begrüßung tief vor Ali.
»Mein Herr, der edle und weise Nuh II. ibn Mansur, Allah möge ihn segnen und ihm ein langes Leben schenken, schickt mich, Euch zu begrüßen und Euch in den Palast zu begleiten, wo mein Herr, der edle und weise Nuh II. ibn Mansur, Allah möge ihn segnen und ...«
Ali verdrehte die Augen. Hatte er das nicht eben schon mal gehört?
»... Euch erwartet. Wenn Ihr mir folgen wollt, Herr? Die Sänfte wartet bereits auf Euch.«
Ali folgte dem jungen Mann, drückte ihm seine Tasche mit den Instrumenten in die Hand und bestieg die Sänfte. Sie war luxuriöser ausgestattet und geräumiger als mancher Wohnraum in Buchara – dicke Polster aus weicher Wolle, schwere seidene Vorhänge, wärmende Felle. Es stand sogar ein Tablett mit frischen Datteln, Feigen und Nüssen bereit. Er spürte, wie die Sänfte angehoben wurde und sich in Bewegung setzte. Aber die beiden dunkelhäutigen Sklaven waren ausgezeichnet geschult; ihre raschen Schritte waren gleichmäßig, und sie trugen die Sänfte mit so festem Griff, dass Ali fast glaubte zu schweben. Genüsslich ließ er sich in die weichen Polster zurücksinken, streckte seine Beine aus, nahm sich von den Datteln und begann schließlich ein wenig zu dösen.
Beatrice wurde durch ein leises Klopfen an der Tür geweckt. Zum ersten Mal seit langer Zeit hatte sie wieder tief und fest geschlafen. Obwohl ihre Fensterläden offen waren, hatte sie sogar den Ruf des Muezzins überhört. Allerdings wachte sie selten durch das Morgengebet auf. Vielleicht lag es daran, dass sie keine Gläubige und der Weckruf ohnehin nicht für sie bestimmt war. Sie streckte sich ausgiebig und gähnte herzhaft. Da klopfte es wieder, diesmal schon lauter.
Beatrice erhob sich und ging barfuß zur Tür. Die Marmorfliesen waren eisig kalt, und sie begann zu frieren. Sie überlegte, ob sie sich zuerst ihre Pantoffeln und einen Umhang anziehen sollte, als es bereits zum dritten Mal klopfte.
»Beatrice! Bist du da?«, klang es von der anderen Seite der Tür.
Das war doch Mirwat. Rasch entriegelte Beatrice das Schloss und öffnete.
»Guten Morgen«, sagte Mirwat und ging an Beatrice vorbei ins Zimmer. Ein frischer Duft nach Rosen und Minze begleitete sie. »Hast du gut geschlafen? Es ist schon spät. Ich habe dich im Bad vermisst.«
»Ja, ich habe wohl verschlafen«, erwiderte Beatrice überrascht. »Ich ...«
»Wie ich sehe, hattest du offensichtlich noch nicht einmal Zeit, dich anzukleiden«, unterbrach Mirwat sie und lächelte sie an, als hätten sie sich nicht am Abend zuvor gestritten. »Ich will dich auch gar nicht lange stören. Ich wollte dich nur fragen, ob du Lust hast, mich heute Nachmittag zu meiner Schneiderin zu begleiten.«
»Ja, warum nicht«, antwortete Beatrice. »Ich habe nichts anderes vor.«
Mirwat strahlte sie an und klatschte in die Hände. »Wunderbar! Das wird ein Spaß! Jussuf holt dich nach der Mittagsruhe ab. Ist dir das recht?«
»Ja, natürlich, ich ...«
»Gut, dann bis heute Nachmittag.«
Mirwat umarmte Beatrice, gab ihr zwei flüchtige Küsse auf die Wangen und rauschte davon.
Als die Tür hinter ihr ins Schloss fiel, ließ sich Beatrice auf ihr Bett sinken. Sie konnte nicht glauben, was sie eben erlebt hatte. Waren es wirklich sie und Mirwat gewesen, die einander so beschimpft hatten, dass ihr sogar die Hand ausgerutscht war? Heute tat Mirwat so, als hätte es diesen Streit nie gegeben. Sicher, auch das war eine Möglichkeit, Konflikte beizulegen. Beatrice wäre jedoch eine Aussprache mit gegenseitiger Entschuldigung lieber gewesen. Aber vielleicht war sie selbst auch nur überempfindlich. Oder war Mirwat so oberflächlich?
Es klopfte erneut an der Tür. Diesmal war es Yasmina.
»Herrin, der Emir erwartet Euch in einer Stunde. Er hat den Arzt holen lassen, er soll Euch untersuchen. Ihr müsst Euch fertig machen, wenn Ihr nicht zu spät kommen wollt.«
Beatrice ließ das Mädchen eintreten und sich beim Ankleiden helfen.
In einem kleinen, ruhigen Raum des Palastes wartete Ali auf die neue Sklavin des Emirs. Nuh II. ibn Mansur hatte ihn auch an diesem Morgen wieder ausgezeichnet bewirtet – frisches Obst, weißes Brot, würziger Schafskäse und Oliven, Sesamgebäck und gedünstete Linsen. Ein wahrhaft köstliches Mahl, ganz nach Alis Geschmack – bis ihm der Emir mitgeteilt hatte, weshalb er ihn zu sich gerufen hatte. Ali sollte erneut jene Sklavin, die neueste Frau im Harem des Emirs, untersuchen. Von einem Augenblick zum nächsten war Ali der Appetit vergangen. Zum Glück schien Nuh II. nicht bemerkt zu haben, dass sein Gast die Bissen auf seinem Teller nur noch lustlos hin und her schob, nachdem dieser noch kurz zuvor kräftig zugelangt hatte. Der Emir erzählte munter weiter und leerte schließlich allein die zahlreichen Schüsseln und Platten. Als er endlich satt war, hatte er Ali in dieses Zimmer führen lassen.
Ali ging auf und ab, zählte seine Schritte, betrachtete aufmerksam die eingewebten farbenfrohen Muster auf den Kissen und Teppichen, suchte an den weiß getünchten Wänden nach einem Makel und tat alles, um sich abzulenken, abzulenken von dem Gedanken, dass er nun bald wieder ihr gegenüberstehen würde. Jene geheimnisvolle Frau, von der er nicht wusste, was er von ihr halten sollte, ob sie krank oder eine Hexe war; jene Frau, die in Wahrheit für Mirwats Heilung verantwortlich war.
Seit der verwirrenden und beschämenden Begegnung in Mirwats Schlafgemach verdrängte er immer wieder das Bild dieser Frau aus seinen Gedanken. Dennoch suchte sie ihn heim, meistens nachts in seinen Träumen. In diesem Träumen lachte sie ihn aus. Sie lachte ihm mit ihren wunderschönen, so erschreckend ebenmäßigen Zähnen laut ins Gesicht – weil er nicht in der Lage gewesen war, die Ursache für Mirwats Erkrankung zu finden, weil er ihr, einer Frau, einer Fremden und Ungläubigen aus dem Norden, unterlegen gewesen war. Manchmal, wenn Ali schweißgebadet aus diesen Träumen erwachte, verachtete er sich selbst. Er hatte den Ruhm für Mirwats Heilung eingestrichen, ohne es zu verdienen. Aber was sollte er tun? Sollte er sich etwa hinstellen und aller Welt, voran dem Emir, erzählen, dass nicht er Nuhs Lieblingsfrau geheilt hatte, nicht das Wunderkind, das bereits im Alter von zehn Jahren alle bedeutenden Werke der berühmtesten römischen und griechischen Ärzte zitiert und verstanden hatte, der vielgerühmte Leibarzt des Emirs von Buchara, sondern eine Frau?! Noch dazu eine Sklavin, eine Ungläubige, eine Barbarin von zweifelhafter Herkunft und schlechter Bildung, die nicht einmal Latein und Griechisch perfekt beherrschte? Eine solche Ungeheuerlichkeit hätte die Festen der Welt erschüttert, wenn sie dem gemeinen Volk zu Ohren gekommen wäre. Und er selbst hätte nicht nur sein Ansehen eingebüßt, sondern wäre außerdem zum Gespött der Leute geworden.
Ali schüttelte den Schauer ab, der kalt über seinen Rücken kroch, und widmete seine ganze Aufmerksamkeit einer besonders kunstvoll verzierten Öllampe aus Messing. Er versuchte gerade anhand der Hammerschläge herauszufinden, wie alt jener Mann gewesen sein mochte, der dieses Messing bearbeitet hatte, als plötzlich die Tür aufging. Ali wandte sich um und sah zuerst den dunkelhäutigen Eunuchen eintreten, der sich bücken musste, um nicht mit dem Kopf gegen den Balken zu stoßen. Er stellte sich mit verschränkten Armen neben der Tür auf und starrte Ali so finster an, als wäre dieser sein Todfeind.
Ali konnte seinen Blick kaum von Jussuf abwenden. Er hatte nicht mehr gewusst, wie groß der Eunuch war, welch eine Angst einflößende Erscheinung. Und er fragte sich, ob es überhaupt je ein Mann wagen würde, eine der Frauen des Emirs anzusehen oder gar zu berühren, wenn Jussuf in der Nähe war.
Ein leises Hüsteln hinter seinem Rücken ließ Ali erschrocken herumfahren. Sein Magen hob und senkte sich. Da stand sie, die rätselhafte Frau. An ihren Augen, diesen blauen Augen, die als Einziges nicht vom Schleier verdeckt wurden, konnte er erkennen, dass sie lächelte. Verachtend? Herablassend? Gnädig? Oder vielleicht doch freundlich? Ali war nicht in der Lage, es zu deuten.
»Verzeiht, wenn ich Euch erschreckt habe«, sagte sie mit ruhiger, angenehm klingender Stimme. »Das war nicht meine Absicht. Aber ich fürchtete schon, Ihr hättet mich vergessen.«
Ali schluckte. Nicht genug damit, dass sie, wenn auch mit leichtem Akzent, das Arabisch einer gebildeten Frau sprach, sie richtete auch zuerst das Wort an ihn. Wollte sie ihn verhöhnen? Wollte sie ihm das ganze Ausmaß ihrer Verachtung zeigen? Oder wusste sie einfach nicht, dass es gegen alle Regeln der Höflichkeit war, als Frau und Sklavin das Gespräch mit einem Mann zu eröffnen?
»Du hast mich nicht erschreckt«, erwiderte er schnell, um ihr nicht den Triumph zu gönnen, ihn aus der Fassung gebracht zu haben. Doch er spürte, wie sich sein Gesicht mit flammender Röte übergoss. »Ich war nur in Gedanken versunken.«
Was um alles in der Welt machte er? Weshalb rechtfertigte er sich vor dieser Frau? Er musste den Verstand verloren haben. Oder hatte sie ihn etwa verhext?
Ali glaubte sich gleich übergeben zu müssen. Hätte er sich doch nur beim Mahl mit dem Emir zurückgehalten. Hastig drehte er sich um, ging zu seiner Tasche und atmete ein paar Mal tief durch. Tatsächlich besserte sich die Übelkeit etwas, aber sein Ärger über sich selbst blieb. Warum nur konnte er mit dieser Frau nicht fertig werden?
»Lege deinen Schleier ab, ich will dich untersuchen«, befahl er ihr barsch, während er in seiner Tasche nach etwas kramte, von dem er selbst nicht wusste, was es war. Aber wenigstens brauchte er sie dabei nicht anzusehen. Und diese Maßnahme half tatsächlich. Er gewann wieder einen Teil seiner Selbstsicherheit zurück, und als er sich ihr erneut zuwandte, gelang es ihm sogar, der Frau in die Augen zu sehen.
Beatrice legte den Schleier ab und beobachtete den Arzt, wie er geschäftig, aber scheinbar sinnlos in seiner Tasche herumwühlte. Er wirkte nervös und aufgeregt wie ein junger Student bei seinem ersten Patientenkontakt. Er sah gut aus mit seinen großen, dunklen, mandelförmigen Augen und den dichten schwarzen, kurz geschnittenen Haaren. Nur seine Wangen waren einen Hauch zu rundlich für Beatrices Geschmack. Vielleicht handelte es sich dabei um erste Anzeichen für ein drohendes Gewichtsproblem – oder einfach um Babyspeck. Denn nicht einmal sein dunkler Vollbart vermochte darüber hinwegzutäuschen, dass er für einen Arzt noch ziemlich jung war. Er konnte kaum älter als zwanzig sein. Als sie ihn das letzte Mal gesehen hatte, war ihr das gar nicht aufgefallen.
Beim Gedanken an ihre letzte Begegnung schämte Beatrice sich ein bisschen. Sie erinnerte sich gut daran, wie sie den Arzt angefahren hatte, weil er bei Mirwat keine Koniotomie durchgeführt hatte. Dabei konnte der arme Kerl gar nichts dafür. Selbst wenn er der beste und angesehenste Arzt seiner Zeit wäre, hatte er wohl kaum die nötigen physiologischen und chirurgischen Kenntnisse für diesen Eingriff. Beatrice war sich nicht einmal sicher, ob zu dieser Zeit überhaupt schon die Anatomie von Kehlkopf und Luftröhre bekannt war. Was mochte wohl in seinem Kopf vorgegangen sein, als er sie an Mirwat herumhantieren gesehen hatte? Hatte er sie für eine Verrückte oder für eine Hexe gehalten? Wahrscheinlich hatte er geglaubt, sie wolle die Lieblingsfrau des Emirs umbringen. Wenigstens meinte das Schicksal es gut mit ihr und hatte sie in ein islamisches Land verschlagen. Soweit sie sich noch an ihren Geschichtsunterricht erinnern konnte, waren die Moslems im Mittelalter geradezu ein Muster an Toleranz anderen Kulturen und Religionen gegenüber, von wenigen extremistischen Ausnahmen einmal abgesehen. Im christlichen Europa hingegen hatte man zur gleichen Zeit damit begonnen, alles, was man nicht verstehen konnte, dem Teufel zuzuschreiben und, nach langer, grausamer Folter, auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen.
Der junge Arzt trat wieder auf sie zu. Wie hieß er gleich? Beatrice konnte sich noch verschwommen daran erinnern, dass er ihr bei ihrer ersten Begegnung seinen Namen genannt hatte. Aber damals hatte sie noch kein Wort Arabisch verstanden. Sollte sie ihn fragen? Sie dachte kurz nach und entschied sich dagegen. Sie wollte ihn nicht noch mehr aus der Fassung bringen. Ihr würde der Name schon früher oder später einfallen. Und wenn nicht, würde Mirwat ihr sicherlich weiterhelfen.
»Ich beginne jetzt mit der Untersuchung«, sagte der junge Arzt überflüssigerweise. »Mach den Mund auf.«
Beatrice fragte sich, was er wohl damit bezweckte, da sie weder unter Zahn- noch Halsschmerzen litt und er ganz offensichtlich keinen Rachenspiegel oder eine Lampe zur Verfügung hatte. Unwahrscheinlich, dass er viel sehen konnte. Dennoch öffnete sie gehorsam ihren Mund.
Der junge Arzt betrachtete so eingehend ihre Zähne, als könne er daraus die Zukunft ablesen, runzelte die Stirn und schüttelte schließlich viel sagend den Kopf. Beatrice vermutete, dass er sich diese Verhaltensmuster angewöhnt hatte, um Patienten über seine Ratlosigkeit hinwegzutäuschen. Eine selbst im 21. Jahrhundert noch beliebte Gewohnheit unter Ärzten. Dann begann er ihren Schädel abzutasten. Sie spürte, wie seine Hände dabei vor Aufregung zitterten. Der junge Mann war so unglaublich nervös.
»Habt Ihr etwas herausgefunden?«, fragte sie freundlich, um ihm über seine Befangenheit hinwegzuhelfen. Doch was bei den vielen Studenten, die im Laufe der Jahre bei ihr ein Praktikum gemacht hatten, immer seine Wirkung getan hatte, schien bei diesem jungen Mann völlig zu versagen.
»Sprich nur, wenn du gefragt wirst!«, fauchte er sie so wütend an, dass Beatrice erschrocken zurückwich.
Was hatte sie ihm denn nur getan? Sie hatte doch lediglich ein wenig freundlich sein wollen. Aber anscheinend war Höflichkeit hier nicht erwünscht. Offensichtlich fühlte sich dieser Kerl in seiner Ehre gekränkt – warum oder wodurch, das stand in den Sternen.
Beatrice wurde allmählich wütend – diese männliche Überheblichkeit ging ihr gehörig auf die Nerven. Sie hatte nicht sechs Jahre lang Medizin studiert und fast ebenso lange als Chirurgin gearbeitet, um sich jetzt von einem jungen Angeber abkanzeln zu lassen, der noch nicht einmal wusste, wie man mit Patienten umzugehen hatte, und der von den Grundlagen der Chirurgie weniger Ahnung hatte als ihre Großmutter. Da fiel ihr wie aus heiterem Himmel sein Name wieder ein, wenigstens ein Teil davon – Ali. Der Kerl hieß Ali.
Sie atmete tief ein, um die Fassung zu bewahren. Bleib ruhig, Bea!, ermahnte sie sich. Er kann nichts dafür. Es ist die Zeit, in der er lebt. In diesem Jahrhundert gab es noch keine Frauen an den Universitäten.
Natürlich, das hatte sie beinahe vergessen. Sie befand sich nicht am Anfang des 21. Jahrhunderts, sondern am Ende des 10. Nicht er war hoffnungslos rückständig, sondern sie war es, die hier nicht herpasste. Sie war der Zeit, in der sie momentan lebte, viel zu weit voraus.
Während der junge Arzt seine Untersuchung fortsetzte, litt Beatrice förmlich Höllenqualen. Immer wieder wollte sie ihn korrigieren, ihm sagen, wie er die Reflexe prüfen könne und dass er auf die Art, wie er auf ihrem Bauch herumdrückte, niemals den Leberrand finden würde. Aber stattdessen hielt sie ihren Mund und biss die Zähne zusammen.
»Du kannst dich wieder verschleiern«, sagte er gnädig, als er die Untersuchung endlich abgeschlossen hatte.
Beatrice legte rasch den Schleier an – mittlerweile konnte sie es fast so schnell wie die anderen Frauen im Harem – und sah dem Arzt zu, wie er erneut geräuschvoll in seiner Tasche herumkramte. Als er jedoch seine Tasche ergriff und ohne ein Wort verschwinden wollte, konnte Beatrice sich nicht mehr beherrschen.
»Halt, nicht so schnell! Ein Patient hat ein Recht darauf, das Ergebnis einer Untersuchung zu erfahren«, sagte sie kühl. »Der Eid des Hippokrates gilt, wenn mich nicht alles täuscht, auch für Euch.«
Der junge Arzt, der gerade die Tür öffnen wollte, blieb stehen, als hätte ihn ein Peitschenhieb getroffen. Langsam drehte er sich zu ihr um. Sein Gesicht war kreidebleich. Mit weit aufgerissenen Augen starrte er sie an, als wäre sie eine Gestalt aus einem seiner schlimmsten Albträume.
»Woher ... woher kennst du den Eid des Hippokrates?«, fragte er atemlos.
Beatrice verschränkte die Arme vor der Brust und reckte provozierend ihr Kinn in die Höhe. »Ich habe ihn selbst geleistet. Das ist zwar schon ein paar Jahre her ...«
»Aber das kann nicht sein!«, rief Ali aus. »Das ist unmöglich! Weshalb solltest du ...«
»Ganz einfach«, fiel sie ihm ins Wort. »Weil jeder Arzt diesen Eid spätestens bei Beendigung seiner offiziellen Ausbildung leistet. Richtig?«
Beatrice kostete die Situation gnadenlos aus. Das blanke Entsetzen in seinen Augen, die Schweißperlen auf seiner Stirn erfüllten sie mit Genugtuung. Sollte er doch glauben, dass die Frauen in Germanien Priesterinnen einer Heilgöttin waren oder was auch immer. Dieser hochmütige junge Kerl verdiente es nicht anders.
»Nun, wie lautet Eure Diagnose, Herr Kollege?«
Er schnappte mühsam nach Luft, und Beatrice fragte sich, ob sie zu weit gegangen war. Der Farbwechsel in seinem Gesicht war beängstigend. Eben noch war er weiß wie ein Bettlaken, und jetzt glich er einer vollreifen Tomate. Vielleicht war er herzkrank oder litt unter Bluthochdruck?
Beatrice wollte ihm zu Hilfe eilen. In ihrem Kopf spulte sich das ganze Programm ab – den Patienten hinlegen mit leicht angehobenem Oberkörper, Pulse und Herztätigkeit überprüfen, Blutdruck messen, einen venösen Zugang legen. Die Erkenntnis traf sie wie ein Hammerschlag, dass sie dazu gar nicht in der Lage war. Sie konnte keinen Blutdruck messen. Herr Riva-Rocci, ein italienischer Arzt, der die Methode zur Messung des Blutdrucks erfunden hatte, würde erst in etwa achthundert Jahren geboren werden. Und wie sollte sie Ali einen venösen Zugang legen? Es gab im Mittelalter keine Kanülen. Und da sie keine blutdrucksenkenden Medikamente zur Verfügung hatte, wäre es ohnehin sinnlos gewesen. Natürlich konnte sie nach einer Alternative suchen, es gab sicherlich Kräuter, die eine blutdrucksenkende Wirkung hatten. Aber sie hätte sich zuerst mit den medizinischen Kräutern der arabischen Welt beschäftigen, die entsprechenden Pflanzen beschaffen und ihm dann einen Tee daraus zubereiten müssen – eine Prozedur, die unter Umständen Tage dauern konnte.
Dies hier war aber ein Notfall. Beatrice spürte, wie ein Gefühl in ihr hochstieg, das ihr in Notfallsituationen bislang unbekannt gewesen war – Panik. Sie hatte plötzlich Angst, dass der junge Mann vor ihren Augen sterben könnte, ohne dass sie auch nur einen Finger gerührt hatte. Ihre Gedanken überschlugen sich. Was konnte sie tun? Sie hatte nichts! Keine Medikamente, kein Stethoskop, keine Kanülen. Sie hätte höchstens mit einem Messer ... Natürlich! Das war die Rettung, ein Aderlass! Beatrice sah sich bereits nach einem geeigneten Gegenstand um, ein Messer, eine Brosche mit einer scharfen Nadel, irgendetwas, womit sie dem jungen Arzt eine Vene öffnen konnte, um seinen Kreislauf etwas zu entlasten. Da machte er endlich den Mund auf.
»Du bist völlig gesund«, stieß er heftig hervor, riss die Tür auf und stürmte hinaus, als wäre der Teufel hinter ihm her.
»Der hat es eilig«, ließ sich eine Stimme vernehmen.
Überrascht wandte sich Beatrice zu Jussuf um, den sie in ihrer Aufregung fast vergessen hatte. Der dunkelhäutige Eunuch stand immer noch regungslos wie eine Statue mit verschränkten Armen neben der Tür. Aber etwas stimmte nicht mit ihm. Es dauerte eine Weile, bis Beatrice herausfand, dass es das breite Lächeln war, das nicht in das gewohnte Bild passte. Jussuf, den sie nur mit grimmiger, wütender Miene kannte, grinste von einem Ohr zum anderen, unverkennbar zufrieden mit der Szene, die sich soeben vor seinen Augen abgespielt hatte. Offensichtlich hatte er nicht viel Sympathien für den jungen Arzt übrig, vielleicht hasste er ihn sogar. Beatrice fragte sich, woran das liegen konnte. Ob Ali der Arzt war, der jenen Eingriff vorgenommen hatte, welcher Jussuf zu einem Eunuchen machte?
»Hoffentlich habe ich es nicht zu weit getrieben«, sagte Beatrice. »Er sah aus, als ob er jeden Moment tot umfallen würde.«
Jussuf schnaubte verächtlich. »Er ist wie alle Turbanträger. Du bist eine starke Frau. Damit wird er nicht fertig.«
Beatrice sah den Eunuchen überrascht an. In seinen Worten schwang deutlich Anerkennung. Woher kam er? Weshalb war er im Harem des Emirs gelandet? Beatrice fiel auf, dass sie noch nie über Jussuf nachgedacht hatte, obwohl er sie und Mirwat nahezu auf Schritt und Tritt begleitete. Aber ihn auszufragen, das traute sie sich doch nicht.
»Lass uns wieder gehen, Jussuf«, sagte sie. »Ich glaube nicht, dass der Arzt noch einmal zurückkommt.«
Jussuf nickte. Einträchtig nebeneinander wie zwei gleichgestellte Freunde kehrten sie in den Teil des Palastes zurück, der den Frauen vorbehalten war.
Als Ali in das private Arbeitszimmer des Emirs trat, sprang Nuh II. hoch und eilte ihm entgegen.
»Nun, was sagt Ihr, Ali al-Hussein? Kann ich die Sklavin endlich zu mir nehmen?«
Doch Ali achtete nicht auf das Drängen des Emirs. Er war noch zu sehr damit beschäftigt, sein inneres Gleichgewicht wiederzufinden. Was diese Frau gesagt hatte, hatte ihn in den Grundfesten seiner Seele erschüttert. Alles, woran er glaubte und was er wusste, schien innerhalb weniger Augenblicke in Frage gestellt worden zu sein. War es möglich, dass diese Frau tatsächlich eine ... Er mochte an diese Ungeheuerlichkeit nicht einmal denken. Aber wie konnte eine Frau sonst vom Eid des Hippokrates wissen, wenn sie nicht in Medizin unterrichtet worden war?
»Verehrter Ali al-Hussein, was ist mit Euch los?« Die besorgte Stimme des Emirs riss Ali aus seinen Gedanken. »Ist Euch nicht wohl? Ihr seht aus, als wäre Euch soeben ein Dämon begegnet.«
Nuhs Worte trafen Ali wie ein Faustschlag. War dies vielleicht die Lösung? War diese Frau gar kein Mensch, sondern ein Dämon, von den Mächten der Hölle ausgesandt, um ihn zu verderben? Im nächsten Augenblick musste Ali über sich selbst lächeln. Er glaubte eigentlich nicht an derartige Erscheinungen – Dämonen, Dschinnen, Geister und Feen waren nichts als Märchengestalten. Man konnte mit ihnen Kinder und einfache Gemüter ängstigen, für ihre Existenz gab es jedoch keine rationalen Beweise. Dass er allerdings diese Möglichkeit, wenn auch nur für einen Augenblick, ernsthaft in Erwägung gezogen hatte, zeigte ihm das ganze Ausmaß seiner Verwirrung. Diese Frau hatte ihn durcheinander gebracht. So sehr, dass er darüber sogar seine eigenen Überzeugungen vergaß.
»Nein, nein, es ist nichts«, sagte er und versuchte sich zu beherrschen. Zu Hause konnte er sich seinen Gedanken und Spekulationen hingeben und sich vor innerer Verzweiflung die Haare raufen, jedoch nicht in Gegenwart des Emirs. »Ich war in Gedanken nur mit einem überaus komplizierten Fall beschäftigt.«
Nuh II. riss vor Entsetzen die Augen auf. »Meine Sklavin?! Was ist mit ihr? Könnt Ihr ihr helfen, oder muss ich mich von ihr trennen? Ist es etwas Ansteckendes? Ist vielleicht schon mein ganzer Harem ...«
Ali nahm sich zusammen. »Aber nicht doch, Nuh II. ibn Mansur«, sprach er beruhigend auf den aufgeregten Emir ein. »Es ist nichts dergleichen. Ihr braucht Euch überhaupt keine Sorgen zu machen. Eure Sklavin ist gesund.«
Nuh II. sah ihn ungläubig an. »Sie ist gesund?«
Ali nickte. »Ja, sie ist vollkommen gesund.«
»Dann kann ich sie also endlich zu mir holen lassen?«
»Ja, das könnt Ihr«, antwortete Ali ohne ehrliche Überzeugung. Im Gegenteil, er hatte plötzlich das ungute Gefühl, dadurch eine Katastrophe heraufzubeschwören. Wie konnte er seine Worte zurücknehmen, ohne sich selbst zu widersprechen? »Aber ich muss Euch warnen. Seid vorsichtig. Diese Frau ist nicht wie andere Sklavinnen. Sie stammt aus Germanien, und ihre Sitten sind ein wenig roh und fremdartig. Vermutlich wird sie sich nicht so verhalten, wie Ihr es erwartet. Mich hat sie auch ein paar Mal überrascht.«
»Glaubt Ihr etwa, dass diese Sklavin gefährlich ist?«
Ali nickte eifrig. »Unter Umständen. Ihr solltet Sie auf keinen Fall in Euer Schlafgemach holen, ohne dass genügend Wachen bereitstehen.« Ali war froh, dass ihm diese Wendung eingefallen war. Was kümmerte ihn das lüsterne Leuchten in den Augen des Emirs? Sollte Nuh II. doch ruhig von wilden Schlachten in seinem Bett träumen, gegen die die Nächte mit Mirwat zu harmlosen Spielereien herabsanken. Er, Ali, hatte seine Schuldigkeit getan. Er hatte den Emir gewarnt, und wenn nun doch etwas geschah – niemand würde ihn dafür zur Verantwortung ziehen können.
Ali verabschiedete sich von Nuh II., der es plötzlich recht eilig hatte, sich von seinem Gast zu trennen, und wurde von einem Diener hinausgeleitet. Im Hof des Palastes vor dem Tor stand schon die Sänfte bereit, die Ali nach Hause bringen sollte. Während die Träger ihn ruhig und sicher durch die Straßen Bucharas beförderten, dachte Ali nach. Die Wunde, die ihm die seltsame Frau geschlagen hatte, schmerzte noch immer. Wer war sie? Ein Kräuterweib? Vielleicht. Das war unter Umständen möglich. Aber sie konnte doch niemals ein Arzt sein.
Als ihn die Träger schließlich abgesetzt hatten und ihn wieder die Ruhe und der Frieden seines eigenen Hauses umfingen, traf Ali einen Entschluss. Kaum dass er sich seines Mantels entledigt hatte, ließ er seinen Laufburschen zu sich rufen. Ihm gab er den Auftrag, zur Bibliothek von Buchara zu gehen und dort alles, was in Buchara und Umgebung über die Sitten und Bräuche in Germanien geschrieben war, zusammenzutragen und ihm zu bringen. Vielleicht würde er auf diesem Wege erfahren, was es mit dieser Frau auf sich hatte.
Ahmad al-Yahrkun stand im Schlafgemach des Emirs und betrachtete das Werk seines Herrn mit gerunzelter Stirn. Nuh II. hatte alles sorgfältig vorbereiten lassen. Ein halbes Dutzend kleine Öllampen tauchten den Raum in ein gedämpftes Licht, frische seidene Laken lagen auf dem breiten Bett, das durch die geschickten Hände der Diener nach Rosen und Jasmin duftete, mit Orangenblüten gefüllte Messingschalen standen am Fußende des Bettes. Alles deutete auf eine erfüllende Nacht hin, und Ahmad hätte sich keine Sorgen gemacht, wenn da nicht die Felle auf dem Boden und die schweren Eisenketten an den Bettpfosten gewesen wären. Nachdenklich strich er sich durch seinen allmählich ergrauenden Bart. Was hatte Nuh II. vor? Wozu brauchte er die Felle und Ketten?
Seit Nuh II. ibn Mansur die Nachfolge seines Vaters als Emir von Buchara angetreten hatte, war Ahmad sein Berater und engster Vertrauter. Vielleicht hätte Nuh II. ihn sogar seinen einzigen wahren Freund genannt, wenn der Standesunterschied zwischen den beiden Männern es zugelassen hätte. Sie kannten sich bereits ihr ganzes Leben lang. Schon Ahmads Vater, Großvater und Urgroßvater hatten den Emiren als Berater zur Seite gestanden. Seit es das Emirat von Buchara gab, hatten viele Herrscherfamilien den Thron bestiegen und waren, nach kurzer oder langer Regentschaft, von einer anderen Familie verdrängt oder abgelöst worden. Doch stets, über Dynastien und fast drei Jahrhunderte hinweg hatte der Erstgeborene der Familie Yahrkun dem amtierenden Herrscher mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Natürlich war die Familie über diese Zeit hinweg immer wieder Neid und Missgunst ausgesetzt gewesen. Böse Zungen behaupteten gar, sie wären die eigentlichen Herrscher in Buchara und sie verdienten es, dass man sie endlich aus der Stadt vertrieb. Doch zum Glück hielt Allah immer seine schützende Hand über der Familie Yahrkun, vermehrte ihr Ansehen und ihren Reichtum langsam, aber stetig und bewahrte sie vor allzu großem Übel. Und niemand in Buchara konnte sich einen Thron vorstellen, an dessen Seite kein Yahrkun stand.
Es war also nicht ungewöhnlich, dass die beiden fast gleichaltrigen Jungen Nuh II. und Ahmad gemeinsam aufwuchsen und zu Männern heranreiften. Sie hatten zusammen reiten und jagen gelernt, die Erfahrungen ihrer ersten Liebe miteinander geteilt und waren schließlich gemeinsam älter geworden. Ahmad kannte Nuh II. fast besser als sich selbst. Er wusste, wie er dessen Unbeherrschtheit und Ungeduld zügeln konnte, und hatte ihn im Laufe der Jahre mehr als einmal vor einer Torheit bewahrt. Oft kannte Ahmad Nuhs Gedanken, noch bevor dieser sie überhaupt gedacht hatte. Aber was der Emir heute Abend vorhatte, das vermochte er nicht zu erraten. War das der Grund für die Übelkeit, die ihn plagte, seit er das Schlafgemach betreten hatte, oder war es eine Ahnung von drohendem Unheil?
Die Tür ging auf, und Nuh II. kam herein.
»Wunderbar!«, rief er aus und rieb sich in Vorfreude die Hände wie ein kleiner Junge. »Wie ich sehe, ist alles bestens vorbereitet.«
»Ja, mein Gebieter, es ist in der Tat alles für eine Nacht der Freuden vorbereitet«, sagte Ahmad langsam. »Aber gestattet mir eine Frage: Wozu benötigt Ihr die Felle und die Ketten?«
»Ich dachte mir, dass es vielleicht den Bedürfnissen der Frau mit dem Goldhaar eher entspricht als seidene Laken.«
»Der Frau mit dem Goldhaar?«, fragte Ahmad und konnte sein Entsetzen kaum verbergen. »Ihr meint doch nicht etwa die hoch gewachsene Sklavin aus dem Norden, die Ihr vor kurzem erworben habt?«
»Nun, für meine Begriffe ist es schon ziemlich lange her, dass ich sie kaufte, doch du hast Recht, Ahmad, jene Sklavin meine ich.«
»Aber sie sollte doch noch einmal untersucht werden. Hat Ali al-Hussein ...«
»Er hat sie vor einigen Stunden untersucht und mir versichert, dass sie völlig gesund ist«, entgegnete der Emir scharf. »Ich will nicht länger warten. Ich habe sie nicht erworben, damit sie in meinem Garten herumspaziert. Hast du Einwände?«
Ahmad schwindelte es. Nur wenig, was im Palast vorging, blieb ihm verborgen. Dass ihm ausgerechnet der Besuch von Ali al-Hussein entgangen war, war unverzeihlich. Er hatte vorher mit dem Arzt sprechen wollen, um sein Urteil über jene Sklavin zu beeinflussen. Ahmad fielen auf Anhieb etwa ein Dutzend gute Gründe ein, weshalb Nuh II. sich lieber nicht mit dieser Frau einlassen sollte. Einer davon war, dass ihm diese Sklavin nicht geheuer war. Niemand wusste, woher sie wirklich kam. Und sie hatte etwas in ihrem Blick, das Ahmad eher an einen Mann denn an eine Frau erinnerte. Ein anderer Grund hieß Fatma. Sie war die erste Frau des Emirs gewesen, bis die junge, schöne, unbeschwerte Mirwat aufgetaucht war und Nuh II. diese zu seiner Lieblingsfrau erkoren hatte. Seither spuckte Fatma Gift und Galle, sobald sie sich zurückgesetzt fühlte. Und ausgerechnet diese Nacht, das wusste Ahmad ganz genau, war eigentlich für sie bestimmt gewesen.
»Verzeiht mir, mein Gebieter«, begann Ahmad vorsichtig. Nuh II. hasste es zwar, wenn ihm widersprochen wurde, aber darauf konnte er keine Rücksicht nehmen. Die Zeit war zu knapp. »Ihr hattet Fatma für heute Nacht zu Euch gebeten. Und ich lege Euch nahe, Herr, Euch an diese Zusage zu halten.«
»Beim Barte des Propheten, weshalb sollte ich das tun?«, rief Nuh II. erbost aus. »Bin ich nicht der Emir von Buchara? Gelten nicht mein Wort und mein Befehl in der ganzen Stadt? Was hat eine Frau mir zu sagen? Wenn Fatma kommen will, soll sie morgen zu mir kommen. Heute will ich die Nacht mit der Sklavin aus dem Norden verbringen.«
»Nun, Herr, wenn Ihr es durchaus wünscht, so werde ich gehen und die Angelegenheit mit Fatma persönlich besprechen«, erwiderte Ahmad. »Das ist sicherlich besser, als wenn sie die Nachricht durch einen Boten erreicht. Ich kann nur hoffen, dass sie es auch versteht.«
»Was willst du damit sagen, Ahmad?«
Ahmad zuckte mit den Schultern. »Ihr kennt Fatma, Herr. Sie ist immer noch wütend, weil Mirwat ihren Platz an Eurer Seite eingenommen hat, und sie wird gewiss nicht erfreut sein, wenn ihr ihre Rechte nun auch noch von einer Sklavin streitig gemacht werden.«
Nachdenklich strich sich Nuh II. durch seinen Bart. »Was denkst du, was könnte sie tun?«
Ahmad stieß einen Seufzer aus und hob seine Hände theatralisch zum Himmel. »O mein Gebieter, das weiß nur Allah. Bedenkt jedoch das alte Sprichwort: Eine enttäuschte Frau ist wie ein Dämon; sie ist zu jeder Bosheit fähig. Und Fatma hat ihren Einfluss im Harem noch nicht eingebüßt ...«
Nuh II. runzelte die Stirn und lief nervös im Raum auf und ab, während Ahmad, äußerlich ruhig und gelassen, wartete. Aber in seinem Inneren betete er zu Allah, dass Nuh II. sich doch noch anders entscheiden möge.
»Also gut!«, rief Nuh II. schließlich wütend aus. »Heute Nacht wird Fatma bei mir sein.«
Ahmad atmete erleichtert auf und schickte ein Dankgebet zum Himmel. Allerdings hatte er bereits geahnt, welche Entscheidung Nuh II. treffen würde. Der Emir mochte zwar unbeherrscht, vergnügungssüchtig und zuweilen sogar jähzornig sein, aber dumm war er nicht.
»Das ist eine weise Entscheidung, mein Gebieter«, sagte er und verbeugte sich ehrfürchtig.
»Vielleicht«, zischte Nuh II. wütend. »Angeblich bin ich der Herrscher von Buchara, aber in Wahrheit bin ich nichts weiter als der Sklave meines Harems, den Ränken und Wünschen der Weiber hilflos ausgeliefert. Ich sage dir, Ahmad, wenn ich die Wahl hätte, würde ich auf der Stelle mit meinem Stallburschen tauschen. Der hat nur eine Frau.«
»Ich verstehe Euch, mein Gebieter, aber ...«
»Ich weiß, ich habe keine andere Wahl«, stieß Nuh II. hervor. »Unruhe im Harem ist das Schlimmste, was einem Herrscher passieren kann. Das ist eine Nacht mit einer Sklavin nicht wert, selbst wenn sie noch so leidenschaftlich wäre. Wie die Dinge stehen, muss ich dir dankbar sein, Ahmad. Du hast mich auf diesen Fehler aufmerksam gemacht und dadurch wahrscheinlich Schlimmes verhindert. Geh jetzt, und lass Fatma zu mir bringen.«
Ahmad verbeugte sich und verließ das Schlafgemach. Bevor er die Tür hinter sich schloss, hörte er noch, wie Nuh II. mit einem wütenden Fußtritt eine der Messingschalen quer durch den Raum schleuderte.
Ahmad war zufrieden. Für den Augenblick hatte er die rätselhafte Frau aus dem barbarischen Norden von Nuh II. fern gehalten. Nun konnte er sich in Ruhe darum kümmern, dass sie unter Beobachtung blieb. Er hatte seine Kontakte, und die würde er jetzt nutzen. Und vielleicht gelang es ihm sogar, Dinge herauszufinden, die Nuh II. davon überzeugen würden, diese seltsame Frau aus dem Norden wieder dahin zu schicken, woher sie kam – in die Wüste.
Ahmad ging in sein Arbeitszimmer und schloss die Tür hinter sich. Er bewohnte zwar ein eigenes großzügiges und überaus komfortabel eingerichtetes Haus außerhalb des Palastes, das sich bereits seit vielen Generationen im Besitz der Familie Yahrkun befand, aber dort war er selten anzutreffen. Meistens zog er sich in dieses Zimmer zurück. Es war schlicht eingerichtet. Nur wenige kostbare Teppiche bedeckten den Boden und die weiß getünchten Wände. Zwei Sitzpolster, zwei niedrige Tische und eine Truhe aus Ebenholz bildeten die ganze Einrichtung. Ein schmales Fenster mit einem schlichten geschnitzten Gitter davor ließ Licht und Luft in den Raum, und auf dem Sims davor gurrten Tauben. Dieses Zimmer war ein Ort der Ruhe und des Friedens für Ahmad. Hierhin konnte er sich zurückziehen, um nachzudenken oder zu beten. Und dennoch verlor er von hier aus nie die Geschehnisse im Palast aus den Augen.
Ahmad nahm auf einem der Sitzpolster Platz und zog den niedrigen Schreibtisch näher. Er öffnete einen Kasten aus Ebenholz und holte Feder, Tinte und ein kleines Stück Papier heraus. Hastig kritzelte er eine Nachricht darauf, rollte sie zusammen und steckte sie in eine kleine goldene Röhre. Dann öffnete er das Fenstergitter. Das Gurren der Tauben wurde lauter, als sie ihren Herrn erblickten. Zutraulich rieben sie ihre Köpfe an seinen Händen. Lächelnd streichelte Ahmad den beiden schneeweißen Tauben über das Gefieder. Doch nicht sie, seine kostbaren Lieblinge, sollten ihm heute einen Dienst erweisen. Er griff nach der dritten Taube. Sie sah mit ihrem unscheinbaren grauen Gefieder aus wie alle wild lebenden Tauben, die in Buchara auf den Dächern der Häuser und den Kuppeln der Moscheen ihre Nester bauten. Sie war unauffällig. Geschickt band Ahmad die Röhre an dem Bein der Taube fest.
»So, meine Kleine, sei schön vorsichtig«, flüsterte er dem Tier zu und streichelte zärtlich über ihr Gefieder. »Und nun flieg, flieg zu deinem Herrn!«
Er warf sie in die Luft und beobachtete fasziniert, wie die Taube höher und immer höher stieg, über der Kuppel des Palastes eine Runde drehte und dann nach Westen davonflog.
»Allah schütze dich auf deinem Flug«, murmelte Ahmad.
Er liebte die Tauben, als wären sie seine Kinder. Jedes Mal, wenn er eine von ihnen aufließ, machte er sich Sorgen um ihr Wohlergehen. Sogar für diese Taube, die ihm gar nicht gehörte, fühlte er sich verantwortlich. Wenn sie nun einem Falken in die Klauen geriet? Oder gar gejagt wurde? In Buchara gab es genügend roh gesittete Menschen, die mit Pfeil und Bogen auf Taubenjagd gingen. Diese Barbaren brieten die Täubchen an Spießen, sie kochten das Fleisch und bereiteten daraus Pasteten zu. Dieselben Menschen weigerten sich hingegen standhaft, Pferdefleisch zu verzehren, und wären vermutlich eher verhungert, als auch nur einen Bissen davon zu sich zu nehmen. Mit einem Seufzer schloss er das Gitter wieder und wandte sich vom Fenster ab.
Ahmads Gedanken wanderten erneut zu Nuh II. und der Frau aus dem Norden. Erleichtert ließ er sich auf sein Sitzpolster fallen und streckte die Beine aus. Er hatte getan, was ihm zu diesem Zeitpunkt möglich war, hatte versucht sein Versäumnis, sich nicht schon viel eher um diese rätselhafte Frau gekümmert zu haben, wieder gutzumachen. Jetzt blieb ihm nichts anderes übrig, als die Antwort auf seinen Brief abzuwarten. Dann würde er weitersehen.
Aber um Fatma tat es ihm ehrlich Leid. Arme Fatma! Sie konnte nichts dafür, und doch würde Nuh II. ohne Zweifel seinen Zorn und seinen Unmut an ihr auslassen. Die heutige Nacht würde für sie bestimmt kein Genuss werden.