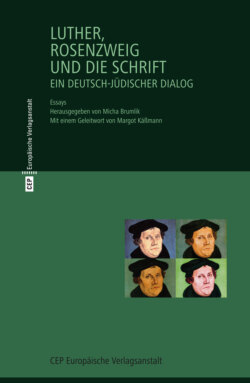Читать книгу Luther, Rosenzweig und die Schrift - Franz Rosenzweig - Страница 11
IV
ОглавлениеDenn die Stimme dieses Buches darf sich in keinen Raum einschließen lassen, nicht in den geheiligten Innenraum einer Kirche, nicht in das Sprachheiligtum eines Volks, nicht in den Kreis der himmlischen Bilder, die über eines Landes Himmel ziehen. Sie will immer wieder von draußen schallen, von jenseits dieser Kirche, von jenseits dieses Volks, von jenseits dieses Himmels. Sie verwehrt nicht, daß ihr Schall sich echohaft in Räume verfängt, aber sie selber will frei bleiben. Wenn sie irgendwo vertraut, gewohnt, Besitz geworden ist, dann muß sie immer wieder aufs neue als fremder, unvertrauter Laut von draußen die zufriedene Gesättigtheit des vermeintlichen Besitzers aufstören. Dies Buch, es allein unter allen Büchern der Menschheit, darf nicht im Schatzhaus ihres Kulturbesitzes sein Ende finden; weil es nämlich überhaupt nicht enden soll. In der Bibliothek jenes Schatzhauses liegen alle Bücher, die je geschrieben sind; die meisten verstaubt, vergessen, selten einmal gefordert; manche täglich verlangt. Auch die Bibel liegt in diesen Magazinen, in vielen hundert Sprachen, Sprachen der Völker, Sprachen der Künste, Sprachen der Wissenschaften, Sprachen der Institutionen, Sprachen der Programme. Ihre Ausleihziffer ist höher als die jedes andern Buchs, und trotzdem sind stets noch Exemplare vorhanden. Da betritt irgendein Besteller die Ausleihe und verlangt sie. Der Diener kommt zurück: kein Exemplar mehr vorhanden. Die Bibliothekare sind entsetzt, verzweifelt, ratlos: eben, als Frau Professor Vorgestern für ihren Mann eine holte, standen noch alle Regale voll. Um dieses einen Bestellers willen ist sie geschrieben.
Die Lutherbibel war, als sie entstand, das was die Bibel sein soll und wodurch sie, so oft sie es ist, sich als ein einziges unter allen menschlichen, bloßmenschlichen Büchern bewährt: eine Sensation. Das sieht man sowohl aus den Auflageziffern, die Hans Lufft druckte, wie aus den Preisen9, wie endlich aus der Menge der Nachdrucke. Und negativ sieht man es aus dem Entsetzen „Meister Klüglings“, des „verdrießlichen Manns“, der aus „großem Neid“, daß er selber „nichts Gutes machen kann, doch damit Ehre erjagen und Meister sein will, daß er fremde gute Arbeit lästern und schänden kann“10, dieser Lustspielfigur, zu der sich Luther in seinen Bibelvorreden die Personen seiner Kritiker ohne Ansehn der Person zusammengeballt hat: der weiß ja auch, was die Bibel ist, und tobt nun, daß Luthers „gar ein ander Buch denn die lateinische Bibel sei“11, er hat doch seinen „bewährten Text“12, warum geht Luther von dem ab? nicht einmal die Namen13 gibt diese „Haderkatz“14 so, wie sie dem Volk aus der lateinischen Bibel vertraut sind, sondern nähert sie den unvertrauten hebräischen Formen an! er will doch mit Recht seine Bibel nur so verdeutscht haben, wie sie von je „gesungen, gelesen, gebraucht und angenommen ist von der heiligen lateinischen Kirche und sich nicht kümmern lassen, wie es in Jüdisch, Griechisch oder Chaldäisch laute“15.
Dieser Posaunenton in das Ohr der über ihrem Besitz des „angenommenen und bewährten Texts“16 zufrieden Eingeschlafenen ist die Lutherbibel nicht geblieben; sie wurde selber Besitz, nationaler Besitz. Die große überhistorisch-historische Sensation konnte sie nur in den Jahrzehnten ihrer Entstehung bleiben; nachher sind die großen historischen Wirkungen, die von ihr ausgehen, Wirkungen in die einzelnen Kanäle des Kultursystems; Wirkungen also gewiß auch auf den „religiösen Anteil“ der Kultur, aber eben als auf einen Teil; so hat sie vom ausgehenden sechzehnten bis ins beginnende achtzehnte Jahrhundert das protestantische Kirchenlied bis zu den Gipfeln der Bachschen Passionen befruchtet, so vom achtzehnten ins neunzehnte die Dichtersprache der Klassik und Romantik bis hinauf zum Goetheschen Faust; ein Sturm, der das Gewässer des nationalen Lebens aufwühlt, bevor es noch in seine Kanäle gefaßt, verfaßt ist, wurde sie nicht ein zweites Mal, konnte sie, Besitz geworden und so aufs neue „an die Kette gelegt“, nicht wieder werden. Auch der Einzelne verteidigt heut in ihr Besitz, kirchlichen, nationalen, kulturellen; darum hat er ein Recht dazu, – Vollmacht nicht.
Es ist historisch gesehen kein Zufall, daß wenigstens bis ins achtzehnte Jahrhundert hinein noch die innere Kirchengeschichte des deutschsprachigen Protestantismus sich an ihr abspielte. Seit Mitte des achtzehnten Jahrhunderts treten, vorerst meist in grotesker Gestalt, die Versuche auf, sie zu ersetzen, – karikaturhafte Randzeichnungen zu einem sehr ernsten historischen Text: dem Wanken des alten festumschriebenen Glaubensbegriffs, der, wie zu Beginn gezeigt, die bis ins einzelne formbestimmende raft der Lutherschen Übersetzung war. Heute ist dieser Prozeß, in seiner negativen Hälfte wenigstens, zum Abschluß gekommen; denn auch die verschiedenen Orthodoxieen, auch wenn sie in den öffentlichen Formulierungen Rücksicht auf den Zusammenhang mit dem eigenen Mittelalter und mit dessen Spätlingen in ihren Reihen nehmen zu müssen meinen, begründen doch vor sich selber ihren Glauben nicht mehr mittelalterlich. Aber positiv hat der Prozeß, obwohl auch diese Seite schon gleich mit seinen Anfängen anfängt, erst begonnen; auch das zeigt sich am deutlichsten an den Orthodoxieen, nämlich an ihrem hemmungslosen Mitmachen der gegnerischen Argumentationen. So sagt, wer das Positive zu sagen versucht, es heute auf eigene Verantwortung; mag es auch viele geben, die sein Bekenntnis mitsprechen können, er sieht sie nicht, die Stimmen einen sich nicht zum Chor. Trotzdem ist, was er zu sagen hat, wenn es nur Wort um Wort aus echter Erfahrung geschöpft ist, nicht „subjektiv“; und die Lieblingswissenschaft des modernen gelehrten Schilda, die mit schildbürgerlichem Ernst das Fernrohr auseinandernimmt, weil sie hofft, darin die Sterne zu finden, die „Religionspsychologie“, hat an ihm ihr Spiel verloren.
Dieser Mensch ist kein Gläubiger, aber auch kein Ungläubiger. Er glaubt und er zweifelt. Er ist also nichts, aber er lebt. Genauer: er hat Glauben oder Unglauben nicht, sondern Glaube und Unglaube geschehen ihm. Ihm liegt nichts ob, als dem Geschehen nicht davonzulaufen, und wenn es geschehen ist, ihm zu gehorchen. Das klingt beides, solange man weit vom Schuß ist, wie nichts; es ist aber so schwer, daß wohl keiner lebt, der es immer, – nein, wohl keiner, der es mehr als seltene gezählte Male fertiggebracht hat.
Wer so lebt, kann an die Bibel nur herantreten mit einer Bereitschaft zum Glauben und Unglauben, nicht mit einem umschreibbaren Glauben, den er in ihr bestätigt findet. Doch ist auch seine Bereitschaft unumschrieben, unbegrenzt. Ihm kann alles glaubhaft werden, auch das Unglaubenswürdige. Ihm ist nicht das Glaubenswürdige eingesprengt zwischen nicht Glaubens-, also doch Unglaubenswürdiges, wie Metalladern in Gestein, oder jenes mit diesem verbunden wie das Korn der Ähre mit ihrem „strohernen“ Anteil; sondern wie ein Scheinwerfer für eine Weile ein Stück der Landschaft aus dem Dunkel heraushebt, dann wieder ein andres, dann abgeblendet wird, so erhellen diesem Menschen die Tage seines Lebens die Schrift und lassen ihn in ihren Menschlichkeiten heut hier und morgen da – und das Heut übernimmt keine Bürgschaft für ein Morgen – das mehr als Menschliche erkennen. Im Menschlichen selbst; sie ist überall menschlich. Aber allerorten kann dieses Menschliche unter dem Lichtstrahl eines Lebenstages durchsichtig werden, derart, daß es diesem Menschen plötzlich in die eigene Herzmitte geschrieben ist und ihm das Göttliche im menschlich Geschriebenen für die Dauer dieses Herzschlags ebenso deutlich und gewiß ist wie eine Stimme, die er in diesem Augenblick in sein Herz rufend vernähme. Nicht alles in der Schrift gehört ihm, – heute nicht und nie. Aber er weiß, daß er allem gehört. Diese Bereitschaft, sie allein, ist, auf die Schrift gewendet, sein Glaube.
Ist es nicht klar, daß auf dem Grunde solchen Glaubens die Schrift anders gelesen und also auch anders gemittelt werden muß als Luther las und mittelte? Muß nicht jener Grund, der Luther veranlaßte, bisweilen der hebräischen Sprache Raum zu lassen und die deutsche Sprache auszuweiten, bis sie sich der hebräischen Worte gewohne, nämlich wo es um die „Lehre“ und den „Trost unsres Gewissens“ ging, muß nicht jener Grund uns, die wir nicht wissen, aus welchem Wort die Lehre und der Trost fließen werden, und die glauben, daß die verborgenen Quellen der Lehre und des Trostes aus jedem Wort dieses Buchs einmal aufbrechen können, uns also zu einer neuen Ehrfurcht vor dem Wort beugen? einer Ehrfurcht, die notwendig auch unser Lesen, unser Verstehen, und also unser Übersetzen erneuern wird?