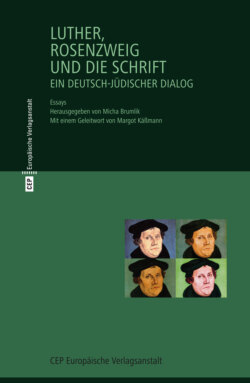Читать книгу Luther, Rosenzweig und die Schrift - Franz Rosenzweig - Страница 6
Margot Käßmann Geleitwort
Оглавление„Meister der Verdeutschung der Bibel“, so wird Franz Rosenzweig auf einer Gedenktafel an seinem ehemaligem Wohnhaus in Frankfurt (Main) bezeichnet. Die Ehrung bezieht sich auf die Übersetzung der hebräischen Bibel ins Deutsche. Als Franz Rosenzweig in den 1920er Jahren gemeinsam mit Martin Buber an der „Verdeutschung der Schrift“ arbeitete, war er bereits schwer erkrankt und konnte aufgrund einer Lähmung nicht mehr sprechen. Die Schrift aber brachte er mit seiner Übersetzung, die Martin Buber nach Rosenzweigs Tod fertig stellte, neu zum Klingen. Dass ihre Stimme nicht verstummt oder aber vor lauter Vertrautheit überhört wird, war Rosenzweig wichtig: „Die Stimme dieses Buches darf sich in keinem Raum einschließen lassen, nicht in den geheiligten Innenraum einer Kirche, nicht in das Sprachheiligtum eines Volkes“, betonte er einmal. Und: „Wenn sie irgendwo vertraut, gewohnt, Besitz geworden ist, dann muss sie immer wieder aufs Neue als fremder, unvertrauter Laut von draußen die zufriedene Gesättigtheit des vermeintlichen Besitzers aufstören.“ Das war vor 500 Jahren auch ein Anliegen der Reformation: Die Bibel allen Menschen zugänglich zu machen. Unabdingbare Voraussetzung dafür war die Übersetzung. Martin Luther war nicht der erste, der sie ins Deutsche übertrug. Doch er hat die sprachlich eindrücklichste und prägendste Übersetzung geschaffen, die bis heute Menschen auf der ganzen Welt fasziniert.
1522 erschien das Neue Testament, 1534 die gesamte Bibel in deutscher Sprache.
Mit seiner Übersetzung wollte Martin Luther möglichst vielen Menschen die Lektüre der Heiligen Schrift ermöglichen, die für ihn die wesentliche Grundlage seines Glaubens darstellte. Mit sprachlichem Feingefühl und Wortschöpfungskraft übertrug er die alten Texte in ein Deutsch, das „die Mutter im Hause, die Kinder auf der Gasse, der gemeine Mann auf dem Markt“ verstehen konnten. Das kam einer Revolution der Bibelrezeption gleich, denn dadurch wurde jeder Einzelne in die Lage versetzt, einen eigenen Zugang zu Gottes Wort zu finden.
Die Bibel in der Sprache des Volkes wurde zu einem wesentlichen Impuls der Reformation. In vielen Ländern machten sich Übersetzer ans Werk, damit die Geschichte Gottes mit den Menschen in ihrer jeweiligen Landessprache lesen und sich eine eigene Meinung bilden konnten.
Die Übersetzung Franz Rosenzweigs und Martin Bubers ist wortmächtig in einer anderen Art und fasziniert mich ebenfalls. „Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde aber war Irrsal und Wirrsal. Finsternis über Urwirbels Antlitz“ (1 Mose 1f.) – was für ein beeindruckender Einstieg in das erste Buch der Schrift. Oder aber Habakuk 2,4, ein Satz, den Paulus in seinem Brief an die Römer (1,17) zitierte und der Martin Luther einst zu seiner reformatorischen Erkenntnis führte: „Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben“, übersetzte Luther. In der Buber-Rosenzweig-Übersetzung heißt es kraftvoll und poetisch: „… dieweil der Bewährte leben wird durch sein Vertrauen“. Nur zwei von unzähligen faszinierenden Beispielen. Quasi als Vorarbeit dazu lässt sich Franz Rosenzweigs Aufsatz „Die Schrift und Luther“ lesen, in der er sich tiefgründige Gedanken über das Übersetzen macht und Luthers Übersetzungsarbeit kritisch würdigt.
Micha Brumlik ist zu verdanken, dass diese Überlegungen Franz Rosenzweigs wieder ins Interesse der Öffentlichkeit rücken. Die klugen Beiträge im vorliegenden Buch werden die Diskussion im 500sten Gedenkjahr der Reformation und den christlich-jüdischen Dialog befruchten. Dass sich Micha Brumlik dem Thema widmet, verspricht einen originellen und kreativen Zugang. Brumlik ist ein Querdenker mit Sinn für die Wurzeln, das gefällt mir. Wir brauchen Querdenker in einer Zeit, die zu Anpassung und Mainstream neigt, in der es so viel einfacher ist, stromlinienförmig zu sein als anzuecken. Mir imponiert, dass er es sich nicht leicht gemacht hat, gerade auch in den Fragen der Religion. In gewisser Weise ist er ein Seismograf für die Suche nach jüdischer Identität in Deutschland nach der Shoah. Und dabei war – und ist! – er streitbar. Als lutherische Theologin teile ich diese Leidenschaft für das Ringen um Position, die kritische Auseinandersetzung mit Religion, den Streit um die Wahrheit. Es gibt eine kreative Kraft der Differenz, die Menschen aufschreckt und anregt, neu zu denken.
Der zweite Punkt, der mir imponiert, ist eine Leistung, für die Christinnen und Christen in Deutschland dankbar sein können. Micha Brumlik hat jüdische Theologie und Praxis für uns zugänglich gemacht. Er war ein Brückenbauer zu den jüdischen Gemeinden und für die jüdischen Gemeinden, ohne je selbst in ihnen besonders aktiv zu sein, stets eher Ideengeber als Institutionenmensch. Der Philosoph Brumlik war und ist einer der wichtigsten Meinungsführer jüdischer Intellektueller im Nachkriegsdeutschland sozusagen zwischen Michael Wolffsohn und Henryk M. Broder.
Wenn Christinnen und Christen in Deutschland gelernt haben, mit großem Respekt die jüdische Glaubenstradition zu sehen und das eigene Versagen gegenüber dem Judentum zu begreifen, ja die Scham zu ertragen, dass wir Jüdinnen und Juden schutzlos dem Terror und Morden der Nationalsozialisten auslieferten, dann haben wir das auch Micha Brumlik zu verdanken. Es hat im Nachkriegsdeutschland noch lange gedauert, bis die Erkenntnis der eigenen Schuld zu einem unbefangenen Verhältnis von Christen und Juden führte – und der Prozess dauert noch immer an. Luthers verheerende Hetzschriften gegen die Juden sind endlich aufgearbeitet, die Evangelische Kirche in Deutschland hat sich von ihnen offiziell distanziert.
Ja, Luther war Antijudaist, wohl gar Antisemit. Genau das aber sind die Lutheraner mit Blick auf 2017 nun endlich in der Lage zu thematisieren. Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland hat sich 2015 klar von Luthers „Judenschriften“ distanziert. Das Jubiläumsjahr wird eben nicht als Heldengedenkfest geplant, sondern als eines, das sich wertschätzend, aber auch kritisch mit dem Reformator Luther und der Reformation als Bewegung insgesamt auseinandersetzt. Und eines, das fragt, wo Reform und Reformation heute angesagt sind. Die gemeinsame Rückbesinnung auf die Bibel dürfte dafür wie vor 500 Jahren eine gute Grundlage sein.
Margot Käßmann, Botschafterin des Rates der EKD für das Reformationsjubiläum 2017