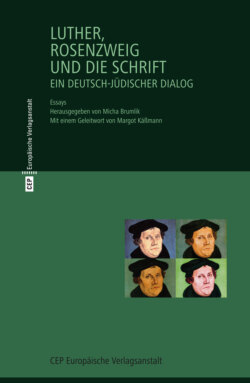Читать книгу Luther, Rosenzweig und die Schrift - Franz Rosenzweig - Страница 13
VI
ОглавлениеLuther selbst sah die wissenschaftliche Bedeutung seines Werks darin, daß er auf den Grundtext zurückging. Auch die Gegner empfanden, wenn auch mit dem schlechten Gewissen des Widerstands gegen eine Forderung der Zeit, das als das Revolutionäre. Und doch war der Revolutionär noch innerlich gebunden an das, was er stürzte. Die Vulgata hatte ja, wie schon aus den angeführten Äußerungen „Meister Klüglings“ hervorging, für den Bildungsmenschen des sechzehnten Jahrhunderts eine ganz ähnliche Bedeutung wie heute die Lutherbibel: wirklich oder vorgeblich vertrauter Besitz, und in beiden Fällen, heut zwar vornehmlich im zweiten, Ruhekissen des Gewissens und Türpolsterung des kultivierten Arbeitszimmers gegen störende Schälle von draußen. Aber auch Luther selbst steckte ihr Wortlaut in Fleisch und Blut. Er, dessen deutscher Psalter vielleicht den Gipfel seiner übersetzerischen Leistung darstellt, hat doch selbst in späteren Jahren noch, wenn er, ein „großer Psalmensager“, in äußeren oder inneren Anfechtungen sich zurückzog, um im Gebet einer Reihe Psalmen seine Kraft zu erneuen, den ihm aus langen Mönchsjahren vertrauten lateinischen Text gesagt! Das allein, wüßten wir es nicht sonst noch21 und verriete es der Text seiner Übersetzung nicht fortwährend, würde schon dahin führen, daß der innere und häufig auch der äußere Ausgangspunkt seines Übersetzens trotz allem die Vulgata war und der Grundtext nur das, freilich aufs stärkste herangezogene Korrektiv. Anders ausgedrückt: er hat, indem er den Sinn des hebräischen Textes ergründete, doch bei diesem Ergründen nicht hebräisch gedacht (und auch nicht wie nachher beim Umgießen des ergründeten Sinns in deutsche Rede: deutsch), sondern lateinisch.
Nun ist ja das Werk des Hieronymus heut auch von protestantischer Seite als die Meisterleistung, die es ist und als die es Luther selbst beurteilt hat, anerkannt. Es war also kein schlechter Führer, dem er sich für die ersten Schritte anvertraute. Vor allem den Sinn eines Satzganzen – und auf ihn vornehmlich mußte es Luther, bei dem zu Anfang geschilderten Verhältnis der beiden Grundrichtungen alles Übersetzens in seiner Übersetzung, ja ankommen – arbeitet die Vulgata als, ob auch späte, Erbin logizistisch-rhetorischer Sprachtradition oft überraschend plastisch heraus. Aber grade das klassische, weil von Luther selbst in seiner typischen Bedeutung erläuterte, Beispiel des „du hast das Gefängnis gefangen“, wo Luther übrigens grade durch den Vorgang der Vulgata sich zu einer allzu dogmatischen Auffassung des Texts verleiten ließ, zeigt, welche tiefen Blicke, und sei es selbst einmal allzutiefe, der enge Anschluß an die hebräische Wendung eröffnen kann. Und wenn nicht nur da, wo ein umschriebenes Dogma hinweist, sondern grundsätzlich überall im Menschenwort die Möglichkeit verborgen geglaubt wird, daß sich eines Tages, zu seiner, zu meiner Zeit das Gotteswort durch es offenbart, dann wird es zur Notwendigkeit für den Übersetzer, soweit irgend seine Sprache es ermöglicht, den eigentümlichen Wendungen jener offenbarungsträchtigen Menschenrede, seis nachbildend, seis andeutend, zu folgen.
So haben, um bei dem Beispiel zu bleiben, die den semitischen Sprachen, aber nicht ihnen allein, sondern allen noch anschauungsstarken Sprachen eigenen Potenzierungen eines Zeitworts, auch wenn sie nicht wie hier durch ein Hauptwort, sondern wie meist durch einen Infinitiv geschehen, im Hebräischen jedesmal einen ganz präzisen Sinn, und sei es nur den einer mächtigen Hervorhebung des Worts. Wenn etwa – auch hier alle Beispiele wieder aus dem zweiten Buch – die sieben Jethrotöchter (2, 19) dem Vater lebhaft die Antwort hervorsprudeln: er schöpfte auch, schöpfte für uns, oder wenn Mose (5, 23), Gott nach dem ersten Mißerfolg wieder aufsuchend, ihm vorwurfsvoll entgegenhält: doch errettet, – errettet hast du dein Volk nicht, so kommt eben jene lebhafte Heraushebung des antworttragenden Tatworts und die Ausdruckskraft jenes Vorwurfs auch im Deutschen nur heraus, wenn man auch hier verdoppelt. Nun gar erst, wenn wie in der Sprache des Rechts die Verdoppelung einen ganz präzisen juristischen Sinn – gewöhnlich den der Rechtsnormalität: vollgültige Vergeltung, sühngerechte Sühne, gezählte Bezahlung – hat.
Die Grenzen des Sprachmöglichen dürfen natürlich nicht überschritten werden. Ja mehr noch: auch schon die Wiedergabe eines hebräisch gewöhnlichen Ausdrucks durch einen im Deutschen ungewöhnlichen ist unstatthaft; eine flache Wendung darf nicht vertieft, eine glatte nicht aufgerauht, eine unschöne nicht verschönt werden. Aber genau sowenig umgekehrt. Etwa der ungeheure Schluß des zweiten Kapitels ist mit seinem viermal wiederholten Subjekt Gott gewiß, wie Luther empfand, kein normales Deutsch. Aber genau sowenig normales Hebräisch! Nur engster Anschluß an den Urtext kann da die Überhöhung eines „Anthropomorphismus“ durch den andern – in Wahrheit sind natürlich Gottes sogenannte Anthropomorphismen die Theomorphismen des Menschen – bis zum letzten unüberhöhbaren „Gott erkannte“ auch im Deutschen zum Reden bringen.
Was im Deutschen sprachmöglich ist, darüber entscheidet freilich hier bei diesem Buch das Sprachgefühl keines Einzelnen, sei er auch Angehöriger der berufsmäßig unfehlbaren Berufe; auch der Übersetzer selbst darf sich nicht an seine eigene Sprache binden wollen; er steht hier nicht als Einzelner vor einem Einzelnen oder vor dem Werk einer einzelnen Zeit, sondern literarisch gesehen vor der Anthologie mindestens eines Jahrtausends; schon der Wortschatz der Bibel ist unvergleichlich größer als der andrer gleich umfangreicher Bücher. Und in der Frage der Sprachmöglichkeit irren bisweilen selbst die Größten; Luther gibt in der Vorrede zum Alten Testament von 1523 als Beispiele für unzulässige Sprachneuerungen die Worte: beherzigen, behändigen, ersprießlich! So gefährlich ist das Schulmeistern, – selbst für Genies. Doch wenn Luther eine zeitlang schwankte, ob er dem deutschen Sprachgefühl die Bildhaftigkeit der „starken Hand“ (3, 19) zumuten könne, und sie deshalb im achten bis zwölften Druck durch „starke Wunder“ ersetzte, so hat er mit Recht im dreizehnten die echte „starke Hand“ wiederhergestellt: nur sie leitet zu dem folgenden „So recke ich denn meine Hand“ hin, wie sie andrerseits auch wieder durch diese Fortsetzung selber ganz deutlich wird. Daß das wissenschaftliche Bibelwerk ohne Schwanken durch alle Ausgaben, von 1894 bis 1922, „Zwang“ sagen wird, wird der Leser schon kaum mehr anders erwarten.
Jenseits von Luthers Erkenntnis lag das, doch schon von Hieronymus gelegentlich ergriffene, wichtigste Mittel, das lebendige Gewächs der hebräischen Rede in eine abendländische Sprache umzupflanzen. Ich habe an andrer Stelle22 von der Bedeutung der „Atemkolen“ ausführlich gehandelt. Hier darum nur dies: sie machen so wenig durch ihre Absätze die Prosa zur Poesie – ein häufiges, aber darum nicht minder törichtes Mißverständnis – wie etwa durch ihre Überschneidungen des poetischen Metrums die Poesie zur Prosa. Sondern beiden, den poetischen wie den prosaischen Teilen der Bibel ganz gleichmäßig, geben sie den in der Schriftlichkeit der Schrift erstickten freien, mündlichen Atemzug des Worts zurück. Die weltweite Entfernung, wie sie etwa im ersten Buch zwischen der unartikuliert-artikellos stammelnden Schilderung der Urschöpfung im zweiten Vers des Schöpfungskapitels und dem flüssigen Erzählen der Josephsgeschichte besteht oder im zweiten Buch zwischen der Groteskheit der Froschplage, dem Jauchzen des Meerlieds, der Wort gegen Wort auf der Wage der Leidenschaft auswägenden großen Anrede Moses an Gott, dem erhabenen Schildern der Wohnung und dem genauen Verumständen und Bedingen der Rechtssprüche: dieser ganze Reichtum der Stimmen und Klangfarben wird, aus dem eintönigen Grau der gewohnten Klavierauszugsnotierung befreit, erst durch diese Partiturschreibung wieder lautbar, lesbar, – laut lesbar.