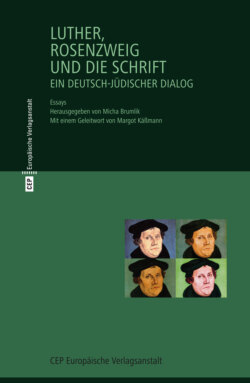Читать книгу Luther, Rosenzweig und die Schrift - Franz Rosenzweig - Страница 12
V
ОглавлениеAlles Neue hat seine Vorgeschichte, zum mindesten eine negative, die „Erbschaft“, von der Goethe einmal zu Eckermann sprach. Seit der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts läuft eine ganze Wissenschaft nach dem Kampfziel der Vermenschlichung der Schrift. Gewiß war dies wissenschaftliche Ringen befangen in einer merkwürdigen Verwechslung der beiden Fragen: Was sagt das? und: Was hat der Schreiber damit sagen wollen? – einer Verwechslung, deren Recht doch dieselben Gelehrten etwa als Rezensenten mit gutem Grund energisch zurückgewiesen hätten. Trotzdem hat diese Bewegung wenigstens ihr kritisches Ziel erreicht: der als goldener Reif oder als goldene Scheibe um das Buch gelegte Heiligenschein umgibt es heute nicht mehr. Daraus zu schließen, daß es darum nicht heilig sei, wäre so naiv, als wenn man den alten Malern zutrauen wollte, sie hätten sich vorgestellt, der heilige Franz wäre wirklich mit so einem Metallring um den Kopf herumgelaufen. Was die Legende aus dem Mund von Augenzeugen über Strahlerscheinungen berichtet, haben sich die Künstler in die Formen, die allgemeinen und die zeitbesonderen, ihrer Kunst übersetzt; wenn heut einer den Nimbus anders malt, wenn er ihn gar nicht malt, so braucht er um nichts weniger an die Heiligkeit des Heiligen zu glauben; einen Glauben an die Ausdrucksform einer vergangenen Zeit binden zu wollen, ist eine billige Ausflucht von Leuten, denen in ihrer Haut unheimlich wird bei dem Gedanken, jemand „in unsrer Zeit“ könne glauben. Die kritische Wissenschaft hat sich jenes Fehlschlusses nicht schuldig gemacht. Sie hat mehr oder weniger bewußt von Anfang an auch einen neuen Begriff der Heiligkeit der Schrift zu bestimmen gesucht. Daß sie bei diesem Versuch regelmäßig wieder in die Nähe des starren, abteilenden Offenbarungsbegriffs des alten Dogmas geriet, liegt vielleicht nicht so sehr, wie dem Juden naheliegt zu vermuten, an konfessioneller Befangenheit, als vielmehr an jener geschilderten Verwechslung dessen, was in das Buch hineingeschrieben wurde, mit dem, was aus dem Buch herausspricht. Denn geschichtliche Fragestellung, weil sie notwendig zielstrebig ist, zeichnet leicht, auf ein Gegenwärtiges angewandt, die Linien ihrer Zielstrebigkeit auch in dieses hinein, wo sie dann natürlich zu Trennungs- und Umgrenzungslinien erstarren; Goethes Faust, wie er ihn entworfen und niedergeschrieben hat, und wie ihn also der Literaturhistoriker im Kolleg doziert, ist ganz und gar nicht der, den er geschrieben hat; der ist viel eher der, den ein Schuljunge mit heißen Backen aus dem Reclamheftchen liest.
Der Kampf der Wissenschaft um die neue menschliche Heiligung der Schrift spiegelt sich nun auch in den Übersetzungsversuchen, die ihr wie aller Philologenarbeit zur Seite gehen, und von denen ja einer, der von Kautzsch und zehn andern Gelehrten unternommene, mit der „zur Erbauung des Bibellesers“17 veranstalteten kommentarlosen Ausgabe in vielen Zehntausenden von Exemplaren verbreitet ist und mit Recht in dem Ruf steht, das Ergebnis der anderthalb Jahrhunderte alttestamentlicher Wissenschaft zu bieten. Mit Recht – es ist wirklich eine ganze Wissenschaft, die in ihm zu Worte gekommen ist; wenn im Folgenden gezeigt wird, daß diese Wissenschaft, um ihr eigenes Ziel zu erreichen, nicht wissenschaftlich genug ist, so geht das gar nicht auf den einzelnen Gelehrten, von dem etwa das grade angezogene Übersetzungsbeispiel stammt, sondern wirklich auf die Wissenschaft selber, von der der einzelne Forscher nur ein Exponent ist, auf den Anspruch also an Exaktheit, und das heißt doch wohl: an Wissenschaftlichkeit, den die Wissenschaft an sich selber stellt.
Jenes Bibelwerk gibt als seinen eigenen Zweck an: „jeder Art von Lesern den Inhalt des Alten Testaments, so wie es mit den Mitteln der heutigen Schriftforschung geschehen kann, in klarem heutigem Deutsch zu vermitteln“18. In dieser Formulierung ist schon ausgesprochen, was der Übersetzerarbeit dieser Wissenschaft – und übrigens nicht dieser allein, sondern dem Übersetzergewissen in allen Zweigen der Philologie – zur wirklichen Gewissenhaftigkeit fehlt. Denn, es ist fast beschämend, solche Selbstverständlichkeiten auszusprechen, aber doch nötig, – denn man kann den Inhalt nicht vermitteln, wenn man nicht zugleich auch die Form vermittelt. Für das, was gesagt wird, ist es nicht nebensächlich, wie es gesagt wird. Der Ton macht die Musik. Das Kommando: Stillgestanden! ist zwar „inhaltlich“ identisch mit dem: Bitte stillgestanden! eines zarten Kunsthistorikers und Etappenleutnants und auch mit der „inhaltlich“ einwandfreien Satzumformung: ich befehle euch, stillzustehn; dasselbe ist es nicht. Und doch: so, genau so, wird „wissenschaftlich“ übersetzt. Das klingt übertrieben, aber was ist es andres, wenn etwa in der Erzählung des Ereignisses am Schilfmeer – ich nehme die Beispiele alle aus dem zweiten Buch Moses, das in jenem Bibelwerk von zwei Gelehrten umschichtig übersetzt und jüngst von einem dritten neubearbeitet19 ist und also schon dadurch ein guter Repräsentant des allen Gemeinsamen – in wenigen aufeinanderfolgenden Sätzen (14, 19 ff.): „da änderte … seine Stellung“, „brachte … zum Weichen“, „nahmen die Verfolgung auf“, „brachte … in Verwirrung“ für schlichtes hinwegzog, zurücktrieb, setzten nach, verschreckte des Originals steht. Vielleicht gibt es in einem stilistisch so verschiedenartigen Buch wie der Bibel auch Stellen, für die dieses Deutsch eines kleinstädtischen Amtsblättchens das richtige zur Übersetzung ist. Über die ganze Erzählung ohne Unterschied ausgegossen, verfälscht es den Ton und damit auch die „Musik“. Freilich läßt dann gleich die wissenschaftliche Übersetzung die Wasser „zurückfluten“; aber gerade für diesen „starken sinnlichen Realismus“ muß das Original die Verantwortung ablehnen, das hier ganz allgemein „kehren“ sagt. Und ebenso ist es eine Fälschung in der umgekehrten Richtung, wenn das Bibelwerk da, wo das Original sich einmal einer umständlich verschnörkelten Wendung bedient, wie in der seltsam unerzählten Schilderung der Niederfahrt Gottes zum Offenbarungsberg: Da ward der Schall der Posaune fortgehend mehr erstarkend (19, 19), ein simples „wurde immer mächtiger“ hat. Wenn Luther in dieser Art übersetzt, bleibt er nicht hinter seiner eigenen Forderung zurück; wenn die moderne Wissenschaft so den Inhalt des Textes wiedergegeben zu haben meint, entblößt sie nur ihre wissenschaftliche Anspruchslosigkeit.
Das charakterisierte Obenhin-Übersetzen weicht bezeichnenderweise einer um eine Spur größeren Genauigkeit in einem poetischen Stück wie dem Siegeslied von Kapitel 15; hier weiß sogar die Wissenschaft schon, daß die Ausdrucksweise nicht ganz unwichtig für das Ausgedrückte ist; während balladenhafte Klänge (13, 21f. und 32, 17f.) und dithyrambische Aufschwünge (2, 23ff. und 12, 42) der Erzählung unfehlbar in die Sauce des einen und allgemeinen Polizeisekretärsdeutsch eingeschluckt werden.
Jenes Obenhin wird aber geradezu Verwüstung bei dem Zielpunkt des Buchs, dem Höhepunkt vielleicht des ganzen Fünfbuchs, beim „Zelt“. Die gewaltige Gottesrede der Kapitel 25 bis 31, das Wort zu der Vision, die dem Führer bescheidet, zu welchem Ende, zu welchem „Werkdienst“ sein Volk aus dem „Frondienst“ geführt wurde, wird in dem erwähnten Bibelwerk aus ihrer strengen, sachlichen Erhabenheit in ein unruhig geschwätziges, die Klarheit der Linie verkritzelndes Idiom transponiert, ein Abstand etwa, wie wenn der Kompaniefeldwebel in der Instruktionsstunde die klassischen Sätze der Felddienstordnung zu „erläutern“ sucht. So, um ein greifbares Beispiel anzuführen, meint jenes Bibelwerk, das ohne Unterlaß durch die ganzen Kapitel hindurchziehende Wort „machen“, das Thema dieser großen Fuge, in anmutiger Abwechslung, die wahrscheinlich den Leser vor Langeweile schützen soll, bald durch „errichten“, bald durch „anfertigen“, bald durch „anbringen“, bald durch „arbeiten“ wiedergeben zu müssen; ohne jede Ahnung, daß dadurch nicht „nur“ die Form, sondern auch der ganze Sinn der Vision verlorengeht, deren Gegenstand ja das in sechstägigem Wolkendunkel (24, 16) auf dem Sinai geschaffene Urbild der „Wohnung“ ist20, zu dessen Schau Mose am siebenten Tag in die Wolke hineinberufen wird und das dann das Volk, ein menschgeschaffenes Gleichnis der göttlichen Schöpfung, vollendet (39, 32 und 40, 33 = I, 2, 1 f. Ferner 39, 43 = I, 1, 31 und 2, 3). Wie also die sechs Tage und der siebente hier wiederkehren, und das Wort der Vollendung, und das bestätigende Ja, und der abschließende Segen, so auch das einfachste und umfassendste, göttliches Tun menschlichem, menschliches göttlichem vergleichnissende Wort für die Schöpfung selber: das Machen.
Immer wieder muß gesagt werden, daß all das durchaus nicht zu Lasten des einzelnen Gelehrten geht, der an dem Werk nach seinen besten Kräften mitgearbeitet hat. Die Wissenschaft selber ist im Übersetzen wissenschaftlich zu anspruchslos. So hat sie das Vertrauen zur lutherschen Übersetzung zwar in weiten Kreisen erschüttert; aber was sie an ihre Stelle gesetzt hat, ist nicht die Übersetzung des neuen Glaubensausdrucks, dem doch, bewußt und unbewußt, all ihre Arbeit dient. Wohl hat sie Einzelheiten berichtigt; aber andrerseits lassen sich viele der lutherschen „Fehler“ grade vor dem Richterstuhl der modernen Wissenschaft, der ja den alten Übersetzungen, denen Luther dabei vielfach folgte, eine Stimme gegen den überlieferten hebräischen Text zuerkennt, sehr gut verteidigen. Von solchen Einzelberichtigungen also abgesehen gibt sie auch im wissenschaftlichen Sinn nichts Besseres und allermeist Schlechteres als Luther.