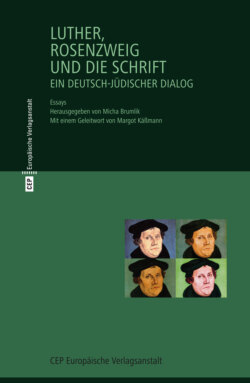Читать книгу Luther, Rosenzweig und die Schrift - Franz Rosenzweig - Страница 9
II
ОглавлениеVon Luthers Äußerungen über seine Übersetzung sind grade die bekannt, die seinen Willen aussprechen, Deutsch, gemeinverständliches Deutsch, zu schreiben: „deutliche und jedermann verständliche Rede zu geben, mit unverfälschtem Sinn und Verstand“2. Es sind auch wirklich weitaus die überwiegenden. Und der große Schritt, den er über die deutsche vorluthersche Bibelübersetzung hinaustat, war hier schon den Zeitgenossen am eindrücklichsten. Dennoch war er sich auch der andern Seite seines Werks, der Bewegung des deutschen Lesers hin zu dem fremden Original, dem fremden Sprachgeist, voll bewußt. In der Sondervorrede des „Deutschen Psalters“, dieser instruktivsten all seiner Äußerungen zum Übersetzungsproblem, in der er sich und dem Leser an einer langen Reihe von Beispielen Rechenschaft gibt über seine Methode und über die tiefgreifendste und durchgängigste Umarbeitung, die er je an einem Teil seines Werks vollzogen hat, kommt er ganz, ausdrücklich auch hierauf zu sprechen und stellt als die von ihm entdeckte und befolgte „Regel“ auf, „zuweilen die Worte steif zu behalten, zuweilen allein den Sinn zu geben“.
Die Gründe nun oder vielmehr der Grund, aus dem Luther seinem deutschen Leser zuweilen zumutet, „der hebräischen Sprache Raum zu lassen“ und „solche Worte zu gewohnen“, wird ganz deutlich aus einer Stelle jener Psaltervorrede, die ich deshalb trotz ihrer Länge ungekürzt hersetze:
„Wiederum, haben wir zuweilen auch stracks den Worten nach gedolmetscht, ob wirs wohl hätten anders und deutlicher können geben, darum, daß an denselben Worten etwas gelegen ist. Als hier im 18. Vers3: Du bist in die Höhe gefahren und hast das Gefängnis gefangen. Hier wäre es wohl gut deutsch gewesen: Du hast die Gefangenen erlöset. Aber es ist zu schwach, und gibt nicht den feinen reichen Sinn, welcher in dem Hebräischen ist, da es sagt: Du hast das Gefängnis gefangen, welches nicht allein zu verstehen gibt, daß Christus die Gefangenen erledigt hat, sondern auch das Gefängnis also weggeführt und gefangen, daß es uns nimmermehr wiederum fangen kann noch soll, und ist so viel als eine ewige Erlösung.
Auf solche Weise hat S. Paulus Lust zu reden, wenn er spricht: ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben. Item, Christus hat die Sünde durch Sünde verdammt. Item, der Tod ist durch Christum getötet. Das sind die Gefängnisse, die Christus gefangen und weggetan hat, daß uns der Tod nicht mehr halten, die Sünde nicht mehr schuldigen, das Gesetz nicht mehr das Gewissen strafen kann, wie S. Paulus solche reiche, herrliche, tröstliche Lehre allenthalben treibt.
Darum müssen wir zu Ehren solcher Lehre, und zu Trost unsres Gewissens, solche Worte behalten, gewohnen, und also der hebräischen Sprache Raum lassen, wo sie es besser macht, denn unser Deutsch tun kann.“
Hier wird unvergleichlich klar, wie sich das Herrschgebiet der beiden Prinzipien, das der Bewegung des Texts zum Leser und das der Bewegung des Lesers zum Text, gegeneinander abgrenzt. Jenes ist an sich das vorherrschende, für Luther wie für jeden Übersetzer; denn schließlich geschieht alles Übersetzen in die Sprache des Lesers und nicht in die Sprache des Originals; daß Luther so viel von dieser, doch mehr selbstverständlichen, Seite seines Tuns spricht, hat seinen guten Grund darin, daß er sich als den ersten Könner dieser Kunst fühlen durfte; wenn die Übersetzung seiner Vorgänger von Latinismen wimmelte, so war das keine Wirkung jenes andern Prinzips, sondern bloße Stümperei. Das andre Prinzip ist für ihn, wie für jeden Übersetzer, die Ausnahme. Daß wir uns heut mehr dafür interessieren, liegt daran, daß, wenn erst einmal die Regel gesichert ist, die Ausnahme sowohl umstrittener als auch fragwürdiger und darum lehrreicher und interessanter ist als die Regel. Wo aber beginnt nun nach Luthers Ansicht die Notwendigkeit, im Deutschen „der hebräischen Sprache Raum zu lassen“? Wo das Gesagte ganz wichtig, ganz zu uns, zu „unserm Gewissen“ gesprochen ist, wo also die Schrift für ihn, den lebendigen Christen von heute, heute lebendig ansprechendes Gotteswort, lebendige Lehre, lebendiger Trost, ist. Er hatte in der „Analogie des Glaubens“ die nie versagende Wünschelrute, die ihm an all den Stellen, wo das Alte Testament „Christus trieb“, aufzuckte. Wo es so für ihn, den Christen, lebendiges Gotteswort war, da, und nur da, da aber unbedingt, mußte es wörtlich genommen werden und also auch in ,,steifer“ Wörtlichkeit übersetzt. Überall sonst, und das umfaßte für ihn beim Alten Testament den größten Teil des Textes, wo es nach der herrlichen Stelle der Vorrede auf das Alte Testament nur ein Bild und Exempel des Regiments und des Lebens ist, wie es ,,zugehet wenn es im Schwang gehet“, läßt der Übersetzer „die hebräischen Worte fahren und spricht frei den Sinn heraus aufs beste Deutsch, so er kann“4.
Luthers Glaube bestimmt also bis ins einzelne, wie die große Mittlerarbeit geschieht, wo also das Wort und wo hingegen der Hörer „in Ruhe gelassen wird“. Luthers Glaube und, da es einen isolierten Glauben nicht geben kann, sein Begriff eines abgrenzbaren, weil abgegrenzten, Glaubensinhalts. Einer Zeit also, der dieser Offenbarungsbegriff verlorengegangen ist und die, klarer oder verworrener, sich Offenbarung des ihr Glaubenswürdigen grade in der ganzen Breite dessen hofft, was Luther als bloßes Bild und Exempel des Lebens aus dem fest und sichtbar und für immer eingegrenzten Glaubenskern des Buchs herausverwiesen hatte, einer solchen Zeit müßte es also erlaubt sein, die Glaubensfrage des Übersetzens neu an das Buch zu stellen, so sicher wie es ihr geboten ist. Und diese Frage wäre in keinem der europäischen Sprachvölker eine Frage. In Deutschland ist sies, und eine von schwerstem Ernst. Denn zwar für Luther selbst war sein Werk stets im Fluß geblieben; noch am Ende seines Lebens hat er geklagt, daß es ihm nicht mehr gegönnt sein würde, die Übersetzung ganz neu umzuarbeiten, und hat von der Zukunft erhofft, daß sie „es mehr und besser machen“5 würde; aber für sein Volk hat sich das Werk von dem Glaubensleben seines Urhebers gelöst und ist zum Grundbuch nicht nur einer Kirche, was weniger bedeuten würde, sondern der nationalen Sprache selber geworden. So prallt hier der Mut jenes Erlaubt und der Ernst jenes Geboten an das verschlossene Tor eines Unmöglich.