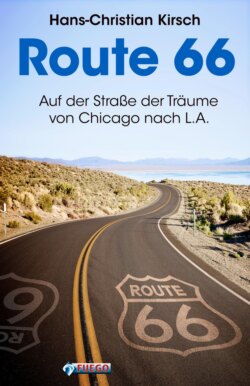Читать книгу Route 66 - Frederik Hetmann - Страница 12
6. Chicagos Slums in den 60er Jahren
ОглавлениеHier kann ich mit eigenen Erfahrungen aus dem Jahr 1968 aufwarten. In meinem Tagebuch habe ich damals notiert: »... Dann also schon heute hinaus ins Southend, wo ich mich in dem Jugendzentrum eines Ghettoviertels ein paar Tage umsehen soll. Die Entfernungen in dieser Stadt sind gewaltig. Im Bus werden es immer weniger Weiße, immer mehr Schwarze steigen zu. Schließlich bin ich der einzige Hellhäutige hier. Ein seltsames Gefühl, einmal die Minderheit zu sein. Nicht, dass mir Irgendjemand zu nahe treten würde, nicht, dass mich Jemand anstarrt. Es ist viel undramatischer. Man ist ein Einzelner, und die anderen sind viele. Ich begreife auf dieser Busfahrt zum ersten Mal ganz deutlich, was es heißt, zu einer Minderheit zu gehören, die sich schon durch ihre Hautfarbe verrät. Und in dieser Situation sind Schwarze in diesem Land ein ganzes Leben lang.
Das Viertel, in dem das Jugendzentrum liegt, ist zwanzig Minuten vom Stadtzentrum entfernt und längst noch nicht am Stadtrand. Die Häuser sind aus Holz und zerfallen, die Fensterscheiben meist eingeschlagen und durch Pappe, Blech oder Fliegendraht ersetzt. Auf der Straße liegt Unrat. Am Straßenrand noch die ausgebrannten Autowracks von den letzten Unruhen. Es wimmelt von Kindern. Die Menschen sitzen apathisch vor ihren Häusern. Es ist heiß, jetzt im August, über 30 Grad im Schatten. Die Luft ist feucht und stinkt. Der Laden an der Ecke ist ein Schnapsgeschäft, davor torkeln ein paar Betrunkene herum.
Der Leiter des Jugendzentrums sagt: ›Ich kämpfe hier auf verlorenem Posten. Hier ist nichts zu retten. Die Verhältnisse sind stärker als das bisschen Flickwerk, das wir leisten können. Ich weiß nicht, wie lange ich es hier noch aushalte.‹ Dieser junge Schwarze hat mit viel Idealismus seine Tätigkeit als Sozialarbeiter begonnen. Nun ist er am Ende seiner Kräfte. ›Das Beste wäre‹, erklärt er resignierend, ›das ganze Viertel würde eines Tages abbrennen.‹
American Memories
»Große Teile der South Side und der Near West-Side umfassen die schwarzen Ghettos, die ausgedehntesten im ganzen Land. Es gibt kleinere Ghetto-Bezirke in anderen Teilen der Stadt. Das ist natürlich inoffiziell. Der (ehemalige) Bürgermeister Richard J. Daley verkündete am 4. Juli 1963: ›Es gibt keine Ghettos in Chicago!‹«
Studs Terkel,
Ein ABC-Führer für Leute, die Chicago nicht kennen
Etwas tun? Feuer legen vielleicht. Alle Häuser sind überbelegt: Zwischen zwölf und achtzehn Menschen in zwei, manchmal in drei Zimmern zusammengepfercht – das ist die Regel.
Die Zahl der unehelichen Geburten ist hier fast so hoch, wie die der ehelichen. Die Männer kommen und gehen, die Frauen und Kinder bleiben, und es werden immer mehr hungrige Mäuler. Die Arbeitslosenziffer in diesem Bezirk (damals, im Sommer 1968), in dem schätzungsweise zehn- bis zwölftausend Menschen mehr vegetieren als leben, liegt bei 85 Prozent.
Aber in nahezu jeder Wohnung gibt es einen Fernsehapparat, oft ist er fast das einzige Inventar. Meist ist er noch nicht bezahlt, und auf den Raten liegen Wucherzinsen. Auf dem Bildschirm sieht der Slumbewohner fast 24 Stunden am Tag das üppige Angebot der Konsumgesellschaft vorbeiflimmern; Autos, Kühlschränke, Motorboote, ein Grundstück an einem Waldsee – eine narrende, verhöhnende Fata Morgana.
Weil die Schwarzen auf schlechte Wohngebiete verwiesen sind, ist ihre familiäre Situation nicht selten chaotisch. Weil die Familienverhältnisse zerrüttet, die Wohnung miserabel, das Einkommen der Eltern unzureichend ist und somit nicht einmal die nötigsten Kleidungsstücke angeschafft werden können, gehen viele Kinder nur unregelmäßig zur Schule. Manchmal auch gar nicht.
Es ist halb sechs Uhr abends. Der Leiter des Jugendzentrums hat seiner Gruppe versprochen, mit ihr an den Michigan-See zum Baden zu fahren. Er kann mich nicht mit dem Auto in die City zurückbringen. Ich laufe zur Bushaltestelle, und es wird ein Spießrutenlaufen. Ich bin normal gekleidet, nicht auffällig, aber für diese Leute hier ist allein meine ganz normale Kleidung und meine weiße Haut eine unerhörte, mir auch völlig verständliche Provokation. Sie werfen Steine nach mir, sie spucken mich an. Sie brüllen mir Schimpfnamen ins Gesicht. Es würde mich nicht wundern, wenn sie versuchten, mich totzuschlagen. Es ist eine Wegstrecke von fünf oder sechs Minuten vom Jugendzentrum zur Bushaltestelle, aber ich frage mich allen Ernstes, ob ich mein Ziel lebendig erreichen werde.
Ich denke immer wieder: Dieser Zorn ... Sie haben ja recht. Es muss so sein. Es ist zwangsläufig, wenn du hier lebtest, nach ein, zwei Monaten wärst du auch so. ›Du Narr‹, sagt Alice abends zu mir, als ich ihr meine Erlebnisse erzähle, ›du Narr, dort wäre dir niemand zu Hilfe gekommen. Dorthin wagt sich nicht einmal die Polizei.‹«
Als ich 1996 dort draußen vorbeifuhr, blieb nur Zeit für einen flüchtigen Blick auf dieses Viertel. Ich kam mir ziemlich schäbig vor, als ich da hinter Glas vorbeisegelte. Schäbig, weil ich zu feige gewesen war, hinauszufahren und nachzusehen, wie es heute steht.