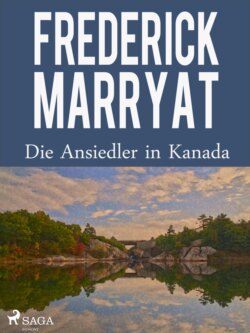Читать книгу Die Ansiedler in Kanada - Фредерик Марриет - Страница 8
VI.
ОглавлениеAm folgenden Tage kam der Vermessungsbeamte und brachte den Pelztierjäger Martin Super mit.
„Mr. Campbell“, sagte der Feldmesser, „dies ist mein Freund Martin Super. Ich habe mit ihm gesprochen; er ist gewillt, zunächst für ein Jahr in Ihren Dienst zu treten, und wenn es ihm gefällt, auch länger zu bleiben. — Wenn er Ihnen so gut dient, wie er mir gedient hat, als ich das Land bereiste, so zweifle ich nicht, daß Sie an ihm eine schätzenswerte Stütze haben werden.“
Martin Super war groß und gerade gewachsen und schien Tatkraft und Stärke zu besitzen. Er hatte einen kleineren Kopf als die meisten Männer, wodurch er den Eindruck großer Leichtigkeit und Behendigkeit machte. Sein Gesichtsausdruck hatte etwas recht Angenehmes, und trug die beständig gute Laune zur Schau, die seinem wahren Charakter entsprach. Seine Kleidung bestand in einer Art Jägerwams von Tierhäuten, blauen Tuchgamaschen, einer Waschbärmütze und einem breiten Gürtel um die Hüften, worin sein Messer steckte.
„Jetzt, Martin Super, werde ich Euch die Bedingungen Eures Vertrages mit Mr. Campbell vorlegen, damit Ihr hört, ob alles nach Eurem Wunsche ist.“
Der Feldmesser las den Vertrag und Martin Super gab durch Kopfnicken das Zeichen seines Einverständnisses.
„Mr. Campbell, wenn Sie zufrieden sind, so können Sie jetzt unterzeichnen; Martin soll darauf dasselbe tun.“
Mr. Campbell unterzeichnete seinen Namen und gab dann die Feder an Martin Super, der jetzt zum erstenmal sprach.
„Feldmesser, ich weiß nicht, wie mein Name buchstabiert wird, und wenn ich das auch wüßte, so könnte ich ihn doch nicht schreiben, darum muß ich es auf Indianer-Art tun und mein Totem darunter setzen.“
„Wie ist denn Euer Name bei den Indianern, Martin?“
„Der Painter“, entgegnete Martin und machte dann unter Mr. Campbells Namen eine Figur, ähnlich der eines Panthers, indem er sagte: „Da, dies ist mein Name, so gut ich ihn zeichnen kann.“
„Sehr gut“, versetzte der Feldmesser, „hier ist der Vertrag, Mr. Campbell. — Meine Damen, ich muß Sie jetzt verlassen, denn ich habe noch andere Geschäfte. Ich werde Ihnen Martin Super hierlassen, Mr. Campbell, da Sie wahrscheinlich noch miteinander sprechen möchten.“
Der Landmesser verabschiedete sich, und Martin Super blieb. Mrs. Campbell redete ihn zuerst an.
„Super“, sagte sie, „ich hoffe, wir werden gute Freunde werden, doch jetzt saget mir, was Ihr mit Eurem Totem meint, so nanntet Ihr es ja wohl?“
„Nun, Madam, ein Totem ist ein Indianerzeichen, und ich, müssen Sie wissen, bin selbst ein halber Indianer. — Alle Indianerhäuptlinge haben ihre Totems. Der eine heißt die große Otter, der andere die Schlange und so weiter, und wenn sie unterzeichnen, so machen sie eine Figur, die so wie das Tier aussieht, nach dem sie genannt werden. Und sehen Sie Madam, wir Trapper haben uns auch einen Namen gegeben; mich haben sie den Painter (heißt im Englischen der Maler) genannt.“
„Warum nannten sie Euch den Painter?“
„Weil ich an einem Tage zwei von ihnen tötete.“
„Zwei Painter?“ riefen die Mädchen.
„Ja, Miß; ich tötete beide mit meiner Büchse.“
„Aber warum habt Ihr die Männer getötet“, fragte Emma, „geschah es in einer Schlacht?“
„Die Männer töten, Miß? Ich habe von Männern nichts gesagt; ich sagte, ich tötete zwei Painter“, versetzte Martin lachend.
„Was ist denn ein Painter, Super?“ fragte Mrs. Campbell.
Hier trat Mr. Farquhar ins Zimmer, er sagte ihnen, daß die Painter eine Art nicht gefleckter, sondern braungelber Panther wären.
„Kennt Ihr den Teil des Landes, in den wir ziehen?“ wandte sich Henry an Super.
„Ja ich habe da monatelang gejagt, aber die Biber sind jetzt knapp.“
„Gibt es dort noch andere Tiere?“
„Ja“, versetzte Martin, „noch kleines Wild, wie wir es nennen.“
„Welche Arten sind das?“
„Nun, das sind Bären und Catamounts.“
„Gott sei uns gnädig, wenn Ihr das kleines Wild nennt, was muß dann erst das große sein?“ rief Mrs. Campbell.
„Büffel, Missis, nennen wir großes Wild.“
„Aber die Tiere, von denen Ihr sprecht, taugen nicht zur Nahrung“, sagte Mrs. Campbell, „gibt es kein Wild, das wir essen können?“
„O ja, eine Menge Rotwild und wilde Truthähne, und der Bär ist auch ein gutes Essen, sollte ich meinen.“
„Ah, das lautet besser.“
Nach einstündiger Unterhaltung wurde Martin Super entlassen, er hatte der ganzen Familie sehr gefallen.
Einige Tage darauf wurde Martin Super, der seinen Dienst angetreten hatte, und mit Alfred sehr beschäftigt war, vor Mr. Campbell gefordert, der ihm das Verzeichnis aller in seinem Besitze befindlichen Gegenstände vorlas und ihn fragte, ob noch etwas fehle, das notwendig, oder ratsam mitzunehmen sei.
„Sie sagten etwas von Schußwaffen“,, entgegnete Martin. „Welche Art meinten Sie damit?“
„Wir haben drei Vogelflinten und drei Musketen, außer den Pistolen.“
„Vogelflinten sind zum Vogelschießen, glaube ich — nützen gar nichts. Pistolen sind Knallgewehre — um nichts besser. Sie haben keine Büchsen; ohne Büchsen können Sie nicht in die Wälder gehen. Ich habe meine, aber Sie müssen auch welche haben.“
„Gut, ich glaube Ihr habt recht, Martin. Wie viele müßten wir haben?“
„Nun, das hängt davon ab, wie viele Sie in der Familie sind.“
„Wir sind fünf männliche und drei weibliche Familienglieder.“
„Nun Sir, dann sag ich zehn Büchsen. Das wird genügend sein. Zwei für den Fall, daß mit den andern etwas passiert“, versetzte Martin.
„Aber Martin“, fragte Mrs Campbell, „Ihr denkt doch nicht, daß die Kinder, diese jungen Damen und ich Büchsen abfeuern sollen?“
„Ich kann wohl sagen, Madam, daß ich schon, ehe ich so alt war, wie der kleine Junge dort“, entgegnete Martin, auf John deutend, „ganz gut mein Ziel treffen konnte, und ein Frauenzimmer sollte wenigstens verstehen, das Pulver aufzuschütten und die Büchse zu laden, wenn sie sie nicht selbst abfeuert. Ich will nicht sagen, daß wir nötig haben werden, sie zu gebrauchen, aber es ist immer besser, sie zu haben und andere Leute wissen zu lassen, daß wir damit versehen sind, wenn es darauf ankommt.“
„Freilich, Martin“, sagte Mr. Campbell, „ich pflichte Euch bei, es ist besser, gut vorbereitet zu sein. Wir werden zehn Büchsen kaufen, falls wir sie erschwingen können. Was werden sie kosten?“
„Etwa sechzehn Dollars werden die besten kosten, Sir; aber ich glaube, ich suche sie aus und probiere sie, ehe Sie sie kaufen.“
„Tut das, Super, Alfred kann mit Euch gehen, Ihr könnt das zusammen besorgen.“
„Aber Super“, bemerkte Mrs. Campbell, „Sie haben uns Frauen ganz angst gemacht durch die Idee, daß so viele Schußwaffen nötig sind.“
„Wenn Pontiac noch lebte, Missis, wären sie nötig, es gibt aber noch viele herumlungernde Indianer, die nicht besser sind, und darum sehe ich die Büchsen immer gern fertig geladen. Stellen Sie sich vor, Madam, daß die Männer alle in den Wald gegangen wären, und ein Bär besuchte Sie während ihrer Abwesenheit. Würde es da nicht gut sein, eine geladene Büchse in Bereitschaft zu haben, und würden Sie, oder die jungen Missis nicht lieber auf ihn abdrücken, als daß Sie sich auf seine Art von ihm umarmen ließen?“
„Martin Super, Ihr habt mich überzeugt; ich werde nicht nur lernen, eine Büchse zu laden, sondern auch sie abzufeuern.“
„Und ich werde den Knaben ihren Gebrauch beibringen, Madam.“
„Das sollt Ihr tun, Martin“, entgegnete Mrs. Campbell; „ich bin überzeugt, Ihr habt völlig recht.“
Als Super das Zimmer verlassen hatte, bemerkte Mr. Campbell: „Ich hoffe, meine Liebe, daß du und die Mädchen durch Martins Bemerkungen nicht erschreckt worden seid. Es ist eine Notwendigkeit, gut bewaffnet zu sein, wenn man entfernt von jeder Hilfe wohnen muß, wie es bei uns der Fall sein wird. Aus dem Umstande, daß wir gegen jede Gefahr gewappnet sein müssen, ist jedoch nicht zu folgern, daß dieselbe auch eintreffen wird.“
„Ich für meine Person, lieber Campbell“, versetzte seine Frau, „ich bin vorbereitet, Gefahren zu begegnen, und was in den schwachen Kräften einer Frau steht, werde ich tun. Was Martin sagt, ist nur zu wahr. Mit der Büchse in der Hand gilt eine Frau oder ein Kind das gleiche, wie der stärkste Mann.“
„Und ich, lieber Onkel“ sagte Mary Percival, „werde meine Pflicht zu tun wissen, selbst wenn die Verhältnisse noch so seltsam für ein weibliches Wesen sein sollten.“
„Auch ich, lieber Onkel“, folgte Emma lachend nach, „werde bei weitem lieber eine Büchse abfeuern, als mich von einem Indianer oder Bären umarmen lassen, denn man soll von zwei Übeln immer das kleinste wählen.“
„Gut denn, ich sehe, Martin hat keinen Schaden angerichtet. Es ist immer am besten, auf das Schlimmste gefaßt zu sein und in der Gefahr auf die Hilfe der Vorsehung zu vertrauen.“
Endlich waren alle Einkäufe bewerkstelligt, alles war verpackt und zum Abgang bereit. Eine neue Mitteilung kam vom Gouverneur; er meldete, daß sich die Truppen in drei Tagen einschiffen würden und wies darauf hin, daß der Kommandant vom Fort Frontignac, falls Mr. Campbell noch keine Pferde und Kühe gekauft habe, ihn damit versorgen könne, da er mehr Vieh besitze, als für das Fort erforderlich sei. Mr. Campbell hatte darüber noch nichts abgemacht und freute sich, das Anerbieten des Gouverneurs annehmen zu können. — Diese Nachricht war von einer Einladung begleitet, am Tage vor der Abreise ein Abschiedsdiner im Hause des Gouverneurs anzunehmen. — Man folgte dieser Aufforderung, und Mr. Campbell wurde dem Offizier vorgestellt, der die abgehende Truppenabteilung befehligte. Dieser versicherte ihm, daß er alles tun würde, um der Familie die Reise angenehm zu machen.
Der Gouverneur bat den Offizier, zum Gebrauche für Mr. Campbell zwei große Zelte mitzunehmen, die an das Fort zurückgegeben werden sollten, sobald die Familie ihr Haus gebaut hätte.