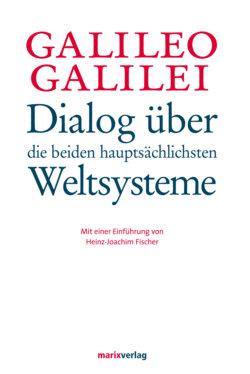Читать книгу Dialog über die beiden hauptsächlichsten Weltsysteme - Galileio Galilei - Страница 19
DER HISTORISCHE FALL UND SEINE SKANDALISIERUNG
ОглавлениеZuerst war es nur ein Gefühl: Da stimmt etwas nicht. Das stellt sich ein, wenn ein Sachverhalt befremdlich wirkt oder eine Person aus dem Gleichgewicht gerät, wenn die Proportionen von Ursache und Wirkung, von Missetat und Empörung, Heldentat und Begeisterung verrutschen. Alle Welt kennt, heute mehr denn je, den Unterschied zwischen der Wirklichkeit und der öffentlichen Meinung darüber, einem Sachverhalt und dem Bericht davon, einer Person und ihrem äußeren Ansehen. Was in der modernen Gesellschaft auf die Schnelle Werbeagenturen, PR-Leute und auch Journalisten für Politiker, Schauspieler oder Unternehmen positiv besorgen, was negativ an Untaten und Übeltätern beschwichtigt wird, bewirken für die Vergangenheit lange Prozesse einer geschichtlichen Meinungsbildung. Viel spielt dabei mit, viele sind daran beteiligt, eine Gestalt der (Zeit-)Geschichte für das öffentliche Interesse darzustellen. So wächst das Image aus dem Historischen heraus. Historiker und Journalisten können sich dann auch bemühen, den Prozess in Rückabwicklung umzukehren, um vom (zeit-)geschichtlichen Schein zum Sein, zur Wahrheit (?) zu gelangen, kurz ein faires – überraschend positives oder negatives – Urteil fällen zu können.
So erging es mir. Die Merkwürdigkeiten, die sich bei langjährigen Studien und aktuellen journalistischen Arbeiten ergaben, konzentrierten sich – wie bereits angedeutet – zur Hauptfrage: Wie und wann wurde aus dem »Fall Galilei« des 17. Jahrhunderts, der – alles zusammengenommen – Kirchengeschichte, Wissenschaft, die Profanhistorie Europas mäßig bewegte, ein »Skandal Galilei«, der die Kirche bis in ihre Grundfesten erschütterte? Da war deutlich: Mit den bisherigen Urteilen konnte ich mich nicht mehr begnügen, nicht als Journalist, der multi-dimensional politisch wahrnimmt, nicht als Historiker, der sich nicht auf archivierte Dokumente beschränken, nicht als Theologe, der stets nach klügeren Argumenten ausschauen darf.
Das hat jedoch wenig mit dem historischen »Fall Galilei« zu tun. Der ist glasklar. Der ungerecht Behandelte ist Galileo Galilei, Opfer eines falschen Prozesses, einer verqueren Justiz. Die Schurken sind die römischen Kirchenführer, die Inquisitoren, Papst und Kardinäle dazu. In den kirchlichen Prozessen von 1616 und 1633 vertrat die Römische Inquisition, gedeckt von den Päpsten, Paul V. und Urban VIII., sowie den maßgeblichen Kardinälen die falsche Behauptung, die Erde stehe still und die Sonne bewege sich, und zwang Galilei zum Widerruf.
Wenn in strittigen Fällen und bei umstrittenen Personen gern Friedrich Schiller (1759–1805) zitiert wird – »von der Parteien Gunst und Hass verwirrt, schwankt sein Charakterbild in der Geschichte« –, so trifft das für Galilei gerade nicht zu. Schiller, nicht nur Dichter, sondern auch guter Historiker, münzt das Wort auf Wallenstein, den kaiserlichen Feldherrn im Dreißigjährigen Krieg (1618–1648) – der von 1583 bis 1634 lebte, also ein Zeitgenosse Galileis war. Mit der Warnung, bei geschichtlichen Wertungen »nicht betrüglich den Schein der Wahrheit zu unterschieben«. Doch was er über Wallenstein bemerkt, gilt gerade nicht für Galilei, weil dessen Charakter ganz gleichgültig ist. Doch umso mehr für die Kirche.