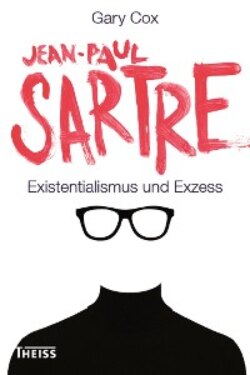Читать книгу Jean-Paul Sartre - Gary Cox - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5 Castor
ОглавлениеEnde der 1920er-Jahre hatte Sartre bereits mehrere Affären mit Frauen gehabt. Die früheste war eine Kindheitsromanze mit seiner Cousine Annie Lannes, der Tochter seines Vaters Schwester, die bis in seine Jugendzeit hineindauerte. Sie verbrachten ihre Sommerferien gemeinsam in Thiviers und tauschten das restliche Jahr über Briefe und Geschenke aus. Sartre suchte sie in Paris auf, als sie dort für eine kurze Zeit studierte. Erzählungen zufolge war sie Sartres Gegenstück und terrorisierte ebenfalls ihre Lehrer mit ihrer Klugheit und Selbstsicherheit. Sie starb 1925 neunzehnjährig an Tuberkulose. Sartre benannte die Heldin seines ersten Romans Der Ekel nach ihr.
Sartre ließ keine Gelegenheit aus – das Leben ist schließlich für die Lebendigen – und begann eine weitere Affäre ausgerechnet auf Annies Beerdigung, und zwar mit Simone Jollivet, der Tochter einer Schwester von Annies Vater. Sie war hochgewachsen, elegant, blauäugig und blond, ihr Vater Apotheker in Toulouse – und für Sartre die einzige Person auf der Beerdigung, die nicht provinziell und langweilig war.
Sie war eine verruchte Toulouser Salonlöwin und wurde später Schauspielerin, Theaterschriftstellerin und die Geliebte des bekannten Schauspielers, Theaterdirektors und Regisseurs Charles Dullin.
Ihre On-Off-Beziehung hielt drei Jahre und brachte einen umfassenden Briefwechsel hervor – wie fast alle seine persönlichen Beziehungen. Sartre war stolz, sie auf einem ENS-Ball an seinem Arm zu führen, bei dem sie ein gewagtes Kleid trug. Ihre mehr als bloß kokette Art schien ihm jedoch mehr Verdruss als Freude gebracht zu haben. Sie soll Sartre und Nizan einen aus ihrer Unterwäsche hergestellten Lampenschirm geschenkt haben, sehr zum Schrecken und zur Erregung der beiden Bücherwürmer.
Nach Jollivet, vielleicht um sich über sie hinwegzutrösten, verlobte Sartre sich mit der Cousine eines Kommilitonen. Er sah sie kaum, da sie in Lyon lebte, und die Beziehung endete, als ihre Eltern ihm die Hand ihrer Tochter verweigerten. Sartre war über die Trennung kurze Zeit betrübt, aber danach erleichtert. Der Hauptgrund für die Ablehnung der Eltern war, dass Sartre durch seine Prüfungen gefallen war.
Viele unglaubliche Dinge widerfuhren Sartre in seinem Leben, doch dass er 1928 durch seine Prüfungen fiel, ist eines der erwähnenswertesten. Sartre war von allen Menschen gewiss derjenige, der am unwahrscheinlichsten durch eine schriftliche Prüfung fallen konnte. Die Erklärung dafür war einfach und naheliegend. Seine Antworten waren derart verwegen und originell, dass sie die strengen Kriterien der Prüfung nicht erfüllten. Er schweifte von den gestellten Fragen ab. Wie viele brillanten Studenten vor und nach ihm verlief er sich gerne in seinen eigenen Gedankengängen.
Seine gescheiterte Prüfung bedeutete, dass er sein Zimmer im ENS-Wohnheim in der Rue d’Ulm verlor und eines in der Cité Universitaire beziehen musste. Der Rückschlag schien ihn nicht groß gekümmert zu haben, aber er beschloss Arons Ratschlag anzunehmen, seine große Originalität erst einmal hintanzustellen, nach den Spielregeln zu spielen und sichere Antworten zu geben, die die strengen Prüfungskriterien erfüllten.
Während er Lehrveranstaltungen an der Sorbonne besuchte und sich in der Bibliothèque Nationale herumtrieb, um für seine im Juni 1929 anstehenden Prüfungen zu lernen, bemerkte Sartre eine ernste junge Frau, die er seinen Freunden als hübsch und reizend, jedoch furchtbar gekleidet beschrieb.
Simone de Beauvoir wurde am 9. Januar 1908 in Paris geboren und war folglich zweieinhalb Jahre jünger als Sartre. Ihre kleinbürgerliche Familie hatte kurz nach dem Ersten Weltkrieg den größten Teil ihres Vermögens verloren und übernahm sich finanziell, um ihre Tochter in eine gute Klosterschule schicken zu können. Sie war ein tiefreligiöses Kind gewesen und hatte sogar erwogen, Nonne zu werden, bis eine Glaubenskrise zu Beginn ihrer Teenagerzeit sie für den Rest ihres Lebens zur Atheistin machte.
Nachdem sie am Institut Catholique in Paris Mathematik und am ebenfalls in der Hauptstadt befindlichen Institut Sainte-Marie Literatur und Sprachen studiert hatte, begann sie an der Sorbonne Philosophie zu studieren. Sie hörte auch Vorlesungen in der ENS, um sich auf die agrégation in Philosophie vorzubereiten, die dazu diente, eine Rangliste der hellsten Studenten Frankreichs aufzustellen – eine Reihe zäher Prüfungen, über deren erste Hürde sogar Sartre gestolpert war. De Beauvoir nahm ein Jahr früher als erforderlich daran teil. Die Sorbonne hatte erst kürzlich Frauen zugelassen und de Beauvoir war erst die neunte Frau, die dort einen Abschluss erreichte. Die Zeiten änderten sich und sie half später mehr als die meisten anderen Frauen des Jahrhunderts nach, dass sie sich auch weiterhin änderten.
Sie und Sartre bewegten sich in denselben Kreisen, waren beide außerordentlich an Philosophie interessiert und hatten gehört, wie gescheit der jeweils andere war. So war es unvermeidlich, dass sie einander irgendwann begegneten. Sartres Freund René Maheu (alias André Herbaud) kannte sie bereits und gab ihr den Spitznamen Castor – das französische Wort für „Bieber“. Der Spitzname hielt sich und Sartre nannte sie zeit seines Lebens mit diesem Kosenamen.
Wie de Beauvoir im ersten Band ihrer ausführlichen und brillanten Autobiographie Memoiren einer Tochter aus gutem Hause berichtet, „wollte Sartre gern meine Bekanntschaft machen; er schlug mir eine Begegnung am folgenden Abend vor“ (Memoiren einer Tochter aus gutem Hause, S. 318). Von Nizan unterstützt, schlug Sartre Maheu vor, ein Treffen zu organisieren; er wiederum lud de Beauvoir ein, Sartres kleine Gang kennenzulernen.
Maheu konnte an dem Treffen nicht teilnehmen. Und da er nicht wollte, dass Sartre in seiner Abwesenheit de Beauvoir an sich riss, überredete er sie dazu, stattdessen ihre Schwester Hélène (alias Poupette) zu schicken. Poupette kam zur Verabredung und entschuldigte ihre Schwester, die kurzfristig aufs Land habe verreisen müssen. Poupette und Sartre verbrachten einen angenehmen Abend miteinander, aber das Gespräch geriet ins Stocken – das einzige Mal in Sartres Leben, dass ihm so etwas passierte. Poupette berichtete, dass Sartre nicht so außergewöhnlich sei, wie Maheu ihn dargestellt hatte.
De Beauvoir zufolge begegnete sie Sartre erstmals, als Maheu sie einlud, in Sartres ekligem Zimmer voller Bücher und Zigaretten im Cité Universitaire Philosophie zu lernen. Die Genossen zählten auf ihre Hilfe bei Leibniz. „Ich war etwas aufgeregt, als ich Sartres Zimmer betrat; ich fand außer einem riesen Durcheinander von Büchern und Papieren überall umherliegende Zigarettenstummel und dicken Rauch vor. Sartre empfing mich als Weltmann; er rauchte Pfeife“ (Memoiren einer Tochter aus gutem Hause, S. 321).
Bei ihrer ersten Begegnung sprachen sie über Metaphysik. Sie war nervös, er enthusiastisch. Sie wurde zutraulicher, als sie begannen, einander besser kennenzulernen. Sartres kleine Gang war sich zwar einig, dass sie sich schrecklich kleidete, aber in Bezug auf den Intellekt war sie mit Sicherheit eine der Ihren.
Einigen Stimmen aus ihren damaligen Kreisen zufolge überromantisiert de Beauvoir die ersten Begegnungen zwischen ihr und Sartre, um den Eindruck der Liebe auf den ersten Blick zu vermitteln. „Sartre entsprach genau dem, was ich mir mit fünfzehn Jahren gewünscht und verheißen hatte: er war der Doppelgänger, in dem ich in einer Art von Verklärung alles wiederfand, wovon ich auch selber besessen war“ (Memoiren einer Tochter aus gutem Hause, S. 331). Die junge de Beauvoir liebte es, sich selbst wie Maggie Tulliver aus George Eliots Roman Die Mühle am Floss als sozial benachteiligte Heldin zu fühlen, die verzweifelt nach einem intellektuell und emotional anregenderen Leben dürstete.
Hatte de Beauvoir diese ersten Begegnungen wirklich so in Erinnerung oder nahm sie sich hier ein wenig zu viel künstlerische Freiheit heraus? Sicher ist, dass zwischen Sartre und de Beauvoir sich Leben und Literatur oft miteinander vermischten, nicht zuletzt weil sie beide sich darauf verstanden, ihr Leben in Literatur zu verwandeln. Ihre Biographen versuchen oft dasselbe, wenn sie über sie schreiben. Es ist unvermeidlich. Um es mit Sartres Worten oder denjenigen seines Alter Ego Antoine Roquentin zu sagen: „Und ich dachte so: Um das banalste Ereignis zu einem Abenteuer werden zu lassen, ist es erforderlich und ausreichend, es zu erzählen“ (Der Ekel, S. 46).
Was auf jeden Fall außer Zweifel steht, ist, dass im Jahr 1929 eine der berühmtesten, andauerndsten und intellektuell fruchtbarsten Beziehungen der Geschichte ihren Anfang nahm: Sokrates und Platon, Boswell und Johnson, Simon und Garfunkel, Bill und Hillary, Sartre und de Beauvoir. Legendäre Begegnungen des Geistes.
Nachdem Sartre beschlossen hatte, nach den Regeln zu spielen, waren die Ergebnisse der Prüfungen im Juni keine Überraschung: Sartre war Erster von 26 Kandidaten, de Beauvoir Zweite. Es war eine sehr enge Kiste, bei der die Jury lange debattiert hatte, wer Erster sein sollte. De Beauvoir war der jüngste Prüfungsteilnehmer und Sartres Ruf war durch seinen blendenden Vortrag „Psychologie und Logik“ deutlich gestiegen. Vielleicht hatte die Jury das Gefühl, ihn entschädigen zu müssen, nachdem sie ihn das erste Mal hatte durchfallen lassen, und de Beauvoir hätte eigentlich Erste sein müssen. Vermutlich werden wir es nie erfahren.
An dieser Stelle versteigen sich einige uninformierte Kommentatoren in eine Debatte darüber, wer von den beiden tatsächlich der größere Denker war – hauptsächlich solche, deren philosophische Kenntnisse von ihrem Wunsch, Skandale entdecken zu wollen, wo es keine gibt, weit übertroffen werden. Derartige Urteile basieren größtenteils auf bizarren, sehr gewollten Lesarten einzelner Textabschnitte und behaupten etwa, dass Sartre all seine Gedanken von de Beauvoir hatte und sie als seine eigenen ausgab oder dass de Beauvoir all ihre Gedanken von Sartre hatte und sie als ihre eigenen ausgab. Derartige Aussagen beruhen auf gewissen Vorurteilen darüber, wie eine Beziehung zwischen einem Philosophen und einer Philosophin zu sein habe; oder sie sind einfach das Ergebnis der Faulheit, sich die Feinheiten einer sehr außergewöhnlichen intellektuellen Vereinigung und funktionierenden Beziehung begreiflich zu machen.
Die beste Art, derartigen Unfug zu widerlegen und das intellektuelle Verhältnis zwischen de Beauvoir und Sartre wirklich zu verstehen, liegt darin, es in seinem historischen Kontext zu betrachten. De Beauvoir und Sartre nahmen dieselbe philosophische Tradition auf, zur selben Zeit und am selben Ort, zu einer Zeit großer sozialer und politischer Veränderungen zwischen zwei Weltkriegen. Seit ihrer ersten Begegnung teilten und entwickelten sie die Gedanken Descartes’, Kants, Hegels, Marx’, Freuds und anderer weiter, die sie als Studenten studiert hatten, glichen diese Gedanken mit ihrer gemeinsamen Lebensrealität ab und wandten sie auf ihre eigene Welt an, um sie zu erklären.
Derartige Gedankenspielereien scheinen in Bezug auf de Beauvoir und Sartre abwegig und doch geben einige Kommentatoren sich derartigen müßigen Spekulationen hin. Gerade weil sie beide so unabhängige Denker waren, zögerten sie niemals, ihre Gedanken und Meinungen miteinander auszutauschen. Es fand eine ständige Interaktion und schrittweise Verfeinerung der Gedanken zwischen ihnen statt. Jeder einzelne der beiden Philosophen war beständig die Hebamme der Ideen des anderen und beeinflusste infolgedessen die philosophischen Gedanken sowie die persönlichen und politischen Wertvorstellungen des anderen.
Selbstverständlich waren sie nicht immer derselben Meinung. Sie waren sogar oft verschiedener Meinung und stritten mit Leidenschaft. Aber diese Meinungsverschiedenheiten fanden immer in einer respektvollen, letzten Endes konstruktiven Debatte statt, in der These und Antithese durchdiskutiert wurden, um zu einer konstruktiven Synthese zu gelangen, die ihren Platz innerhalb des existentialistischen und später marxistischen und feministischen Denkens finden konnte.
Sartre und de Beauvoir wären wohl die Ersten, die der Aussage zustimmen würden, absolut ebenbürtig zu sein. Oder wenn es zunächst nicht zutraf, da Sartre etwas älter war, würden sie es zumindest bald werden. De Beauvoir berichtet in ihren Memoiren einer Tochter aus gutem Hause, dass Sartre bei ihrer ersten Begegnung mehr über Philosophie wusste als sie und sie in einer Diskussion in Grund und Boden argumentiert hätte. Er war bei Weitem die intelligenteste Person, der sie je begegnet war: der einzige Mensch, den sie jemals kannte, den sie nicht weniger intelligent als sich selbst fand. Diese absolute Ebenbürtigkeit ihrer großen Intellekte war die wichtigste Basis ihrer großen und andauernden Liebe füreinander.
Zweifellos wäre Sartres philosophischer Beitrag ohne ihren Einfluss ein anderer und hätte einen geringeren Eindruck hinterlassen. Aber andersherum ist es zweifellos genauso zutreffend.
Nachdem die Prüfungen endlich bestanden waren, ließen sie es eine Weile ruhig angehen, zumindest für ihre Verhältnisse. Sie freuten sich an der Gesellschaft des anderen, zogen durch Paris und diskutierten unablässig über Philosophie, Psychologie und Literatur. De Beauvoir ließ sich sogar so sehr gehen, zumindest für ihre Verhältnisse, dass Sartre scherzte, dass sie nun nur noch Hausfrau werden wolle.
Sie wussten, dass ihre Ruhe nicht lange dauern konnte, die Freiheit ihrer studentischen Tage vorbei war und nun die Verantwortung der Erwachsenenwelt lauerte. Sartre musste seinen Wehrdienst leisten und hatte sich für die Zeit danach bereits für einen Lehrauftrag in Japan beworben. Er wollte vermeiden, irgendwo in der französischen Provinz als Schullehrer enden zu müssen. De Beauvoir hätte sich auch als Lehrerin in der französischen Provinz beworben, aber sie beschloss, die Entscheidung zu verschieben und in Paris zu bleiben, während Sartre bei der Armee war.
Im Wissen, dass sie bald für lange Zeit getrennt sein würden, trafen sie ein sehr modernes Arrangement für ihre Beziehung. Sie wollten versuchen, einander so oft wie möglich zu sehen und ihre Beziehung als „notwendige Liebe“ aufzufassen. Aber sie würden beide auch für „kontingente Liebe“ offen bleiben: Beziehungen mit anderen Menschen. Alles andere als ein Bekenntnis zur Polygamie wäre ein Affront gegen die Freiheit gewesen, die sie so wertschätzten. Rückblickend gestand Sartre, dass dieses Beharren auf seinem Recht, mehrere Frauen zu haben, etwas lächerlich war, da Frauen ihm damals nicht besonders zugetan waren.
Obwohl dieses Arrangement Ursache vieler Sorgen und Strapazen war, leistete es ihnen jahrzehntelang gute Dienste, bis Sartres Tod im Jahre 1980 ihrem „Bund treuer Herzen“ (Shakespeare, Sonett 116) ein Ende setzte. Sie dachten nur ein einziges Mal darüber nach, tatsächlich zu heiraten – recht früh in ihrer Beziehung aus praktischen Gründen: Verheiratete Paare hatten Anspruch darauf, als Lehrer an derselben Schule angestellt zu werden. Doch sie lehnten die Ehe sogar als Lösung für praktische Probleme ab. Damit formulierten sie die wahrhaft existentialistische Sichtweise, dass der Ehestand bloß eine bürgerliche Institution sei, die versucht Menschen in einem intimen Bund aneinander zu ketten, der stattdessen jeden Tag erneuert werden müsse.
Liebende sollten der falschen Sicherheit von Eheversprechen und materiellen Verstrickungen widerstehen und akzeptieren, dass ihre Liebe einzig und allein auf der Freiheit des anderen fußen kann. Auf diese Weise zu leben wird eine Quelle großer Angst sein, aber Angst ist der Preis der Freiheit. Der wahre Existentialist wird lieber Angst ertragen, anstatt auf unredliche Weise nur um des Seelenfriedens willen der eigenen Freiheit und der des Geliebten künstliche und erstickende Grenzen aufzuzwingen.
Sartre begann seinen Wehrdienst in der Militärschule Saint-Cyr in der Nähe von Versailles, bevor er in eine Kaserne bei Tours verlegt wurde, etwa ein bis zwei Zugstunden von Paris und seiner geliebten Castor entfernt. Sie hatte begonnen, einen Roman zu schreiben, um sich in seiner Abwesenheit zu beschäftigen. Er wurde im Gebrauch meteorologischer Ausrüstung ausgebildet. De Beauvoir berichtet in In den besten Jahren, dem zweiten Band ihrer Autobiographie, dass er, als sie ihn das erste Mal besuchte, „sich nicht mit dem sturen Kommißgeist ab[fand] und auch nicht mit dem Verlust von achtzehn Monaten; er tobte“ (In den besten Jahren, S. 28). Sie waren beide Antimilitaristen.
Er schien jedoch problemlos mit der militärischen Disziplin zurechtzukommen und gewöhnte sich bald daran. Stets klagte er über Langeweile, die er sich mit Schreiben vertrieb. Neun Jahre später würde er sich erneut in einer militärischen Uniform wiederfinden und meteorologische Ausrüstung aufstellen, aber diesmal würde es kein Training mehr sein.
Während seines Militärdienstes erfuhr er, dass sein geplanter nächster Schritt, ein Lehrauftrag in Tokio, abgelehnt worden war. Eine Stelle als Schullehrer in der Provinz erwartete ihn nun, und am 1. März 1931 wurde er dem Lycée François Ier in Le Havre im Nordwesten Frankreichs zugeteilt, um einen Lehrer zu ersetzen, der einen Nervenzusammenbruch erlitten hatte. Der Star der ENS, der so vielversprechende Leistungen gezeigt hatte, fand sich einmal mehr im Exil der Provinz wieder. Zu diesem Zeitpunkt war er 25 Jahre alt.
Glücklicherweise waren es nur ein paar Monate bis zu den langen Sommerferien, von denen er und de Beauvoir den größten Teil auf einer Low-Budget-Rundreise durch Spanien zubrachten. Im Oktober desselben Jahres wurde ihr, 23-jährig, eine Stelle als Lehrerin im südöstlich gelegenen Marseille zugeteilt. Die Behörden hatten sie in entgegengesetzte Teile des Landes geschickt. Sie trafen sich in Paris, wann immer sie konnten, und erhielten in der Zwischenzeit ihre „notwendige Liebe“ mit einem schier endlosen Briefwechsel aufrecht.
De Beauvoir liebte Marseille und machte dort als echte Existentialistin gewiss das Beste aus ihrer Zeit. In In den besten Jahren erzählt sie, wie das Licht, die Hitze und die Energie der Stadt sie beeindruckten, noch bevor sie den Bahnhof verlassen hatte. Zudem kam sie zu einem herrlichen Bewusstsein ihrer eigenen Freiheit. Niemals zuvor in ihrem Leben war sie so frei gewesen. „Bisher war ich ganz von anderen Menschen abhängig gewesen. Grenzen und Ziele waren mir gesteckt, und ein großes Glück war mir geschenkt worden. Hier existierte ich für niemanden“ (In den besten Jahren, S. 79).
Wir lassen sie dort ihren Weg durch die helle Mittelmeersonne gehen und richten unseren Blick auf kältere und trübere Gegenden, in einen weit tristeren Hafen an der oft düsteren Nordwestküste Frankreichs.