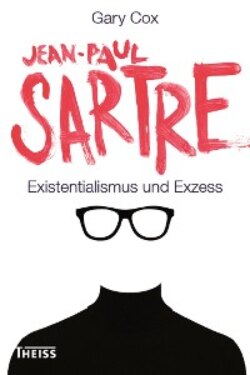Читать книгу Jean-Paul Sartre - Gary Cox - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
8 Ostraconophobie
ОглавлениеWieder zurück in Le Havre. Zurück in der Eintönigkeit der Kreidetafel. Sein nächster Geburtstag war der dreißigste. Der Beginn eines neuen Schuljahres nach der Freiheit in Berlin und der langen Sommerpause erfüllten ihn bald mit einem untypischen Pessimismus. In ihren dunkelsten Augenblicken sitzen er und de Beauvoir in Cafés in Le Havre und Rouen und grübeln über ihr Leben, in Sorge darüber, dass ihnen nichts Neues mehr widerfahren werde. Waren sie jetzt ewige Trauerklöße geworden, die ihre Verurteilungen zu Provinzlehrern ihr gesamtes Leben lang würden absitzen müssen, ohne sich auf mehr freuen zu können als die nächsten Ferien? Sie würden sich betrinken und streiten, bis sie zum Ergebnis gelangten, dass es ihr eigener Fehler sei, wenn sie feststeckten. Ihr Schicksal lag nirgends anders als in ihren eigenen Händen.
Sartre hatte in diesem Schuljahr außerordentlich viele gute Philosophieschüler, einschließlich Jacques-Laurent Bost, den jüngsten Bruder des Romanciers Pierre Bost. Der „kleine“ Bost wurde Sartres lebenslanger Freund und de Beauvoir, die ihn als anmutige Verkörperung der Jugend betrachtete, wurde seine gelegentliche Geliebte.
Um den verschiedenen Anforderungen seitens seiner Schüler, seinem Schreiben, seinen regelmäßigen Reisen nach Rouen und Paris gerecht zu werden, begann Sartre, sich an Aufputschmittel zu gewöhnen, die er mit einigen Unterbrechungen über Jahre hinweg nahm. Die Stimulantien befeuerten gewiss seine Feder, aber sie hinderten ihn am Schlafen. Das Gegenmittel waren folglich Schlaftabletten für den Rest seines Lebens. Er schlief wie ein Stein, in den Schlaf gewogen von einer chemischen Keule, und träumte selten.
Die Auf und Abs, die Arbeitsbelastung, die Sorge um seinen Status, das Gefühl, dass seine Jugend weit hinter ihm lag und er alt und fett wurde, all dies brachte ihn an den Rand der Depression. Manchmal war er gegenüber seinen Schülern leicht reizbar, obwohl niemand jemals behauptete, dass Sartre sich beim Unterrichten gelangweilt habe.
Mithilfe seines Alter Ego Antoine Roquentin, der Hauptfigur in Der Ekel, brachte er seine Depression in sein „Faktum über die Kontingenz“ ein. Es ging ihm immer um das „Faktum“, er ergänzte es, schnitt, schliff und schrieb Teile neu. Obwohl de Beauvoir den Eindruck hatte, dass er vorwärtskam, blieb sie schonungslos in ihrer konstruktiven Kritik und forderte unnachgiebig weitere Überarbeitungen.
Es war eine hervorragende Gelegenheit und zugleich eine weitere Bürde, als er seinen ersten Auftrag bekam: ein philosophisches Buch für eine neue Reihe zu schreiben, die bei Alcan veröffentlicht werden sollte. Er begann sofort mit der Arbeit an einem ehrgeizigen Buch über die Psychologie der Einbildungskraft unter dem Titel Das Imaginäre. Sein jahrelanges Interesse an der Psychologie war außerdem bei seinen erschöpfenden Berliner Husserl-Studien angeregt worden, woran er in Le Havre neben seinen weiteren Aufgaben weiterhin forschte.
Da er sich nicht damit zufrieden geben wollte, ein Buch zu schreiben, das lediglich die verschiedenen Theorien über die Vorstellung seit Descartes wiedergeben sollte – was ausgereicht hätte, um die Anforderungen der vorgeschlagenen Reihe zu erfüllen –, stellte er die verschiedenen Theorien mit dem Ziel dar, sie von einer husserlianisch-phänomenologischen Perspektive aus in Grund und Boden zu argumentieren. Dann legte er seine eigene phänomenologische Theorie über die Vorstellungskraft dar. Diese basierte auf dem Gedanken, dass geistige Abbilder nicht Bilder im Bewusstsein seien, sondern intentionale Objekte für das Bewusstsein.
Als jemand, der nie halbe Sachen machte, fasste Sartre einen Entschluss: Wenn er überzeugend über das am schwierigsten Greifbare aller Vorstellungsphänomene schreiben wollte, Halluzinationen nämlich, musste er dafür selbst halluziniert haben und etwas „sehen“, das absolut nicht da war. Es war ein typischer Fall von „Gib Acht, was du dir wünschst“, weil die Gelegenheit für eine Halluzination sich bereits Anfang 1935 darbot.
Kurz nach einem Skiurlaub über die Weihnachtszeit mit de Beauvoir lud Dr. Daniel Lagache, ein alter Freund aus Sartres ENS-Zeit, Psychiater und Autor des kürzlich erschienenen Buches Verbale Halluzinationen und Sprache, ihn ein, an einem psychologischen Experiment im Sainte-Anne-Hospital in Paris teilzunehmen. In einem schwach beleuchteten Raum wurde dem Mann, der aufgrund seiner Abhängigkeit von Schlaftabletten keine Träume mehr hatte, kontrolliert die psychoaktive Droge Meskalin injiziert.
Sartre scheint dabei keinen üblen Trip im gewöhnlichen Sinne einer langen und schweren Panikattacke gehabt zu haben, aber es war dennoch kein guter Trip und er hatte definitiv keinen Gefallen daran. Es war das Übliche: Zeit- und Raumverzerrungen, ein Regenschirm, der aussah wie ein Geier, und ein Angriff von Teufelsrochen. Die Teufelsrochen wurden durch einen Telefonanruf de Beauvoirs unterbrochen, die sich erkundigen wollte, wie es lief – den er tatsächlich annahm! Wer außer Sartre würde mitten in einem Trip einen Anruf annehmen?
Sein Sehen blieb wochenlang verzerrt: „[D]ie Häuser hatten grimassierende Gesichter, überall Augen und Kiefer; auf jedem Zifferblatt mußte er ein Eulengesicht suchen und finden“ (In den besten Jahren, S. 180). De Beauvoir berichtet weiter, dass er wusste, es handele sich bei den Gegenständen in Wirklichkeit nur um Häuser und Uhren, aber er fürchtete, dass er es eines Tages nicht mehr wissen würde. Beim Spazieren an irgendeinem elenden Fleck an der Seine in Rouen sagte er zu ihr, dass er „eine chronische Wahnpsychose“ (In den besten Jahren, S. 180) entwickele und bald wahnsinnig werde. Er nahm danach nie wieder Halluzinogene zu sich. Einmal war genug.
Er war nie ein Liebhaber von Krustentieren gewesen, doch nach seinem Meskalintrip verursachte ihr bloßer Anblick ihm jahrelang visuelle Flashbacks, von denen ihm übel wurde. Er konnte Alltagsgegenstände nie wieder so sehen wie vorher. Obwohl die Gegenstände irgendwann aufhörten, sich in irgendetwas Ungewöhnliches, Unvorhersehbares, Unsinniges und Unwirkliches zu verwandeln oder in etwas Krabbelndes, Krabben- und Fremdartiges, so hatte er dennoch immer das Gefühl, dass sie es konnten, dass es im Bereich des logisch Möglichen lag.
Die Langzeiteffekte des Meskalins intensivierten sich vor allem, wenn er niedergeschlagen war. Am unheimlichsten, da es am stärksten für eine tatsächliche geistige Krankheit sprach, war für ihn das immer wiederkehrende Gefühl, ja die Illusion, von einem riesigen Hummer verfolgt zu werden, der sich stets gerade außerhalb seines Sichtfeldes befand. Sartres berühmt-berüchtigter, unheimlicher Hummer ist zu einem der großen und düsteren komischen Features der Sartre-Folklore und von existentialistischer Folklore überhaupt geworden. Aber worum handelte es sich dabei wirklich?
Angst, Unruhe, Besorgnis, Furcht, dunkle Vorahnung, Furcht vor Schmerzen, Furcht vor dem Tod, Furcht vor dem Altern, Furcht vorm Erwachsenwerden – ein lauerndes Gefühl der fundamentalen Absurdität der eigenen Existenz, Depression, Furcht vor Depression, Furcht, den Verstand zu verlieren – all dies waren Symptome sowohl der Aufputsch- und Beruhigungsmittel als auch des Meskalins. Die drei zusammen brachten ihn an den Rand körperlicher und geistiger Erschöpfung. Waren sie die Folge von zu viel philosophischer Reflexion oder handelte es sich hierbei bloß um einen psychogastronomischen Nebeneffekt von zu viel französischem Käse?
Vermutlich spielten all diese Gründe eine Rolle. Niemand weiß es genau, nicht einmal Sartre selbst wusste es. Dieses verdammte Ding mit seinen Antennen und riesigen Zangen konnte jeden Augenblick um die Ecke oder hinter einem Berg hervorkommen. Immer wenn er versuchte, es zu ertappen, versteckte es sich sofort oder schlich sich an ihm vorbei, damit seine Existenz unmöglich zu beweisen oder widerlegen war. Außerdem sagte er ja nur, dass er das Gefühl hatte, dass ein riesiger Hummer ihn verfolgte. Aber er glaubte nicht daran. Es war nur seine Art auszudrücken, wie unerklärlich und auf unangenehme Weise merkwürdig er sich in jenen seltsamen Tagen fühlte.
De Beauvoir bestand darauf, dass sein einziger Wahnsinn darin bestand, dass er glaubte, wahnsinnig zu sein. Sie drängte ihn dazu, sich zusammenzureißen. Rückblickend, 25 Jahre später, bot sie die folgende Diagnose an:
Die Behandlung in Sainte-Anne lieferte Sartre lediglich gewisse Halluzinationsschemata. Zweifellos seien die Schreckbilder durch die Ermüdung und die Anspannung, die seine philosophischen Forschungen mit sich brachten, neu ausgelöst worden. Wir glauben heute, dass sie Ausdruck eines profunden Unbehagens waren. Sartre konnte sich nicht damit abfinden, in das „Vernunftalter“, das „Mannesalter“ einzutreten. (In den besten Jahren, S. 181)
Sicher ist, dass ab 1935 Krustentiere ein immer wiederkehrendes Thema in seinen Texten darstellten und für Boshaftigkeit, blinden Willen, derbe Natur und die nackte, absurde, nicht zu rechtfertigende Existenz stehen. Sie finden immer wieder ihren Weg in Der Ekel, einem seiner frühesten Werke, aber sie krabbeln auch noch 1959 in seinem Theaterstück Die Verurteilten von Altona herum, in dem die paranoide und an Wahnvorstellungen leidende Hauptfigur Franz glaubt, von der Zukunft her von bösen krabbenartigen Kreaturen beobachtet und kritisiert zu werden.
Diese Ostraconophobie war Sartres wichtigste Blockade, aber sie war nur ein Teil seiner allgemeinen Ablehnung von Flora und Fauna. Babys und kleine Kinder waren ihm zuwider, er hatte Angst vor Hunden und erkundete lieber Gebäude als Wälder; Bäume betrachtete er – wenn man sie aus nächster Nähe sieht wie Roquentin in Der Ekel – als die Verkörperung der rohen, überflüssigen Existenz. Einmal äußerte er gegenüber de Beauvoir sogar, allergisch gegen Chlorophyll zu sein.
Ich habe Angst vor Städten. Aber man soll doch in ihnen bleiben. Denn wenn man sich zu weit hinauswagt, stößt man auf das Gebiet der Vegetation. Kilometer um Kilometer schleicht die Vegetation an die Städte heran. Sie wartet ihre Zeit ab … [In einer Stadt] stößt man … kaum auf etwas anderes als auf Minerale, die am wenigsten Abschreckenden unter den Existierenden. (Der Ekel, S. 164)
Trotz des angerichteten psychologischen Schadens (obwohl es gewiss die Imagination des Autors nährte) erfüllte das Meskalinexperiment den Zweck, den Sartre beabsichtigt hatte. Wie er in Das Imaginäre. Phänomenologische Psychologie der Einbildungskraft sagt, gelang es ihm, sich drei kleine parallele Wolken vorzustellen, die vor ihm in dem Krankenzimmer schwebten, in dem er lag. Das war mehr als genug Material oder eher Nichtmaterial, das er sehr klar analysiert und mit dem er seitdem zahlreiche Philosophen und Psychologen beeinflusst hat.
Er behauptet, dass seine Halluzinationen heimlich an den äußersten Rändern seines Bewusstseins existierten und verschwänden, sobald er seine volle Aufmerksamkeit auf sie richtete. Dass sie verschwanden, sobald er sich konzentrierte, suggerierte ihm, dass er sie auf gewisse Weise träumte. Er schlussfolgert daraus, dass Halluzinationen aufkommen, wenn die Wahrnehmung sich auflöst und ein Mensch, der für sich selbst unwirklich geworden ist, die Welt der Wahrnehmung zu träumen beginnt.
In anderen Worten: Halluzinationen finden statt, wenn der Unterschied zwischen Wahrnehmen und Träumen bei einem Menschen verschwimmt, der einen Selbstverlust erlebt. Der Selbstverlust der Person wird größtenteils durch übereinstimmend berichtete Besonderheiten halluzinogener Drogenerfahrungen verursacht, die Entrückung von Zeit und Raum.
Das Meskalin hatte Sartre ordentlich durchgeschüttelt und eine Tür in seinem Geist, in seinen Wahrnehmungen geöffnet, die er nicht mehr zu schließen vermochte. Ein kühler Luftzug ging durch seine Selbstwahrnehmung. Irgendwann später schloss er die Tür, indem er sich selbst einfach für geheilt erklärte und bewusst daran glaubte – indem er sich wieder dem Vertrauen in die Realität hingab.
In der Zwischenzeit wurde ihm von einem Arzt verschrieben, dass er arbeiten solle, um sich abzulenken. Der Arzt weigerte sich, ihn krankzuschreiben, und verordnete ihm Teufelskirsche als Entspannungsmittel, in höheren Dosen ein halluzinogenes und tödliches Gift. Seine Angstattacken und Flashbacks waren am schlimmsten, wenn er alleine war; also verbrachte er immer mehr Zeit bei de Beauvoir in Rouen, die ihn mit ihrer Schülerin und Freundin Olga Kosakiewicz bekannt machte.
Die schöne, intelligente, stolze, stürmische und kapriziöse Olga war Sartre in de Beauvoirs Abwesenheit eine mehr als willkommene Gesellschaft. Olga machte seinem Kopf weitaus mehr zu schaffen als das Meskalin, obwohl diese neue Erfahrung ihm nicht nur Unannehmlichkeiten bereitete.