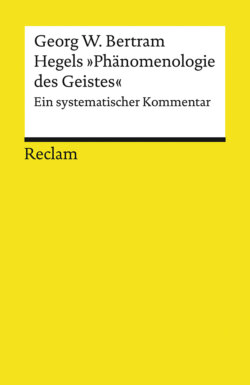Читать книгу Hegels "Phänomenologie des Geistes". Ein systematischer Kommentar - Georg W. Bertram - Страница 15
Detaillierter Kommentar I. Die sinnliche Gewissheit oder das Diese und das Meinen
ОглавлениеHegel beginnt seine Überlegungen mit einer Wissenskonzeption, die ihrem Selbstverständnis nach voraussetzungslos ist. Wir haben bereits in der Einleitung gesehen, dass es für ihn selbstverständlich ist (er spricht von einem »natürlichen Bewusstsein«), Wissen voraussetzungslos begründen zu wollen. Aus diesem Grund muss die Wissenskonzeption der sinnlichen Gewissheit am Anfang stehen. Sie macht geltend, dass Wissen durch den direkten Kontakt mit Gegenständen in der Welt erworben wird. Der Wissensanspruch, der hier vertreten wird, besagt, dass durch diesen direkten Kontakt, durch ein reines Auffassen der Welt, das reichste und konkreteste Wissen zustande kommt. »[E]ine Erkenntnis von unendlichem Reichtum« (85/82) solle auf diese Weise gewonnen werden.
Welche Gegenstandsauffassung aber korrespondiert diesem Anspruch? Hegels Kommentar zur »sinnlichen Gewissheit« gibt ein gutes Beispiel für die einer Bewusstseinsgestalt inhärenten Widersprüche, von denen Hegel in der Einleitung spricht. Die Gegenstandsauffassung nämlich bedeutet das Gegenteil dessen, was der Wissensanspruch verspricht. Die Gegenstandsauffassung ist die »abstrakteste und ärmste Wahrheit« (85/82). Dies sucht Hegel mit seiner Explikation gleich zu Anfang deutlich zu machen. Falls ein bloß direkter Gegenstandskontakt zu Wissen führen soll, so bedeutet das, dass nur eine einzige Beziehung im Spiel ist, nämlich diejenige des Bewusstseins auf seinen Gegenstand. Mögliche Beziehungen, die für den Gegenstand und das Bewusstsein sonst relevant sind, können entsprechend in dieser Wissenskonzeption nicht durch das Bewusstsein erfasst werden. Um sie zu erfassen, müsste es seinen Anspruch aufgeben, den Gegenstand durch einen unmittelbaren Kontakt zu wissen. So kommen für das Bewusstsein weder Beziehungen im Gegenstand, zum Beispiel zwischen unterschiedlichen seiner Eigenschaften, noch Beziehungen im Rahmen des Bewusstseins, zum Beispiel zwischen unterschiedlichen seiner Bewusstseinsinhalte, in Betracht. In Hegels Worten:
Ich, dieser, bin dieser Sache nicht darum gewiss, weil Ich als Bewusstsein hiebei mich entwickelte und mannigfaltig den Gedanken bewegte. Auch nicht darum, weil die Sache, deren ich gewiss bin, nach einer Menge unterschiedener Beschaffenheiten eine reiche Beziehung an ihr selbst, oder ein vielfaches Verhalten zu andern wäre. (85/82 f.)
Es bleibt bei dem direkten Kontakt des Bewusstseins zu seinem Gegenstand. Aus diesem Grund ist das »reine Sein« (86/83), das bloße »dies ist« der Gegenstand der sinnlichen Gewissheit. Damit wird, so insistiert Hegel, kein reiches, sondern ein überaus undifferenziertes und somit armes Wissen erworben. Der Gegenstand des Wissens steht im eklatanten Widerspruch zu dem erhobenen Wissensanspruch. Oder anders gesagt: Der Wissensanspruch wird durch die Wissenskonzeption nicht eingelöst.
Die Bewusstseinsgestalt des sinnlichen Wissens ist aber in ihrer Grundstruktur nicht hinreichend gefasst, wenn man nur die Unmittelbarkeit des Gegenstands betont. Die sinnliche Gewissheit, so Hegel, bezieht sich auf die Gegenstände, auf die sie sich bezieht, als eine Instanz von Unmittelbarkeit. Sie rechnet konstitutiv mit vielen Unmittelbarkeiten. Das aber bedeutet, dass die Unmittelbarkeit in der sinnlichen Gewissheit differenzbehaftet ist. Hegel sagt: Jeder Gegenstand der sinnlichen Gewissheit ist »ein Beispiel derselben« (86). Dies lässt sich genauer so verstehen: Die Konzeption eines Wissens durch unmittelbaren Kontakt mit Gegenständen, das zudem ein besonders reiches Wissen sein soll, gibt nur unter der Bedingung Sinn, dass es viele Situationen eines solchen unmittelbaren Kontakts gibt. Es gibt unterschiedliche Gegenstände, denen man in unmittelbarem Kontakt begegnen kann. Aus diesem Grund steht ein unmittelbarer Kontakt nicht für sich. Er ist immer ein Beispiel sehr vieler unmittelbarer Kontakte, die jeweils zu sinnlicher Gewissheit führen. Mit Hegels etwas aufgeladener Sprache kann man sagen: An jedem unmittelbaren Kontakt spielen viele andere unmittelbare Kontakte beiher (vgl. 86/83).27 Unter den Unterschieden möglicher Gegenstände sinnlicher Gewissheit ist dabei der Unterschied zwischen dem Subjekt (dem »Ich«) und dem Objekt (dem »Gegenstand«) von besonderer Bedeutung. Aus diesem Grund ist – entgegen der Grundhaltung der Wissenskonzeption – doch ein In-Beziehung-Setzen für das Wissen der sinnlichen Gewissheit entscheidend. Bereits in seiner Grundstruktur wird die Wissenskonzeption also ihrem eigenen Anspruch nicht gerecht.
Dieser Grundwiderspruch spielt auch in den unterschiedlichen Formen eine entscheidende Rolle, in Bezug auf die Hegel die Bewusstseinsgestalt im Folgenden weiter analysiert. Hegel unterscheidet drei Formen, in denen die sinnliche Gewissheit auftritt:
1 In der ersten Form ist ein äußeres Objekt der Gegenstand der sinnlichen Gewissheit (86–88/83–86),
2 in der zweiten Form das subjektive Bewusstsein in unterschiedlichen seiner Zustände (88–90/86–87).
3 Die dritte Form schließlich bezieht sich auf einen Zusammenhang von Subjekt und Objekt als seinen Gegenstand (90–92/87–90).
Hegel verfolgt diese unterschiedlichen Formen aus der Perspektive dessen heraus, der die Entwicklungen, denen er folgt, überschaut. Dies liegt darin begründet, dass die Wissenskonzeption der sinnlichen Gewissheit keine Beziehungen kennt – und damit auch keine Beziehungen des Wissenden auf sein Wissen. Wenn es in einer Bewusstseinsgestalt kein Wissen vom eigenen Wissen gibt, kann es auch keine Selbstkorrektur in Bezug auf den eigenen Wissensanspruch geben. Wer sich zu seinem eigenen Wissen verhält, kann sich durch Widersprüche in der eigenen Wissenskonzeption zu Entwicklungen genötigt sehen. Viele andere Wissenskonzeptionen, die Hegel im Rahmen der PhG kommentiert, vollziehen gewissermaßen aus sich selbst heraus Entwicklungen – die sinnliche Gewissheit tut dies nicht. In ihrem Fall führen die Widersprüche nur an sich zu einer Entwicklung, nicht für das Bewusstsein (vgl. zu diesem Vokabular hier S. 48 f.). Es kommt dem Kommentator Hegel zu, die Widersprüche der Bewusstseinsgestalt als Motor einer Entwicklung zwischen unterschiedlichen Formen, in denen die Gestalt auftritt, verständlich zu machen. Man kann ihn so verstehen, dass er sagt: Unterschiedliche Realisierungen der Wissenskonzeption hängen zusammen. Es gibt demnach einen Übergang von der Realisierung, der zufolge man Wissen aus dem direkten Kontakt mit äußeren Gegenständen zu gewinnen sucht, zu der Realisierung, in der ein entsprechender Kontakt mit eigenen Bewusstseinszuständen dies leisten soll, zu einer Realisierung, in der ein Konglomerat aus beidem die Basis des Wissens abgeben soll. Hegel zeigt, dass in allen drei Realisierungen die grundlegenden Widersprüche der Konzeption fortbestehen.
Die erste Form der sinnlichen Gewissheit ist besonders naheliegend: Es ist nach ihrem Verständnis ein Wissen, das durch direkten Kontakt mit einem äußeren Gegenstand zustande kommt. Um den Widerspruch dieser Konzeption herauszuarbeiten, stellt Hegel ihr eine einfache Frage: »Was ist das Diese?« (87/84) Die sinnliche Gewissheit will Wissen durch den direkten Bezug auf einen Gegenstand gewinnen. Einen solchen Bezug können wir sprachlich mit einem Demonstrativpronomen artikulieren. »Das Diese« steht für den direkten Bezug, der zu Wissen führen soll. Worin also besteht er? Hegel führt aus:
Nehmen wir es in der gedoppelten Gestalt seines Seins, als das Itzt und als das Hier, so wird die Dialektik, die es an ihm hat, eine so verständliche Form erhalten, als es selbst ist. Auf die Frage: Was ist das Itzt? antworten wir also zum Beispiel: Das Itzt ist die Nacht. Um die Wahrheit dieser sinnlichen Gewissheit zu prüfen, ist ein einfacher Versuch hinreichend. Wir schreiben diese Wahrheit auf; eine Wahrheit kann durch Aufschreiben nicht verlieren; ebensowenig dadurch, dass wir sie aufbewahren. Sehen wir itzt, diesen Mittag, die aufgeschriebene Wahrheit wieder an, so werden wir sagen müssen, dass sie schal geworden ist. (87/84)
Hegels These ist, dass die Konzeption eine Dialektik, also einen Widerspruch in sich trägt. Der Widerspruch zeigt sich in einem Versuch, das Konkrete, was durch den direkten Verweis gewusst werden soll, festzuhalten. Was festgehalten wird, ist aber nicht das konkrete Einzelne, sondern die räumlichen und zeitlichen indexikalischen Ausdrücke des Hier und des Jetzt. Gewusst wird also immer ein »Dies ist hier« oder »Dies ist jetzt« (oder beides).
Ein Hier oder ein Jetzt aber sind nicht konkret. Es handelt sich vielmehr um Verweisungen, die auf sehr vieles zutreffen können. Das heißt, dass sich hier in einer spezifischen Weise genau die Struktur zeigt, die Hegel schon allgemein im dritten Absatz des Abschnitts analysiert hat: Der direkte Kontakt der sinnlichen Gewissheit zu äußeren Gegenständen ist immer einer unter vielen. Ein bestimmtes Hier ist entsprechend immer ein Hier unter vielen Hier. Oder anders gesagt: Ein Hier gibt es nur, sofern es auch viele andere Hier gibt. Das Hier ist etwas, das sich auf vieles Einzelne anwenden lässt. Hegel sagt nun zu Recht: Eine Bestimmung (in diesem Fall eine einfache Verweisungsbestimmung, ein indexikalischer Ausdruck), die sich auf vieles Einzelne anwenden lässt, ist ein Allgemeines (wobei ein indexikalischer Ausdruck in seiner Struktur nicht mit einem Prädikat zu verwechseln ist, also einer Allgemeinbestimmung vom Typ »… ist ein Haus«). Entsprechend erläutert er die Struktur einer solchen Bestimmung, wie sie für das in der sinnlichen Gewissheit zustande kommende Wissen gilt, folgendermaßen:
Ein solches Einfaches, das durch Negation ist, weder dieses noch jenes, ein Nichtdieses, und ebenso gleichgültig, auch dieses wie jenes zu sein, nennen wir ein Allgemeines; […]. (88/85)
Hegel schließt an diese Erläuterung seine zentrale Diagnose an: »[…] das Allgemeine ist also in der Tat das Wahre der sinnlichen Gewissheit.« (88/85) Seine These ist damit, dass Gegenstände im Rahmen der Wissenskonzeption der sinnlichen Gewissheit – konträr zu ihrem Anspruch, etwas schlechthin Konkretes zu wissen – auf eine sehr allgemeine Art und Weise gewusst werden. Wer durch einen direkten Bezug auf Gegenstände Wissen realisiert, weiß das, was er weiß, durch die Allgemeinbestimmungen des »Dieses«, »Hier« und »Jetzt«. Mit Blick auf die sprachliche Praxis kann man das auch so ausdrücken: Er weiß, wie man »dieses«, »hier« und »jetzt« gebraucht. Da man solche demonstrativen und indexikalischen Ausdrücke in Bezug auf viele unterschiedliche Gegenstände gebrauchen kann, hat das Wissen keine konkrete Bestimmtheit.
Diese Diagnose Hegels macht verständlich, warum er zu Anfang seiner Erläuterungen sagt, es handele sich bei dem Wissen der sinnlichen Gewissheit um die »abstrakteste und ärmste Wahrheit« (85/82). Gewusst wird nicht das konkrete Einzelne, sondern vielmehr, wie man sich mit allgemeinen demonstrativen und indexikalischen Bestimmungen auf Einzelnes zu beziehen vermag. Die allgemeinen Bestimmungen sind dabei so verfasst, dass sie von jedem Konkreten gerade absehen. Sie beziehen sich in einer Art und Weise auf Einzelnes, in der man sich auf vieles Einzelne beziehen kann. So ist jeder entsprechende Bezug auf ein Einzelnes damit verbunden, dass es viele andere mögliche Bezüge auf Einzelne gibt, die aber in der entsprechenden Situation gerade nicht realisiert werden.
Hegel sagt aus diesem Grund – wie bereits gesehen –, dass in der sinnlichen Gewissheit immer schon Negationen im Spiel sind. Und das heißt, dass die Wissenskonzeption sich nicht nur erstens darin widerspricht, dass sie nichts Konkretes weiß. Sie widerspricht sich auch zweitens in ihrem Anspruch, dass das Wissen ganz direkt, ohne irgendwelche Beziehungen zustande kommt. In der Konstitution von allgemeinen Bestimmungen sind immer Beziehungen im Sinne von Negationen im Spiel: So wird unter anderem ein Zeitpunkt von anderen Zeitpunkten unterschieden und damit zu ihnen in Beziehung gesetzt. Entsprechende Beziehungen prägen den Gegenstandsbezug der sinnlichen Gewissheit.
Die Widersprüche in der Konzeption der sinnlichen Gewissheit machen nun Hegel zufolge die bereits angesprochene Bewegung zwischen unterschiedlichen Realisierungen dieser Konzeption verständlich. Da die einfache demonstrative Beziehung auf äußere Gegenstände kein konkretes Wissen zutage fördert, kann man dieses konkrete Wissen im bewussten Subjekt suchen wollen. Die einfachen Wahrnehmungszustände dieses Subjekts sind gute Kandidaten für etwas, von dem man durch direkten Kontakt Wissen haben kann. In Hegels Worten: »Die Kraft ihrer [der sinnlichen Gewissheit] Wahrheit liegt also nun im Ich, in der Unmittelbarkeit meines Sehens, Hörens, und so fort […].« (89/86)
In der damit variierten Konzeption treten jedoch aufs Neue die Widersprüche auf, die wir bereits kennengelernt haben. Sie realisieren sich hier durch den Bezug auf das wahrnehmende Ich. Das Ich ist die Bestimmung, die festgehalten wird, wenn man unmittelbar auf das eigene Wahrnehmen Bezug nimmt. Dies können wir mit dem Begriff eines (kognitiv verstandenen28) Selbstgefühls erläutern: Das Wissen, das ich direkt durch mein Wahrnehmen habe, kommt durch dieses Selbstgefühl zustande. Ein solches Selbstgefühl habe ich unabhängig davon, ob ich gerade sehe oder höre oder ob ich ein Haus sehe oder Buchstaben auf Papier. Jeweils weiß ich um das eigene Wahrnehmen aufgrund des Selbstgefühls, das ich habe. Aus diesem Grund weiß ich nicht ein spezifisches Sehen oder Hören oder etwas Ähnliches, sondern ich weiß mein allgemeines Ich, das sich über alle Unterschiede solcher spezifischen Formen der Wahrnehmung hinweg durchhält – als ein jeweiliges Beispiel von Ich-Sein. Damit zeigen sich erneut die beiden Widersprüche, die wir bereits geklärt haben: Das Wissen ist nicht konkret, und es kommt nicht unmittelbar, also ohne Negationen zustande.
Die Widersprüche, die auch in dieser zweiten Form der Wissenskonzeption der sinnlichen Gewissheit auftreten, motivieren ihrerseits aus Hegels Perspektive noch eine dritte Form, in der das Wissen weder auf Seiten des Gegenstands noch auf Seiten des Ichs, sondern in einer Verbindung beider Seiten gesucht wird. »Wir kommen hiedurch dahin, das Ganze der sinnlichen Gewissheit selbst als ihr Wesen zu setzen […].« (90/87) Dieser Form gemäß hat ein einfaches Wissen immer die Form »Ich Jetzt Tag« oder »Ich Hier Baum«. Gewusst wird immer der einzelne Zusammenhang, der zwischen einem wahrnehmenden Bewusstsein und einem bestimmten von diesem Bewusstsein wahrgenommenen Gegenstand besteht. Der Zusammenhang ist jeweils ein anderer, so dass der Eindruck entsteht, die sinnliche Gewissheit könne in dieser Art und Weise ihren Anspruch auf Konkretheit doch noch realisieren.
Wir haben damit hier eine Form der Wissenskonzeption vor uns, die ihre Widersprüche nicht so einfach offenbart wie die anderen beiden schon betrachteten Formen. Aus diesem Grund sagt Hegel, dass er sich die Spezifik des jeweiligen Zusammenhangs zeigen lassen will. Er will erläutern, wie aus der Perspektive der Bewusstseinsgestalt die Spezifik des jeweils Gewussten zustande kommt. Er kommentiert wieder die Struktur des einfachen zeitlichen indexikalischen Ausdrucks »jetzt« und legt wiederum dar, dass es sich um etwas Allgemeines handelt. Auch wenn die sinnliche Gewissheit immer spezifische Zusammenhänge des direkten Bezugs von Subjekten auf Gegenstände als Ganze fasst, kann sie die Spezifik dieser Zusammenhänge nur dadurch klären, dass sie zum Beispiel ein Jetzt, in dem ein spezifischer Zusammenhang besteht, als unterschieden von anderen Jetzt, in denen andere entsprechende Zusammenhänge bestehen, zur Geltung bringt. Das aber bedeutet, dass sich von neuem die alten Widersprüche ergeben. Das Wissen ist nicht konkret, sondern abstrakt; und es kommt nicht unmittelbar, sondern aus Beziehungen zu anderem heraus zustande.
Das grundlegende Problem von Konzeptionen, die den direkten Kontakt als Basis des primären und allerkonkretesten Wissens zu fassen suchen, lässt sich folgendermaßen zusammenfassen: Ein direkter Kontakt führt nur insofern zu Wissen, als er sich von anderen Momenten direkten Kontakts unterscheidet. So ist die Konzeption nicht, was sie ihrem Anspruch nach zu sein verspricht: Sie erklärt Wissen nicht als ein solches, das allein vom Gegenstand selbst ausgeht und das dabei darauf beruht, dass dieser sich direkt dem Bewusstsein offenbart. Vielmehr erklärt sie Wissen durch die Unterscheidungsleistungen, die das Bewusstsein vornimmt, wenn es zum Beispiel unterschiedliche Momente des Jetzt voneinander trennt.
Hegels These lautet somit, dass die Konzeption der sinnlichen Gewissheit von einer grundsätzlich falschen Idee dessen ausgeht, was Wissen ist. Wissen kommt dieser falschen Idee zufolge dort zustande, wo das Bewusstsein sich enthält, wo es die Welt bloß aufnimmt, wie sie ist. Das Gegenteil aber ist, wie sich ansatzweise in den Widersprüchen der Konzeption bereits gezeigt hat, der Fall: Wissen kommt nur dadurch zustande, dass das Bewusstsein – zum Beispiel durch Akte des Unterscheidens – auch aktiv wird, indem es in die Welt eingreift. Das gilt auch für Erfahrungen: Erfahrungen kann man nicht dadurch machen, dass man die Welt einfach auf sich wirken lässt. Sie erfordern immer auch Tätigkeit. Erst dort, wo man Gegenstände negiert – und dies zum Beispiel dadurch, dass man sie zu anderen Gegenständen in Beziehung setzt und dadurch von anderen Gegenständen unterscheidet –, kann man zu Wissen gelangen.
Dies wird auch in den Bewegungen zwischen den unterschiedlichen Realisierungen der sinnlichen Gewissheit indirekt deutlich: Auch wenn die Konzeption nicht selbst ihre Widersprüche bemerkt, so gehen die unterschiedlichen Realisierungen (vom direkten Gegenstandskontakt zum direkten Selbstkontakt, zum direkten Kontakt zu einem Gegenstand-Bewusstsein-Konglomerat) doch aus einer Aktivität des Bewusstseins hervor. Das Bewusstsein reagiert auf die Widersprüche in der Realisierung seines Anspruchs, indem es erste Realisierungen negiert. Schon in frühesten kulturellen Praktiken ist, so Hegel in einer unnachahmlichen Polemik, die Bedeutung der Negation, die hier am Beispiel des Verzehrs illustriert ist, für die menschliche Auseinandersetzung mit der Welt reflektiert worden:
In dieser Rücksicht kann denjenigen, welche jene Wahrheit und Gewissheit der Realität der sinnlichen Gegenstände behaupten, gesagt werden, dass sie in die unterste Schule der Weisheit, nämlich in die alten Eleusischen Mysterien der Ceres und des Bacchus zurückzuweisen sind, und das Geheimnis des Essens des Brotes und des Trinkens des Weines erst zu lernen haben […]. (94/91)