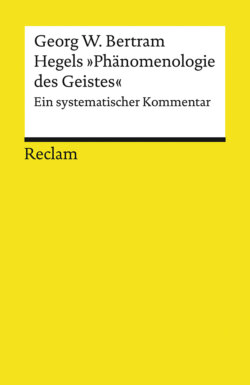Читать книгу Hegels "Phänomenologie des Geistes". Ein systematischer Kommentar - Georg W. Bertram - Страница 6
Gestalt und Struktur der PhG
ОглавлениеDie PhG ist ein eigentümliches philosophisches Buch. Vergleicht man sie zum Beispiel mit den großen philosophischen Abhandlungen der Neuzeit – also zum Beispiel mit Descartes’ Meditationes de prima philosophia, mit Lockes Essai Concerning Human Understanding und Kants Kritik der reinen Vernunft –, so fällt auf, dass Hegel keinen Traktat geschrieben hat: Das Buch entwickelt nicht systematisch eine Position, mit der ein bestimmter Bereich philosophischer Fragestellungen gewissermaßen sukzessive ab- und ausgearbeitet wird. Hegel rechtfertigt diese Eigentümlichkeit in der Einleitung der PhG, in der er die Gründe dafür darlegt, warum es aus seiner Sicht problematisch ist, einfach systematisch eine philosophische Position zu entwickeln.
Diese Gründe werde ich im Kommentar der Einleitung ausführlich erörtern. An diesem Punkt reicht es erst einmal, die Eigentümlichkeit der PhG weiter zu charakterisieren: Sie entwickelt nicht systematisch eine eigene Position, sondern ordnet vielmehr andere Positionen in einer systematischen Art und Weise. Diese Positionen sind aber oftmals nicht klar als solche einzelner Philosophen zu erkennen; sie beziehen auch naturwissenschaftliche Theorien wie die Newtonsche Theorie der Massenanziehung und historische Ereignisse wie die Französische Revolution im weitesten Sinn mit ein. So haben Leserinnen und Leser erst einmal den Eindruck, in der PhG mit einem bunten Reigen an Themen konfrontiert zu werden, die sich nicht in ein klares und stringent entwickeltes Gesamtbild fügen.
Eine weitere Eigentümlichkeit der PhG besteht darin, dass sich im Laufe von Hegels Arbeit an dem Text das Projekt verändert hat.4 Besonders markant ist hier die Änderung des Titels, die sich an der zuerst geschriebenen Einleitung festmachen lässt, die den Titel erläutert, den Hegel dem Buch zuerst geben wollte: Wissenschaft der Erfahrung des Bewusstseins. Die Konzeption einer solchen Wissenschaft bestimmt dann auch nicht nur die Einleitung, sondern auch die ersten Kapitel. Bis zum Vernunftkapitel lässt sich das Buch durchaus so lesen, als ob Hegel seiner ursprünglichen Konzeption gefolgt ist. Dann aber scheint er diese Konzeption verschoben zu haben.5
Äußerlich schlägt sich diese Verschiebung darin nieder, dass die Proportionen des Buches zunehmend unwuchtig werden. Der ersten Gliederung Hegels zufolge gibt es vier Teile (Bewusstsein, Wahrnehmung, Kraft und Verstand sowie Selbstbewusstsein), die zwar nicht gleich lang sind, aber doch im weitesten Sinn in einem gemeinsamen Rahmen bleiben. Mit dem Vernunftkapitel aber kommt es zu einem deutlichen Ungleichgewicht, und spätestens das Geistkapitel sprengt den zuerst entwickelten Rahmen ganz, denn es ist vom Umfang her gesehen fast so lang wie alle bisherigen Teile zusammen. Die Disproportionen im Aufbau des Buches kann man als Symptom dafür verstehen, dass Hegel die Konzeption seines Buches während der Niederschrift verändert hat. Inhaltlich hängt die Revision damit zusammen, dass ihm die Wichtigkeit dessen, was er Geist nennt, für sein Vorhaben zunehmend klarer geworden sein dürfte. Entsprechend kommt es mit dem Geistkapitel auch zu einem gewissen Neuansatz in dem Buch, der sich symptomatisch daran zeigt, dass Hegel sagt, er habe bislang »Gestalten […] des Bewusstseins« rekonstruiert, widme sich nun aber »Gestalten einer Welt« (340/326)6 (hier will ich dies nur als Symptom anführen, lasse also die Begriffe noch unkommentiert).
Die konzeptionellen Änderungen schlagen sich auch darin nieder, dass Hegel seinem Werk einen neuen Titel gibt: Phänomenologie des Geistes. Dieser neue Titel wurde aber durch die Ankündigungen der Einleitung nicht vorbereitet. Dies mag einer der Gründe dafür sein, dass Hegel dem Buch am Ende noch eine lange Vorrede beigegeben hat, die das Projekt mit Blick auf die geänderte Konzeption erklärt.
Hegel hat nicht nur den Titel geändert, sondern auch noch eine zweite Gliederung eingefügt, mit der die Unwucht jedoch nicht beseitigt wird. Hat die erste Gliederung schon nach 20 Prozent des Textes vier von acht Teilen absolviert, so dass 80 Prozent des Textes eine Hälfte der Gliederung ausmachen, so hat die zweite Gliederung nach den besagten 20 Prozent bereits zwei von drei Teilen zurückgelegt.
Immerhin wird in der zweiten Gliederung der große Schlussteil in vier Unterteile gegliedert. Hegel stellt damit einen Zusammenhang von der Vernunft bis zum absoluten Wissen her. Irritierend aber ist wiederum, dass dieser große Schlussteil keinen eigenen Titel trägt, so dass nicht recht klar wird, unter welchem Oberbegriff für Hegel dieser Zusammenhang besteht. Wie bereits erwähnt, wird inhaltlich besonders mit dem Beginn des Geistkapitels eine Zäsur in dem Text deutlich. Dies würde dafür sprechen, einen Zusammenhang von diesem Kapitel bis zum Ende herzustellen. Warum genau Hegel den abschließenden Zusammenhang in der neuen Gliederung schon mit dem Vernunftkapitel beginnen lässt, bleibt offen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Text ohne jeden Zweifel Spuren eines work in progress trägt. Die textliche Gestalt ist weder, was den Titel angeht, noch mit Blick auf Gliederung und Gesamtstruktur aus einem Guss. Das heißt selbstverständlich nicht, dass hier unterschiedliche Gedanken vorlägen, die wir nicht in einen Zusammenhang bringen könnten. Es heißt aber, dass jede Interpretation der PhG mit dem Problem konfrontiert ist, mit den Verwerfungen in der Struktur umzugehen und sie als Aspekt der Eigentümlichkeit von Hegels Text im Blick zu behalten.