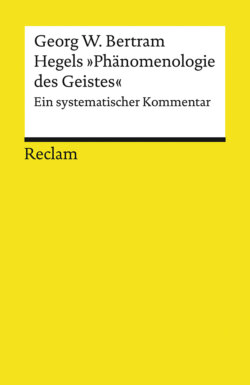Читать книгу Hegels "Phänomenologie des Geistes". Ein systematischer Kommentar - Georg W. Bertram - Страница 17
III. Kraft und Verstand, Erscheinung und übersinnliche Welt
ОглавлениеDie dritte Gestalt, die Hegel im Bewusstseinskapitel kommentiert, hebt die Widersprüche auf, die sich in der als Wahrnehmung bezeichneten Wissenskonzeption ergeben haben. Aufgehoben wird in erster Linie der Widerspruch zwischen der Einheit des Gegenstands (der substantiellen Auffassung) und der Vielheit der Eigenschaften (der phänomenalen Auffassung). Dies geschieht dadurch, dass die Einheit des Gegenstands mit den Eigenschaften, mit denen er erscheint, versöhnt wird. Damit kommt eine neue Wissenskonzeption ins Spiel, die Hegel als Verstand bezeichnet. Der Verstand sucht Wissen dadurch zu erlangen, dass Gegenstände als Quelle von Kräften begriffen werden, die sich in Erscheinungen zeigen. Charakteristisch für die Wissenskonzeption des Verstandes ist also, dass sie sich nicht an die Erscheinungen und Gegenstände hält, sondern eine theoretische Größe einführt, die die Einheit des Gegenstands ausmacht und die sich in seinen Erscheinungen äußert.
Aus diesem Grund charakterisiert Hegel die Wissenskonzeption mit dem Begriff der »übersinnlichen Welt«. Es handelt sich dabei um den Versuch, die Grundlage des Wissens weder im direkten Kontakt mit den Gegenständen noch in den Wahrnehmungen von Eigenschaften, sondern in hinter den Gegenständen wirksamen Kräften zu suchen, also dadurch, dass man über die sinnliche Welt hinausgeht. Der Übergang zu einer »übersinnlichen Welt« macht dabei deutlich, dass es Hegel im Bewusstseinskapitel nicht im engeren Sinn um empiristische Positionen geht. Er diskutiert nicht Konzeptionen, die Wissen in einem sinnlichen Gegenstandsbezug fundieren, sondern interessiert sich für die Fundierung von Wissen in einem Gegenstandsbezug überhaupt. Der Verstand bezieht sich auf übersinnliche Gegenstände – auf Kräfte und Gesetze – und beansprucht durch diesen Bezug Wissen zu begründen.
In seinen Darlegungen zu dieser Wissenskonzeption geht es Hegel in erster Linie um zweierlei: Zum einen legt er – negativ – dar, dass der Gedanke einer übersinnlichen Welt auch nicht zu einer plausiblen Konzeption von Allgemeinheit führt. Zum anderen klärt er, dass die Widersprüche der Wissenskonzeption zu einer Aufhebung in einer grundlegend anderen Art und Weise führen, Allgemeinheit zu fassen, nämlich im Selbstbewusstsein.
Der Abschnitt lässt sich in drei Teile teilen:
1 Im ersten Teil (112–125/107–120) wird mit dem Begriff der Kraft ein erster theoretischer Gegenstand kommentiert, der die Erscheinungen erklären soll.
2 Der zweite Teil (125–136/120–130) präsentiert dann aufgrund der Widersprüche, zu denen der Begriff der Kraft führt, den Begriff des Gesetzes und wiederum zugleich die mit diesem verbundenen Widersprüche, die Hegel mit der Rede von der »verkehrten Welt« ausweist.
3 Der abschließende dritte Teil (136–142/130–136) liefert eine Zusammenfassung und – dies ist besonders wichtig – den Übergang zum Selbstbewusstseinskapitel.
Der Abschnitt »Kraft und Verstand« ist einer der Abschnitte von Hegels Buch, die besonders dicht und unverständlich sind. Es ist aus diesem Grund sinnvoll, erst einmal danach zu fragen, wie wir den Grundansatz der Wissenskonzeption, die in diesem Abschnitt diskutiert wird, verstehen können. Dabei können wir uns an der Gegenstandsauffassung orientieren, die mit der Wissenskonzeption verbunden ist. Die Konzeption bezieht sich auf theoretische Gegenstände, zuerst auf Kräfte und dann auf (naturwissenschaftliche) Gesetze. Der Anspruch besteht darin, Wissen von diesen theoretischen Gegenständen dadurch zu erlangen, dass sie durch wahrnehmbare Erscheinungen erschlossen werden. Wissen soll auf diese Weise durch Erklärungen dessen, was sich in Erscheinungen zeigt, gewonnen werden. Dabei greifen diese Erklärungen auf theoretische Gegenstände zurück.
Hegel legt nun dar, dass hierbei wiederum ein grundlegender Widerspruch auftritt: der Widerspruch zwischen dem Beständigen und dem Unbeständigen. Der Anspruch der Wissenskonzeption besagt, dass theoretische Gegenstände das zum Ausdruck bringen, was beständig ist und das Wesen der Dinge ausmacht. Demgegenüber werden die Erscheinungen als unbeständig und unwesentlich verstanden.
Genau diesem Anspruch aber wird die Wissenskonzeption nicht gerecht, da sie nolens volens die theoretischen Gegenstände als genauso unbeständig wie die Erscheinungen begreift. Dieses Scheitern des Verstandes an seinem eigenen Anspruch liegt für Hegel darin begründet, dass er das Beständige weiterhin gegenständlich zu bestimmen sucht. Hegel drückt es so aus: »Dies unbedingte Allgemeine, das nunmehr der wahre Gegenstand des Bewusstseins ist, ist noch als Gegenstand desselben; es hat seinen Begriff als Begriff noch nicht erfasst.« (112/107 f.) Diese Diagnose besagt: Der Verstand denkt die Beständigkeit theoretischer Größen noch unhinterfragt als etwas, auf das man sich gegenständlich zu beziehen hat, fragt also nicht danach, worin Beständigkeit überhaupt besteht. So kann er auch keinen Sinn daraus ziehen, dass das Beständige sich nicht stabilisieren lässt, dass es sich als unbeständig erweist. Dies wird erst durch die grundlegende Umorientierung in der Explikation von Wissen möglich, die Hegel ab dem Selbstbewusstseinskapitel nachvollzieht.
Das Scheitern des Verstandes an seinen eigenen Ansprüchen lässt sich erst einmal am Begriff der Kraft nachvollziehen, mittels dessen Hegel sich auf naturwissenschaftliche Theorien seiner Zeit bezieht. Wer Erscheinungen durch in den Dingen wirksame Kräfte erklärt, der geht davon aus, dass Kräfte sich in Erscheinungen ausdrücken. Der Ausdruck aber ist nicht selbst die Kraft, sondern von der Kraft verschieden. Aus diesem Grund muss er als das Wirken einer anderen Kraft erklärt werden. Hegel spricht hier von »sollizitieren« – von einem »Anreizen«: Um sich zu äußern, muss eine Kraft von einer anderen angereizt werden. Erstere ist die »sollizitierte« und letztere die »sollizitierende« Kraft (vgl. 117/112 f.). So hat eine Kraft (als Erklärung dessen, was sich ausdrückt) nur im Rahmen von mehreren Kräften Bestand.
Damit ist grundsätzlich schon absehbar, dass es mit dem Begriff der Kraft nicht gelingt, einen theoretischen Gegenstand zu fassen, der für sich Bestand hätte. Kräfte gibt es nur im Rahmen eines »Spiels der Kräfte« (121/116), innerhalb dessen keine der Kräfte aus sich heraus besteht. Keine Kraft hat aus sich heraus Realität, sondern – wenn überhaupt – hat das Realität, was die Kräfte untereinander verbindet. Aus diesem Grund sagt Hegel: »Die Realisierung der Kraft ist also zugleich Verlust der Realität […].« (120/115) Für den Wissensanspruch des Verstandes bedeutet dies: Der Verstand sieht sich gezwungen, von dem Gedanken Abstand zu nehmen, dass man von spezifischen Erscheinungen auf spezifische theoretische Gegenstände schließen kann. Die angenommenen theoretischen Gegenstände lassen sich nur dadurch fassen, dass sie unter anderen entsprechenden Gegenständen verortet werden. Es gibt also nicht einzelne Kräfte, sondern Kraft überhaupt, und zwar in unterschiedlichen Erscheinungsformen.
Man kann hier davon sprechen, dass Kräfte holistisch konstituiert sind: Eine Kraft gibt es nur dann, wenn es zugleich viele andere Kräfte gibt. Für die Erkenntnis von Kräften, auf die der Verstand aus ist, bedeutet dies, dass ich eine Kraft nur dadurch zu begreifen vermag, dass ich zugleich viele andere Kräfte begreife. Kräfte bestehen, diesem holistischen Charakter entsprechend, immer in einem Zusammenhang von Kräften. Sie haben also nicht nur für sich keine Realität, sondern genau genommen überhaupt keine Realität, wie Hegel im Weiteren darlegt:
Es ist also weder die Kraft noch das Sollizitieren und Sollizitiert-werden, noch die Bestimmtheit, bestehendes Medium und in sich reflektierte Einheit zu sein, weder einzeln für sich etwas, noch sind es verschiedene Gegensätze; sondern was in diesem absoluten Wechsel ist, ist nur der Unterschied als allgemeiner oder als ein solcher, in welchen sich die vielen Gegensätze reduziert haben. Dieser Unterschied als allgemeiner ist daher das Einfache an dem Spiele der Kraft selbst, und das Wahre desselben; er ist das Gesetz der Kraft. (125/120)
Der Verstand kommt damit zu einem neuen Verständnis der theoretischen Gegenstände, auf die er sich bezieht: Es handelt sich um Gesetze. Diese sollen das eigentlich Beständige hinter den Erscheinungen ausmachen: »Die übersinnliche Welt ist hiemit ein ruhiges Reich von Gesetzen […].« (125 f./120)
Aber auch diese neuen theoretischen Gegenstände erweisen sich als instabil. Hegel erläutert das mit dem Begriff der »verkehrte[n] Welt« (133/128). Wiederum geht es ihm um die Frage, ob die theoretischen Gegenstände aus sich heraus Bestand haben. Seine Antwort ist – plausiblerweise – ein Nein. Ein Gesetz gibt es nur durch die einzelnen Fälle, die unter dem Gesetz stehen. Für das Gesetz gilt entsprechend, was schon für die Kräfte galt: Es hat nur in seinen Erscheinungen Bestand. Nun aber sollen die Erscheinungen zugleich von dem Gesetz unterschieden werden, denn sie sind unbeständig und wechselnd, das Gesetz hingegen ist beständig und unterliegt keinem Wandel. Der Verstand ist von daher dazu verleitet, die Erscheinungen als eine Form des Seins und die Gesetze als eine andere Form des Seins zu begreifen. Mit dieser Verdopplung dessen, was ist, kommt es nun auch zu einer Verdopplung dessen, was sich zeigt. Die Erscheinungen zeigen sich in ihrem Sein genauso, wie die Gesetze sich in ihrem Sein zeigen. Dabei zeigen sich die Gesetze, die ja von den Erscheinungen her erschlossen worden sind, jetzt in ihrer Eigenart durch ein anderes Erscheinen. Da aber jegliches Erscheinen nur von den Erscheinungen her bekannt ist, lässt sich ein anderes Erscheinen in seiner Andersheit nur dadurch fassen, dass man die Erscheinungswelt verkehrt.
Eine solchermaßen verkehrte Welt aber ist für Hegel nur ein Symptom dafür, dass der Zusammenhang von Gesetz und Erscheinung nicht angemessen begriffen wird. Es handelt sich nicht um einen Unterschied zwischen verschiedenen Formen des Seins, sondern nur um einen Unterschied zwischen zwei verschiedenen Auffassungsweisen.32 Erscheinungen und Gesetze sind also ein und dasselbe. Genau dies begreift der Verstand nicht, da er Wissen durch einen Bezug auf etwas Gegenständliches, das Bestand hat, erlangen will. Der Verstand zeigt auch hier noch einmal den grundlegenden Widerspruch zwischen dem Beständigen und dem Unbeständigen. In dem Versuch, das Beständige festzuhalten, gelingt es ihm nicht, dessen Zusammenhang mit dem Unbeständigen zu denken. Aus diesem Grund setzt sich dieser Zusammenhang immer wieder gegen die Ansprüche der Wissenskonzeption durch.
Diese Diagnose Hegels gibt uns eine erste Idee davon, wie Hegel den Übergang zum Selbstbewusstseinskapitel denkt: Er wendet sich nun einer Wissenskonzeption zu, deren Anspruch es ist, der Bewegung zwischen dem Beständigen und dem Unbeständigen gerecht zu werden. Hegel charakterisiert diese Bewegung sehr abstrakt, indem er von »Unendlichkeit« (vgl. 136 f./131 f.) spricht. Diese Unendlichkeit ist aber kein Gegenstand, auf den ein Bewusstsein sich (theoretisch) bezieht. Es handelt sich um das Sein des Bewusstseins selbst, das aus einer steten Veränderung aus Bezugnahmen auf Gegenstände heraus besteht. Selbstbewusstsein ist so Hegels allgemeiner Titel dafür, dass das Bewusstsein sich in seinen eigenen Bewegungen begreift. Dieser Begriff aber ist nicht dadurch zu realisieren, dass das Bewusstsein sich zum Gegenstand macht. Zu realisieren ist er nur durch Praktiken, mittels deren das Bewusstsein seine Einheit herstellt. Sehr verkürzt gesagt: Der Übergang vom Bewusstseinskapitel zum Selbstbewusstseinskapitel ist ein Übergang von Wissenskonzeptionen, die Wissen theoretisch, zu Wissenskonzeptionen, die Wissen praktisch zu begründen suchen.
Robert Stern hat klärend dargelegt, dass die Interpretation des Übergangs vom Bewusstseinskapitel zum Selbstbewusstseinskapitel in dieser Weise von der Frage gelöst werden kann, ob Hegel es mit Kant hält oder nicht.33 Kant hat die These vertreten, dass Zusammenhänge im Wissen nur unter der Voraussetzung einer Einheit des Selbstbewusstseins (der sogenannten »transzendentalen Apperzeption«) möglich sind.34 Es sieht nun erst einmal so aus, als schließe sich Hegel hier dieser Kantischen These an, wenn er zu argumentieren scheint, dass Wissen seine Einheit nur im Selbstbewusstsein gewinnt.35 Die hier skizzierte Interpretation macht aber verständlich, dass der Übergang anders gedeutet werden muss: Es handelt sich um einen Übergang, mit dem wir zu einem ersten Verständnis davon gelangen, dass Wissensansprüche immer in praktischen Kontexten zustande kommen.