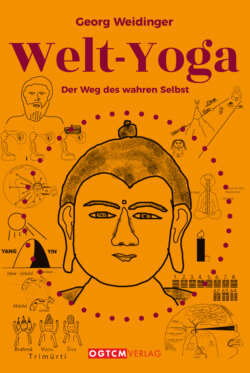Читать книгу Welt-Yoga - Georg Weidinger - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Gita als Yoga-Lehrbuch
ОглавлениеDie Gita ist brahmavidyayam yogashastra, ein Lehrbuch über die höchste Wissenschaft des Yoga. Dabei stellt die Gita vier Wege des Yoga vor, welche den vier Hauptpfaden der hinduistischen Mystik entsprechen.
1. Jñāna-Yoga, der Yoga des (wahren) Wissens. Anhänger dieses Weges benutzen ihr Denken, ihren Willen, ihren Geist, um sich nicht mehr mit Körper und Geist zu identifizieren. Dabei wird Avidya, das Nichtwissen, als die Wurzel des Übels angesehen. Es geht nicht bloß um intellektuelles Philosophieren, sondern um Hören (oder Lesen), um das Darüber-Nachdenken, dann um das Darüber-Meditieren, mit dem Ziel, das Wissen sickern zu lassen, eine Art „intuitives Begreifen“ zu erlangen und schlussendlich das Wissen zu erfüllen, zu verwirklichen: man erkennt die Wahrheit und das eigene Selbst.
2. Bhakti-Yoga, der Yoga der Hingabe. Dieser Yoga-Weg bedeutet Liebe und Hingabe zu Gott, zu Brahman, um das eigene Ich abzulegen und das eigene Selbst, Ātman, als Teil dieses Gottes zu erkennen. Das ist der Weg, den die meisten Mystiker in den verschiedenen Religionen (Christentum, Judentum, Islam) beschreiten.
3. Karma-Yoga, der Yoga der Tat, der Yoga des selbstlosen Dienens. Bei diesem Weg steht im Vordergrund, die Anhaftung an weltliche Ziele und Interessen des Ich abzulegen sowie zum Wohle anderer zu handeln. Ein leuchtendes Beispiel des Karma-Yoga ist Mahatma Gandhi. Dabei geht es weniger darum, allen Besitz zu verschenken, sondern darum, die Anhaftung an den Besitz loszulassen. Zum Beispiel ist es dann als Unternehmer nicht wichtig, dass man viel Profit macht, sondern dass es allen Mitarbeitern gut geht, sie durch die Firma ein glückliches Leben führen können und dass die Menschen, die die Produkte der Firma kaufen, ein gutes, faires und sinnvolles Produkt bekommen.
4. Rāja-Yoga, der Yoga der Meditation. Dabei steht die Selbstbeherrschung der Sinne und des Geistes im Vordergrund, um in der Stille der Meditation das eigene ewige Selbst zu finden. In späterer Zeit wird er mit Aṣṭāṅga-Yoga (achtgliedriger Yoga) gleichgesetzt, was wir noch sehen werden.
Die Gita hat 18 Kapitel, wobei die ersten 6 Kapitel dem Karma-Yoga zugesprochen werden, die mittleren 6 Kapitel dem Jñāna-Yoga und die letzten 6 Kapitel dem Bhakti-Yoga. Die Gita beginnt also mit dem Weg des selbstlosen Handelns, folgt dann dem Weg des Wissens mit der Selbsterkenntnis als Frucht und endet auf dem Weg der Liebe.
Das Verbindende ist „Yoga“ als Weg. Kṛṣṇa setzt verschiedene Schwerpunkte, diesen zu beschreiben: Einmal konzentriert er sich mehr auf die Erkenntnis, auf die Erklärung des Selbst, dann wiederum geht es um das Handeln, ohne selbst einen Nutzen davon zu haben, dann geht es um Liebe und Hingabe und immer wieder auch um die Versenkung, das Erreichen des Einheitszustandes in der Meditation.
Kṛṣṇa (Sanskrit kṛṣṇa, maskulin) bedeutet im ursprünglichen Wortsinn „schwarz“. Arjuna heißt eigentlich weiß. Schwarz ist konstant. Als Farbe kann man da nichts mehr auftragen. Es wird schwarz bleiben, so wie das Göttliche – Kṛṣṇa als der Avatar des einen Gottes Viṣṇu – ewig ist und ewig bleibt. Arjuna hingegen ist ein weißes Blatt, das von Kṛṣṇa beschrieben wird, um seine Weisheit und die Wahrheit über die Welt weiterzugeben.
Die Gita beschreibt also mehrere mögliche Wege und bietet daher seit 2000 Jahren Yogis (Sanskrit yogī, männlich, und yoginī, weiblich; ich verwende den Überbegriff Yogi für beides zusammen: yogī und yoginī) aller Traditionen, immer das aus der Gita zu zitieren, was ihre Behauptungen untermauert. Auch Arjuna ist verwirrt. Er möchte von Kṛṣṇa eine klare Empfehlung: „Soll ich kämpfen oder nicht?“ Das möchte er wissen. Am Anfang von Kapitel 3 fragt er daher Kṛṣṇa direkt: „Warum drängst du mich, in den Krieg zu ziehen, wenn doch die Erkenntnis (jñāna) besser ist als das Tun (karma)? Deine Worte sind widersprüchlich und verwirren mich!“ Damit spricht Arjuna wohl die Worte aus, die sich viele Leser der Gita auch gedacht haben. Die Antwort von Kṛṣṇa ist im Vers 8 zusammengefasst: „Erfülle deine vorgeschriebene Pflicht, denn es ist besser zu handeln, als untätig zu sein. Ohne Arbeit kann ein Mensch seinen physischen Körper nicht erhalten.“ Arjuna ist Krieger, ein General. Sein Handwerk ist der Kampf. Und wenn er dieses Handwerk „selbstlos und für das Wohl anderer“ ausführt, erfüllt er den Willen Gottes, oder anders formuliert, erfüllt er sein wahres Selbst. Arjuna weiß, dass er im Recht ist. Und er muss kämpfen, damit sein Volk wieder sein Land erhält, um dort in Frieden leben zu können. Wie Arjuna zu dieser Erkenntnis kommt, wie er also zu seinem Selbst findet, ist gleich. ABER durch sein Dharma als Krieger und Prinz erfüllt er sein Karma, indem er in den Kampf zieht. Der Weg des Handelns ist für ihn naturgemäß viel leichter als der Weg des Wissens (jñāna) oder der Hingabe (bhakti). In dem Kapitel beschreibt Kṛṣṇa weiter, dass man die Götter auch durch Opfergaben friedlich stimmen kann. Damit meint er den Verzicht auf die Belohnungen des Selbst. Opfern heißt etwas herzugeben, was einem lieb ist. Lieb ist einem das, woran man anhaftet, woran man festhält. Und solange man dieses Etwas festhält, hält man gleichzeitig an seinem Ich fest. Im Kapitel 2, Vers 47, heißt es:
Du hast das Recht, deine vorgeschriebene Pflicht zu erfüllen, aber du hast keinen Anspruch auf die Früchte des Handelns. Halte dich niemals für die Ursache der Ergebnisse deiner Tätigkeiten, und hafte niemals daran, deine Pflicht nicht zu erfüllen.
Damit meint Kṛṣṇa, dass Arjuna handeln soll, kämpfen soll, aber er soll nicht erwarten zu siegen. „Tu etwas, ohne an das Ergebnis zu denken!“, ist ein wichtiger Grundsatz des Yoga. Ein chinesischer Spruch besagt: „Sorge dich nicht um die Ernte, nur um das sorgfältige Bestellen der Felder.“ Da sind so viele Faktoren, die bestimmen, ob unser Unterfangen gelingt, ob Arjuna siegt, ob das Feld Früchte trägt, Faktoren, die wir nicht im Griff haben. Wir kümmern uns um das, was wir im Griff haben, Dharma und Karma, und handeln aus unserem Selbst heraus, das Ich mit seinen weltlichen Bedürfnissen soweit wie möglich ausklammernd. Dann wird es egal sein, ob das Unterfangen gelungen ist, ob Arjuna gesiegt hat, ob das Feld Früchte trägt, weil Arjuna sein Karma erfüllt hat. „Schicksal“ würde man dann sagen, sich umdrehen und weiterarbeiten, weiterkämpfen, das Feld von Neuem bestellen. Wir sollen uns nicht mit dem Ergebnis identifizieren. Das ist auch eine Opfergabe, ein Opfer. Lass los und verzichte auf Erfolg oder Misserfolg!
Ein einfaches Beispiel kann ich Ihnen auch aus meinem Yoga-Unterricht berichten. Ich sehe oft, wie Übende sich gegenseitig ansehen, bewundernd, weil jemand etwas so schön oder so gut kann. Ich sage dann immer: „Yoga ist nicht olympisch!“ Yoga ist kein Wettkampf, sondern ein Weg zu meinem Selbst, also zu MEINEM Selbst ...!
Karma-Yoga ist das, was Kṛṣṇa Arjuna empfiehlt: „Sei voll in der Tat, aus vollem Herzen, egal, wie es ausgeht! Du kämpfst für die anderen. Der Kampf ist notwendig!“ Mahatma Gandhi hat gekämpft, indem er nicht gekämpft hat. Nicht-Handeln ist auch eine Form der Handlung, des Karmas.
Gandhi, auf die Frage, ob er sein Leben in „25 Worten zusammenfassen könnte“, antwortete: „Das kann ich in drei!“ und zitierte die Isha-Upanischad (Sanskrit īśopaniṣad): „Verzichte und genieße!“ Man soll auf die Früchte des Erfolgs verzichten, wie oben geschrieben. Die „gute Tat“, das Handeln für die anderen, und mit sich im Reinen zu sein ist Genuss pur! Wer nicht anhaftet an Materiellem, an Erfolgen, wer sich frei machen kann von seinen Gelüsten, der Gier und dem zwanghaften „Durch-das-Leben-Rennen“, kann erst wirklich genießen. Und dann braucht es für den Genuss nicht viel: einen Sonnenuntergang, die Sterne am Himmel, in Ruhe dasitzen und atmen, ein einfaches Essen, mit freiem Kopf schlafen gehen, die Blumen gießen, mit dem Hund spazieren gehen, Yoga machen. Wenn man frei wird von der Getriebenheit des weltlichen Seins im westlichen Schein, machen die drei Worte Gandhis Sinn und keine Angst: „Verzichte und genieße!“ Das ist für mich die Kernaussage der Bhagavad Gita.
Ich erlebe in den letzten Jahren eine Umorientierung vieler Menschen, vor allem der jüngeren Generation. Viele wollen nicht mehr bloß einen Job, mit dem sie gut Geld verdienen und sich ein schönes Leben leisten können. Vielen ist es wichtig, durch ihre Arbeit etwas Gutes in der Welt zu bewegen. Viele wollen mit ihrer täglichen Tätigkeit anderen helfen und dabei auch noch nachhaltig sein. „Nachhaltigkeit“ ist einerseits ein neues Modewort, um Produkte besser verkaufen zu können, andererseits drückt es den Zeitgeist sehr gut aus: Nachhaltig bedeutet, Dinge zu tun oder zu produzieren, die unserer Welt guttun und die verhindern sollen, dass wir unseren Planeten in nächster Zeit unbewohnbar machen. Viele Menschen wachen bereits auf und nehmen den gedankenlosen Konsumismus, dem wir hier im Westen frönen können, nicht mehr einfach so hin. Unser Luxus in der westlichen Welt hat einen Preis, den Menschen in armen Ländern mit ihrer Arbeit und ihrem Leben bezahlen. Der Aufbau der Wirtschaft verliert seine Blindheit, einfach nur zu wachsen, und steuert durch viele Einzelpersönlichkeiten wie Greta Thunberg und andere Umweltaktivisten der jüngsten Generation hoffentlich in eine gute Zukunft. Viele Menschen sind sich mittlerweile des Zusammenhanges zwischen ihrem persönlichen gedankenlosen Konsum und dem Zustand unserer Welt bewusst. Wie viel braucht man denn wirklich, um glücklich zu sein?! Welche Bedürfnisse müssen gestillt sein, damit wir uns gut und zufrieden fühlen? Wir müssen lernen zu unterscheiden, zwischen wahren Bedürfnissen und unstillbaren Begierden. Letztere werden immer „Mehr! Mehr!“ in unserem Kopf brüllen, erstere sind überschaubar: Gemeinschaft, Frieden, Selbstbestimmung, Freiheit von Leid. Bedürfnisse, die alle Menschen und Tiere auf dieser Welt verdient haben, befriedigen zu können!
Die Gemeinschaft der Menschen ist ein ganz wichtiger Punkt, welchen wir zunehmend durch die „Vereinzelung“ verlieren. Immer mehr Menschen leben alleine, von ihren Familien getrennt, und doch suchen sie die Nähe zu anderen Menschen, um sich als Mensch fühlen zu können. Konsumismus ist Ablenkung von der Vereinzelung. Internet und Smartphone sind auch nichts anderes als der Ausdruck, zusammen sein zu wollen, dazugehören zu wollen. Gerade das Internet als ein weltweitumspannendes System drückt den Wunsch der Zusammengehörigkeit aus. Konsum durch elektronische Hilfsmittel ist oft notwendig, um keine seelische oder physische Einsamkeit zu erleben.
Wie viel Luxus braucht ein Mahl, wenn es in der Gemeinschaft mit lieben Freunden und der Familie eingenommen wird?
Wie viele Urlaube brauche ich, wenn ich nicht mehr getrieben bin von meiner Arbeit zu Hause und mich im Urlaub nicht mehr vor dieser verstecken muss?
Menschen wollen das Gefühl haben, dass alles zusammengehört. Das entspricht unserer Natur, das entspricht dem Selbst. Wir ziehen alle an einem Strang und am Ende des Strangs hängt unsere Welt. Es liegt an uns, sie vor den drohenden Gefahren der Umweltverschmutzung und des Klimawandels zu bewahren.
Wir sehen jetzt gerade in der Corona-Krise, wie sehr Menschen zusammenrücken und für andere da sind, auch wenn sie physisch keinen Kontakt haben dürfen. Im Moment macht uns diese Krise bewusst, was wir in den letzten Jahren an körperlichem und psychischem Ballast angehäuft haben, den wir eigentlich gar nicht brauchen. Auf einmal haben viele Menschen so viel Zeit für sich wie nie zuvor, Zeit, um über Sinn und Irrwege des eigenen Lebens nachzudenken. Vielleicht braucht es für viele diesen einen Anstoß, um den Yoga der Tat oder den Yoga des Wissens zu praktizieren. Vielleicht hilft die Meditation, um das eigene Dharma zu erkennen und zu verstehen, welche Taten als nächste notwendig sind. Die Gita ist für Sie da, universell und für jeden verfügbar.
Es gibt ein berühmtes Foto von den Habseligkeiten Mahatma Gandhis, nachdem er gestorben war. ER, die große Seele Indiens, der sein Land gewaltlos von der britischen Herrschaft befreite, hinterließ seinen schlichten weißen Baumwollumhang, seine Brille, seine Sandalen und sein abgegriffenes Exemplar der Bhagavad Gita. In diesem Buch hatte er täglich gelesen, eine, wie er sagte, für ihn unendliche Quelle der Inspiration. Doch natürlich hat er viel mehr hinterlassen, etwas, das durch keinen Reichtum darstellbar und durch kein Gold aufzuwiegen ist. Und sein Geist wird ewig wirken, als Vorbild und Inspiration für kommende Herausforderungen ...
Zwei Stellen möchte ich noch zitieren, um das Bild der Gita abzurunden. Diese sollen in Ihnen nachklingen … Hier zitiere ich aus „Bhagavad-Gita wie sie ist“ von A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, übersetzt aus dem Englischen von Vedavyasa dasa adhikarī, Śacinandana dāsa brahmacārī, Prthu dāsa adhikārī, 1974):
Wer nicht neidisch ist, sondern allen Lebewesen ein gütiger Freund, wer sich nicht für einen Besitzer hält, wer frei ist von falschem Ego und in Glück und Leid gleichmütig bleibt, wer immer zufrieden und mit Entschlossenheit im hingebungsvollen Dienst tätig ist und wessen Geist und Intelligenz mit Mir in Einklang stehen – er ist Mir sehr lieb.
Kapitel 12, Vers 13–14)
Hier zitiere ich aus Eknath Easwarans Übersetzung:
Jemand, der frei ist von selbstsüchtigen Anhaftungen, der sich selbst und seine Leidenschaften gemeistert hat, erlangt die höchste Vollendung der Freiheit vom Handeln. Hör zu und ich werde dir jetzt erklären, Arjuna, wie jemand, der Vollendung erlangt hat, auch Brahman erlangt, das höchste Ziel der Weisheit.
(Kapitel 18, Vers 49–50)