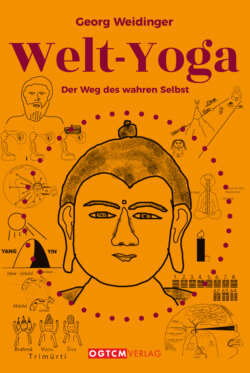Читать книгу Welt-Yoga - Georg Weidinger - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеVeden und Upanischaden
वेद उपनिषद्
Etwa 2000 Jahre vor Christus wanderte eine Volksgruppe, die Vedisch sprach und sich selbst als arya, also „edel“, bezeichnete, in den Nordwesten des indischen Subkontinentes, zunächst in das Tal des Indus und später des Ganges, ein. Vedisch war eine indogermanische Sprache und ein Vorgänger des Sanskrit. Die Arya („Arier“) trafen dort auf die Überreste der Harappa-Kultur, der Indus-Kultur, welche sich entlang des Flusses Indus entwickelt hatte. Dies war ein fast tausendjähriges Volk, welches regen Handel trieb und kulturell hoch entwickelt war. Aus der Verschmelzung dieser beiden Völker, den Ariern und den Indus, entstanden die Inder. Die Arier brachten ihre Götter und ihre Religion mit, welche geprägt war von Opferritualen und beschwörenden Gesängen, welche in einer Frühform des Sanskrit, der heiligen Sprache Indiens, verfasst waren. Diese Hymnen entstanden etwa 1500 vor Christus, und zeigen die Verbundenheit der Kultur mit der Natur und ihren Kräften. So wurde den elementaren Urgewalten der Natur Götter, Devas, zugewiesen. Agni ist das Feuer an sich, welches die Opfergaben verzehrt und dem Gott darbringt, und der Gott des Feuers selbst. Indra ist das Unwetter und der Gott des Krieges und des Donners, Vāyu ist der Wind und der Gott des Windes, Ratri ist die Nacht, Usha die Morgendämmerung, Sūrya die Sonne. Savitri ist der Gott, der Leben erschafft, und Yama ist der Tod. Yama war der erste Mensch, der gestorben ist und in die Unterwelt gelangte. Er wurde zum Gott des Todes.
Die Götter waren freundlich und den Menschen gewogen. Doch all die Götter sind nur Bilder des Einen, Erscheinungsformen der Natur des einzigen Höchsten Wesens. Hinter all den unzähligen indischen Gottheiten steckt bis heute der Eine, die Wahrheit, Brahman (Sanskrit brahman, neutral). Jeder kann sich seinen Gott so vorstellen, wie er will, so benennen, wie er möchte. Bis heute.
Die Hymnen waren poetisch verfasst. Sie wurden von den Brahmanen, den Priestern, vorgetragen und dazu wurden Rituale und Opferungen vollführt. Priester verfassten Kommentare zu den Riten, damit ihre Funktion nicht in Vergessenheit geraten sollte. Hymnen und Kommentare wurden auswendig gelernt und mündlich von Generation zu Generation weitergegeben. Das sind die Veden, Indiens heilige Schriften. Veda kommt von dem Wort vid für „wissen“. Doch die Veden sind nicht einfach „schöne poetische“ Texte. Sie sind Śruti, Wissen, das den Weisen offenbart worden ist. Die Veden haben keinen Anfang und kein Ende, sie sind lose Texte, in vier Sammlungen zusammengefasst: Rig, Sāma, Yajur und Atharva, wobei der Rig-Veda die älteste Sammlung ist. Die Entstehung seiner Hymnen dürfte bis ins 15. Jahrhundert vor Christus reichen, sodass wir hier einen der ältesten religiösen Texte der Menschheit vor uns haben. Jeder Veda besteht aus zwei Teilen: Der erste Teil befasst sich mit Ritualen und der Ausübung der Religion, der zweite Teil hebt sich deutlich vom ersten ab. Er hat meist nicht einmal Angelpunkte zum ersten Teil. Der zweite Teil sind die Upanischaden (Sanskrit upaniṣad). Sie werden auch als Vedānta, als „Ende des Veda“ bezeichnet, zumal sie als letzte Texte in den Kanon des Veda aufgenommen worden sind. Sie erzählen Geschichten, in denen erlebtes und erfahrenes Wissen weitergegeben wird. Man kann also nicht von einer Philosophie sprechen, die sich theoretisch mit einem Thema befasst. Die Upanischaden beschreiben, was die Weisen, die Brahmanen, über Jahrtausende entdeckt haben, während sie auf der Suche nach Wahrheit in sich hineinblickten. Das, was man da tief in sich drinnen findet, ist nicht leicht zu verstehen und bedarf viel Mühe, Zeit und Arbeit an sich selber. Upaniṣad bedeutet „sich nahe hinsetzen“. Damit wird die Situation angesprochen, dass sich Schüler zu Füßen eines erleuchteten Meisters, eines Weisen, hinsetzen und ihre Unterweisung erhalten. Damals wie heute ist das so in Indien, und meist lebt und lehrt der Meister von der Welt zurückgezogen in einem Ashram (von Sanskrit āśrama, maskulin, „Ort der spirituellen Praxis“), einer „Waldschule“, wie in einer großen Familie, mit eigener Familie und Schülern. So lernt der Schüler nicht nur anhand der Schriften, sondern auch anhand des Lebens, das ihnen ihr Meister vorlebt. Solche Szenarien sind es auch, die in den Upanischaden beschrieben werden. Dabei sind die Weisen in den Erzählungen oft Frauen und unter den Unterwiesenen sind auch Könige. Die Upanischaden sind nicht als Unterweisung gedacht, sondern vielmehr als Inspiration. Sie bilden auch kein durchgehendes Lehrgerüst, sondern stehen jede für sich alleine da. Sie wollen Momente der Erleuchtung festhalten, Momente, in denen der Meister es auf den Punkt bringt. Und dabei geht es um die Innenschau, das Richten des Blickes nach innen, um dort alle großen Fragen des Lebens und des Todes beantwortet zu finden.
Shankara (Sanskrit śankara), ein bedeutender Mystiker des 8. Jahrhunderts, hat zehn der Upanischaden zu den „Hauptupanischaden“ gemacht.
Die Upanischaden sind zwar in den Kontext der Veden, welche sich um die Religionsausübung und deren Rituale kümmern, eingepackt, brauchen diese aber nicht. Die Upanischaden sprechen nicht von Religion, sondern von jener Kraft, die das Universum und alles erschuf. Diese Kraft ist alles, was für immer besteht und sich weder in Zeit noch Raum verändert. Diese Kraft ist Brahman, die auch als höchste Göttlichkeit übersetzt werden kann, und ist jener Teil in uns, der ewig währt und nicht von Leben oder Tod beeinflusst wird. Die Upanischaden nennen den göttlichen Grund in uns einfach Ātman, „das Selbst“. Nur wenn ich als Mensch es schaffe, mein Selbst in mir zu finden, indem ich mein „Ich“ abstreife, kann ich mich mit allem verbinden und erkennen, dass ich nicht einfach Körper bin, sondern viel mehr, dass ich unsterblich bin ... Sie merken schon an der Dichte dieser Aussagen, dass sich dieses Wissen nicht einfach geistig erfassen lässt. Wie soll man Dinge beschreiben, für die es keine Worte gibt, Dinge jenseits der Worte, jenseits von Raum und Zeit? Die Upanischaden verraten Geheimnisse, die uns alle betreffen, alle Lebewesen dieser Welt. Doch dieses Wissen erschließt sich nur wenigen. Und von diesen wenigen finden nur ganz wenige den Weg, sich mit dem großen „Weltgeist“, wie ihn Hermann Hesse in seinem Gedicht „Stufen“ beschreibt, dem Alles, zu vereinen und über diese Einheit die Grenzen von Leben und Tod zu überwinden. Die Belohnung dieses jahrelangen Bemühens ist, dass man die Angst vor dem Tod verliert und dass man in sich die Unendlichkeit, das Alles, die Kraft des Universums, das Göttliche erlebt. Nicht das geistige Erfassen, das „Verstehen“, ist unser Ziel. Sondern das Erfahren. Darum der Yoga-Weg, der das Geheimwissen der Upanischaden, welches sich ursprünglich nur einzelnen Auserwählten eröffnet hat, für all jene erschließt, die willens sind, den Weg zu gehen.
Ich möchte Ihnen dieses große Wissen, welches die Upanischaden der gesamten Menschheit schenken, direkt an einer Upanischade nahebringen, der Katha-Upanischad. Sie ist eine der jüngeren Upanischaden und fasst Weisheiten vorheriger Hymnen wunderbar zusammen. Auch hat die Katha-Upanischad einige Gemeinsamkeiten mit einem weiteren Werk der Weisheit der indischen Geschichte, der Bhagavad Gita: Beide erzählen die Geschichte eines „Helden“ auf der Suche nach Weisheit. Beide finden an einem Ort statt, wo man Weisheit wohl kaum vermuten würde: In der Katha-Upanischad geht ein Teenager zum König des Todes, um das Geheimnis der Unsterblichkeit zu erfragen, in der Bhagavad Gita bittet der Krieger und Prinz Arjuna am Abend vor einer großen Schlacht direkt am Schlachtfeld seinen unsterblichen Lehrer Sri Kṛṣṇa um Rat. Wir identifizieren uns automatisch mit dem Helden, leiden mit ihm mit, wollen seine Fragen beantwortet wissen. Und so sind Geschichten der Weisheit in spannende Erzählungen verpackt und halten den Leser und den Studierenden bei Laune.