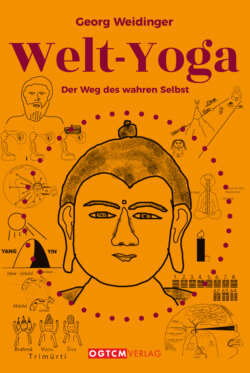Читать книгу Welt-Yoga - Georg Weidinger - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Meditation in der Gita
ОглавлениеIn Kapitel 6 erklärt Kṛṣṇa die Meditationstechnik für Laien, viel einfacher, als es zum Beispiel Patañjali im Yogasūtra macht, ohne Heimlichtuerei, ohne Schnickschnack.
Das Kapitel zeigt, was Yoga ist. Yoga meint die „Integration der Seele“, das „Einswerden mit dem Selbst“. Oft wird Yoga mit „Rāja-Yoga“, der Meditationspraxis, gleichgesetzt, wie es Patañjali lehrt. Die Meditation ist das direkte Mittel, um diesen Einheitszustand mit seinem Selbst zu erlangen. Somit sind Yogi Spezialisten für Meditation.
Und das Kapitel erklärt, wer ein wahrer Yogi ist. Dabei geht es hier nicht um körperliche Kunststücke wie das Sitzen auf einem Nagelbrett oder stundenlanges Verharren in den unmöglichsten Körperverrenkungen, nicht einmal um einen Schwerpunkt in Körperübungen, den Āsanas (āsana, neutral, wörtlich „Sitz“, Körperübungen im Yoga, vor allem im Hatha-Yoga), wie wir das im Westen kennen. Yogi bedeutet wörtlich: „Jemand, der im Yoga vollendet ist.“ Hier wird erklärt, dass Yogi Menschen sind wie du und ich, die ihrer normalen Tätigkeit nachkommen, aber nicht anhaften am Resultat ihres Wirkens (Vers 2). Tu etwas, ohne etwas zu erwarten. Nur so bist du bei der Sache. Und egal, was rauskommt, warst du am Weg dorthin bei dir. Darum geht es. Erinnern Sie sich an den chinesischen Spruch: „Kümmere dich nicht um die Ernte, sondern um das sorgfältige Bestellen der Felder.“ Es bringt nichts, wenn der Bauer immer wieder zum Feld fährt und ständig an den Junghalmen zieht, damit der Weizen schneller wächst. Er reißt ihn höchstens aus. Es bringt nichts, wenn der Bauer ständig zum Himmel sieht, ob es eh bald regnet, ob es eh nicht hagelt, ob es eh keinen schlimmen Sturm gibt. Der Bauer wäre ständig in Angst und getrieben und hätte ein furchtbares Leben. Die Basis dafür, dass man arbeiten kann und sich dafür keinen Lohn erwartet, sich keinen Erfolg erhofft und keine lobenden Worte, keine Medaille, die einem am Ende des Tages umgehängt wird, keinen Blechpokal für das staubanziehende Wohnzimmerregal, die Basis dafür, dass man ohne Angst durch das Leben geht und dabei lächeln kann, weil man dieses Gehen genießt, ist Shraddha (śhraddhā, ṣraddhā, feminin), das Vertrauen.
Kṛṣṇa erklärt weiter:
Für Strebende, die den Berg spirituellen Gewahrseins erklimmen wollen, ist der Pfad selbstloses Wirken; für jene, die zum Yoga aufgestiegen sind, ist der Pfad Stille und Friede.
(Vers 3)
Denken Sie beim ersten Teil dieses Verses, dem Weg des Handelns, an Karma-Yoga und Mahatma Gandhi. Die Taten, die man setzt, sollen meinem Dharma entsprechen und selbstlos sein. Die Taten, die Summe meiner täglichen Arbeit, sollen für andere, für die Gemeinschaft sein, und frei von Erwartungen. Ist dieses Ziel erreicht, suche man Frieden und Stille in der Meditation. Das muss natürlich nicht hintereinander stattfinden. Das eine unterstützt das andere.
Der spirituelle Weg ist am Anfang steinig und bedarf einiger Willenskraft.
Gestalte dich mittels der Kraft deines Willens um; lass dich nie durch Eigenwillen herabwürdigen. Der Wille ist der einzige Freund des Selbst und der Wille ist der einzige Feind des Selbst.
(Vers 5)
Der spirituelle Weg erfordert Selbstdisziplin und Durchhaltevermögen. Wer zu meditieren beginnt, weiß das. Anfangs tut einem oft der ganze Körper vom Sitzen weh. Daher ist es ja so clever, die Körperübungen des Yoga, die Āsanas, regelmäßig zu machen, um irgendwann gut und entspannt sitzen zu können. Daher ist es auch immer wieder wichtig, sich daran zu erinnern, dass man nichts erwartet. Disziplin und tägliches Üben und nicht viel darüber nachdenken, darum geht es.
Die höchste Wirklichkeit steht enthüllt im Bewusstsein jener, die sich selbst bezwungen haben. Sie leben in Frieden, unverändert gleich in Kälte und Hitze, Lust und Schmerz, Lob und Tadel.
(Vers 7)
Wahre Yogis sind nicht böse und nicht im Zorn. Sie sind Samabuddhi, ausgeglichen im Geist. Sie begegnen anderen ausgeglichen und ruhig, unparteiisch und mitfühlend, empathisch würde man heute sagen. „Selbst bezwungen“ meint selbstbeherrscht, sich selbst, die eigenen Gefühle, Triebe, das eigene Denken und Handeln unter Kontrolle des puren Ich, auf jener Ich-Stufe, wo die Sinne und der Geist schon zur Ruhe gekommen sind, idealerweise unter der Kontrolle des Selbst.
Und dann gibt Kṛṣṇa klare Anweisungen für die Praxis der Meditation, ohne Geheimnisse und Rituale, wie es im Hinduismus gelegentlich auftritt.
Kṛṣṇa gibt eine Anweisung: Suche dir, Arjuna, einen sauberen und bequemen Platz, richte diesen gemütlich und weich aus (mit Kushagras und Hirschfell). Dann setze dich hin. Bringe deine Gedanken zum Stillstand. Richte deinen Geist auf Eins aus. Dein Herz wird frei.
(Vers 11)
Meditation bedeutet, den Geist auf eine Sache auszurichten, eine Vorstellung, einen Gedanken, auf das Selbst (erinnern Sie sich an unsere Übung mit der Vorstellung des Selbst, welches am Sessel sitzt ...). Dann geht Kṛṣṇa ganz einfach auf den Körper ein:
Halte deinen Rumpf, Kopf und Nacken in einer geraden Linie fest aufrecht, halte deine Augen davon ab, herumzuschweifen.
(Vers 13)
Die aufrechte Position während des Sitzens ist notwendig, um wach zu bleiben, um nicht einzuschlafen. Dabei kann man sich einen Faden vorstellen, der am höchsten Punkt des Kopfes festgemacht ist und den ganzen Körper in gerader Position aufrichtet. Dieser höchste Punkt ist Brahmarandhra oder chinesisch Bai Hui. Die Augen sollen offen bleiben, am besten „halb offen“, am besten gesenkt. Suchen Sie sich äußerlich einen Punkt und ruhen Sie in diesem oder fixieren Sie innerlich ein Bild.
Und dann löse alle Ängste im Frieden des Selbst auf und weihe alle deine Handlungen Brahman, kontrolliere den Geist und richte ihn auf Brahman aus. Sitze in Meditation mit mir als deinem einzigen Ziel.
(Vers 14)
Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, kann das Mantra „Om“ als Synonym für Brahman als Ausrichtung, als „innerer Gesang“, verwendet werden.
Nun beschreibt Kṛṣṇa den „mittleren“ Weg, den man im Leben einschlagen soll, um erfolgreich meditieren zu können:
Arjuna, nicht zu viel essen oder zu wenig essen, nicht zu viel schlafen oder zu wenig schlafen, dann wird die Meditation gelingen. All jene, die im Essen und Schlafen, in der Arbeit und Erholung maßvoll sind, gelangen durch die Meditation zum Ende des Leids.
(Vers 16–18)
Der Weg, den Kṛṣṇa vorschlägt, ist für uns alltagstauglich, oder?! Nicht übertreiben! Maß halten! Übung und Disziplin! Dranbleiben! Und auch sonst im Leben nicht übertreiben! Schafft man es, nicht an Weltlichem, an Gefühlen, an Zielen anzuhaften, verschwindet auch das Leid. Das Selbst leidet nicht, nur das gierige und neidische und selbstsüchtige Ich ...
Den Vereinigungszustand erreicht man, wenn man sich ständig bemüht und lernt, den Geist von selbstsüchtigen Gelüsten zurückzuziehen und ihn im Selbst zu verankern.
(Vers 18)
Wir sind alle nicht als Meister geboren. Wir sollen uns ständig bemühen, aber nichts erwarten, und alles mit Maß und Ziel tun, im Körper und im Geist ausgeglichen sein und unser Handeln im Alltag auf andere Menschen ausrichten.
Im Vers 19 entwirft Kṛṣṇa das berühmte Bild, dass der Geist wie eine flackernde Flamme im Sturm ist. Dieses Bild wird bis heute gerne als Konzentrationsvorstellung in der Meditation benützt. Man sieht mit dem inneren Auge die flackernde Flamme, die dem unruhigen Geist entspricht, zum Beispiel im Herzraum und beobachtet nun im Geiste, wie die Flamme zur Ruhe kommt und schließlich ganz ruhig auf dem Docht dasteht. Gelingt dies, wurde der Geist mittels des Willens zur Ruhe gebracht.
Als Vorübung kann man auch eine brennende Kerze vor sich hinstellen, diese im Geiste genau beschreiben (dunkleres Zentrum auf dem Docht, hellere Corona rundherum, vibrierende Luft über der Flamme, das Flammenflackern, wenn man ausatmet, das Beruhigen der Flamme, wenn man nur noch ganz sanft ausatmet, ...) und das Bild der Flamme in sich, in den Herzraum, aufnehmen, mit dem Objekt der Betrachtung verschmelzen und „Flamme sein“.
Arjuna wirft ein: „Mein Geist ist aber so ruhelos! Ich schaffe das nicht!“ Kṛṣṇa gibt zu, dass es wirklich schwierig sei, den Geist zur Ruhe zu bringen. Aber mit regelmäßiger (täglicher) Übung werde es gelingen, sofern man auch an seiner Losgelöstheit von weltlichen Anhaftungen arbeite. Nun stellt Arjuna noch eine sehr spannende Frage:
Was passiert eigentlich mit denen, die zwar den Glauben haben, denen aber die Selbstbeherrschung fehlt und vom Weg abkommen?
(Vers 37)
Und hier gibt Kṛṣṇa eine sehr beruhigende Antwort:
Arjuna, mein Sohn, solch ein Mensch wird nicht zuschanden kommen. Keiner, der Gutes tut, wird je ein böses Ende nehmen, weder hier noch in der künftigen Welt.
(Vers 40)
Er führt es auch noch genauer aus: Man wird dann zwar wiedergeboren, was aber rein und wohltuend ist. Zum Beispiel wird dann in der Familie meditiert und man bekommt einfach noch eine Möglichkeit, das alles zu meistern.
Die Verse 46–48 schließen das Kapitel mit klaren Worten ab (Übersetzung von Eknath Easwaran):
Meditation ist strenger Askese und dem Pfad des Wissens überlegen. Ebenso ist sie selbstlosem Dienst überlegen. Mögest du das Ziel der Meditation erreichen, Arjuna! Auch unter jenen, die meditieren, ist diejenige Person, die mich, gänzlich in mich versenkt, mit vollkommenem Glauben verehrt, die am festesten im Yoga gegründete.