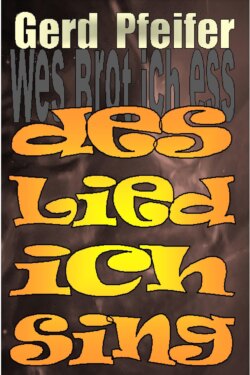Читать книгу ...des Lied ich sing' - Gerd Pfeifer - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der alte Mann am Frühstückstisch
Оглавлениеfaltet das lokale Tageblatt zusammen und hängt noch eine Weile seinen Gedanken an die Vergangenheit nach. Es war ein weiter Weg bis in dieses Haus – am Rande der Stadt, im vornehmsten Viertel und mit direktem Zugang zum Schlosspark. Der Weg hat ihn sein Leben gekostet.
Er lächelt schief, wenn er solche Plattitüden denkt.
Die Peters hat ihm gesagt, dass kaum jemand das selbstironische Aufblitzen seiner Augen in solchen Augenblicken als Spott erkennt. Sein Grinsen halten Fremde für Selbstgefälligkeit. Ihm ist es einerlei.
Inzwischen sind die Momente vorbehaltlosen Vertrauens, in denen die Peters derartige Intimitäten zum Besten gibt, längst Vergangenheit. Ohnehin waren sie selten genug, und darüber hinaus war es eine seltsame Beziehung, die sie miteinander pflegten. Er wundert sich immer noch, dass sie so lange andauerte. Und mehr noch erstaunt ihn, dass sie derart friedlich zu Ende ging.
Er nimmt die großformatige überregionale Zeitung, erhebt sich ein wenig mühsam und geht schlurfend fast und langsam zurück ins Arbeitszimmer. Es ist Zeit für ein paar Telefongespräche. Vorsorglich räuspert er sich. Während der letzten Jahre ist seine Stimme greisenhaft geworden. Sie erreicht die ursprüngliche Tiefe nicht mehr und ist brüchig. Er kann sich nur schlecht daran gewöhnen. Es ist ein Zeichen der Hinfälligkeit, und hin und wieder versagt sie völlig.
Die meisten alten Leute, die er kennt, klagen über chronische Schlaflosigkeit. Sein Schlaf ist tief und fest. Dass er heute schon vor dem Morgengrauen wach geworden ist, bildet eine Ausnahme. Vielleicht hat er zu oft an die bevorstehende Einweihung der nach ihm benannten Straße gedacht. Aber den Gedanken verwirft er. Es wäre beschämend. Solche öffentlichen Auftritte und andere Peinlichkeiten hat er schon öfter erlebt. Er sollte sich daran gewöhnt haben. Lieber will er glauben, dass sein Unterbewusstsein ihn gedrängt habe, die Lektüre des Buchs, das noch auf dem kleinen Tisch neben dem Sessel im Wohnzimmer liegt, zu beenden. Seinen Traum hat er verdrängt.
Eigentlich mag er diese südamerikanischen Autoren nicht, die ihre Alterspotenz und die Kraft des gelben Strahls ins Urinal bewundern. Er glaubt ihnen die unerschöpfliche Libido nicht, mit der sie ihre Leser beeindrucken wollen. Und vor allem hält er den Rang, den sie ihren Trieben zumessen, für völlig überzogen.
Dass er sich überhaupt mit belletristischer Lektüre befasst, ist auch eine Alterserscheinung. Jahrzehntelang hat er, wenn überhaupt, Fachbücher oder Biographien gelesen, und auch das nur mit einem schlechten Gewissen. Im Grunde hielt er das Lesen von Büchern für Zeitverschwendung. Stunden über Stunden damit zu vertun, sich mit nicht existenten Menschen und ihren ausgedachten Erlebnissen, Gedanken und Gefühlen zu befassen, erschien ihm geradezu als Inbegriff der Nutzlosigkeit. Und Reste dieser beinahe lebenslangen Überzeugung haften noch immer seiner Lektüre schöngeistiger Literatur an. Wenn er heute Spaß daran findet, geschieht es im Bewusstsein einer neuen Geisteshaltung - - dass er sich nämlich den Luxus erlauben kann, seine Zeit – auch wenn sie wegen seines Alters insgesamt nur noch knapp bemessen ist – unnütz zu vertändeln. Ist es vielleicht die ultimative Dekadenz des Alters, seine verbleibende Zeit hemmungslos zu verschleudern?
Wieder überzieht ein schiefes Lächeln sein Gesicht, als er sich vorstellt, was sein Vater zu dergleichen Gedankengängen meinen würde. Und seine Mutter erst!
Unschlüssig hielt sie – nachdem die Errichtung ihres Cafés beschlossene Sache war – Ausschau nach geeigneten Räumlichkeiten für ihren Traum. Als Martha 'mit ihrem ungeborenen Bastard' und einer kleinen Abfindung die Stadt verließ – '...sie war ohnehin nur hinter unserem Geld her, und du hast es nicht einmal bemerkt...' –, kaufte seine Mutter, als ob sie einen neuen Lebensabschnitt beginnen wollte, einen überdimensionalen Hut, der seinem Vater erst einen künstlichen Lachanfall und dann einen echten Wutausbruch abnötigte, um anschließend mit dem Statussymbol auf dem Kopf und einem Silberfuchsfell über der Schulter durch die Straßen Altonas zu schreiten und Mietshäuser mit Gasthausräumen im Erdgeschoss ausfindig zu machen.
Sie suchte länger als zwei Jahre.
Inzwischen hatte Georg die Schule abgeschlossen und half seinem Vater im Schankraum. Er war Stadtjugendmeister seiner Gewichtsklasse im Gewichtheben geworden und hatte einen unbotmäßigen Trunkenbold mit ausgestreckten Armen in das wassergefüllte Spülbecken des kupferbeschlagenen Tresens gesetzt, als der sich den Anweisungen seines Vaters provokant widersetzte. Seither war 'der Junge' eine Respektsperson hinter dem Tresen geworden. Er sagte nicht viel, zapfte ruhig die bestellten Biere, goss die Schnapsgläser voll 'bis über den Strich' und rechnete fair ab. Er war bald beliebter als sein Vater.
Aber es zog ihn hinaus in die große weite Welt.
Für ihn war das Berlin. Durch Vermittlung der Brauerei, die seinem Vater das Bier lieferte, erhielt er eine Anstellung als Kellner in einer Bierschwemme in Neukölln. Er war anstellig, wusste mit den Gästen umzugehen und tat sich eigentlich nur durch seine Unauffälligkeit hervor. Während der ersten Monate seines Aufenthalts in Berlin wurde er gelegentlich wegen des norddeutschen Tonfalls von seinen Kollegen gehänselt. Er trug es mit lächelndem Großmut. Erst als sein schlaksiger Intimfeind – niemand wusste, warum die beiden sich nicht mochten, auch sie selbst nicht –, ein hagerer Gastwirtssohn aus Moabit, es zu weit trieb, zeigte er eines Nachts auf dem Heimweg zu seiner möblierten Mansarde, die heimlich von seiner Mutter bezahlt wurde, dass er dem hinterhältigen Raufbold aus dem damaligen Arbeiterviertel körperlich überlegen war. Er verprügelte nicht nur den dürren Otto, sondern seine Freunde gleich mit.
Seine Heldentat sprach sich schnell unter den Kollegen und bei den Bedienerinnen herum, die traditionell im Rang und in der Bezahlung noch unter einem Hilfs-Commis standen. Es war daher kein Wunder, dass manche von ihnen ihren Lohn mit Dienstleistungen aufbesserten, die sie nach Dienstschluss dem einen oder anderen wohlhabenderen Gast erbrachten. Das war zwar strikt untersagt und führte bei Entdeckung zu fristloser Entlassung; aber solange sich der bevorzugte Gast nicht beschwerte und Denunziationen unter den Servicekräften verpönt waren, bemühten sich bestenfalls die Sängerinnen der Heilsarmee, die allabendlich ihre frommen Lieder zum Besten gaben und die Sammelbüchsen kreisen ließen, um die aus ihrem eigentlichen Beruf gefallenen Mädchen.
Die Sache hatte für manche der männlichen Kollegen auch noch einen anderen Aspekt. Sie ließen sich ihr Schweigen bezahlen. In Geld oder schnellem Sex zwischen überquellenden Mülltonnen und leeren Bierfässer. Für Georg, dessen beherzte Mutter den väterlichen Ausschank sauber gehalten hatte, wie sie sich ausdrückte, waren das neue Erfahrungen. Und unerwartete. Es lief seiner Natur zuwider, Unkenntnis durch naive Fragen zu offenbaren. Er beobachtete, zog Schlüsse und glaubte nach einiger Zeit, die Umstände zu kennen. Dennoch war er überrascht, als Hilde, eine der kecken Bedienerinnen, ihn eines späten Abends um seine Begleitung durch die dunkle Nacht bat. Sie kam ohne Umschweife zur Sache, und die Selbstverständlichkeit, mit der sie ihr Anliegen vorbrachte, machte ihn unsicher.
"Ich habe gehört, dass du den dürren Otto und seine Freunde allein verprügelt hast", begann sie und in ihrer Stimme schwang unverhohlene Bewunderung, die auch darin zum Ausdruck kam, dass sie sich bemühte, Hochdeutsch mit ihm zu sprechen.
"Nicht direkt verprügelt", verharmloste er die Auseinandersetzung, "ich habe ihnen nur ein wenig die Arme verbogen."
Das entsprach der Wahrheit. Er hatte sie nicht geschlagen, sondern nur seine Körperkraft eingesetzt – allerdings derart intensiv, dass sie während einiger Tage nicht fähig waren, voll beladene Serviertabletts zu tragen.
Sie nickte. Anscheinend hatte sie seine bagatellisierende Reaktion erwartet. So undurchsichtig wie er glaubte war sein Charakter offenbar nicht.
"Du kannst ma helfen, wenn de willst."
Sie schaute ihn von unten herauf abschätzend an und vergaß das Hochdeutsch.
"Und wie?", fragte er, ohne sein Erstaunen zu verbergen. Niemand hatte ihn bisher um Hilfe gebeten.
Wieder nickte sie, wie zur Bestätigung einer vorgefassten Meinung. Und lächelte. Er fühlte sich unbehaglich. Ihm gefiel nicht, dass seine Antworten offenbar ihren Erwartungen entsprachen. Er nahm sich vor, in Zukunft noch weniger von sich preiszugeben.
"Haste letzte Woche mein blaues Auge jesehen?", fragte sie. "Die dickste Schminke hat nich jereicht, et ordentlich abzudecken."
Er hatte nichts bemerkt. Allerdings sah er die Bedienerinnen so genau auch nicht an. Zwar hatte er zu Haus, gleich neben dem Hafen, erste Erfahrungen mit ihresgleichen gesammelt, aber eine Offenbarung, die zur ständigen Wiederholung reizte, war es nicht gewesen. Jedenfalls war ihm Hildes Veilchen verborgen geblieben. Und selbst wenn er es entdeckt hätte, es wäre ihm gleichgültig gewesen.
Also schüttelte er wahrheitsgemäß seinen Kopf.
"Du siehst mich nich richtich an", warf sie ihm vor. Es klang kokett.
Er antwortete nicht. Wenn er zustimmte, wäre sie beleidigt. Und wenn er in diesem Augenblick, gleichsam nach Aufforderung, ihre Nase, ihre Augen oder ihren Mund bewundert hätte – zu weitergehender Beurteilung ihres Körpers hätte er sich nicht hinreißen lassen –, wäre das ein gar zu plumper Versuch gewesen, ihr zu schmeicheln.
Obgleich sie wahrscheinlich nichts anderes erwartete.
Aber er sagte nichts.
"Nun jut", sie nahm sein Schweigen mit Fassung auf und fügte unbekümmert und schamlos – ein anderes Wort für ihr Verhalten konnte er nicht finden – hinzu: "Een Jast, mit dem ick mir einjelassen habe, hat ma eene runterjehauen, weil ick ihn nich lutschen wollte."
Wieder blickte sie gespannt mit schrägem Kopf zu ihm auf. Sie wollte herausfinden, wie er reagierte.
Für einen Augenblick verlor er die Kontrolle über sein Gesicht. Aber er wusste nicht, ob sie es gemerkt hatte. Mehr als Verblüffung und einen gewissen Widerwillen hätte es ohnehin nicht ausdrücken können. Weil sie aber eine Antwort erwartete, fragte er dümmlich:
"Warum wolltest du nicht - - lutschen?"
Sie schüttelte vehement ihren Kopf, dass die Haare flogen, und versuchte, Ekel auszudrücken:
"Nee, nich bei diesen Dreckschwein."
"Und warum hast du ihn überhaupt rangelassen?"
Er wunderte sich über seine Reaktion und stellte mit merkwürdiger Genugtuung fest, dass er sich ihrem sprachlichen Niveau anpasste.
"Er hat jut jezahlt. Schon am Tisch."
Sie zählte weitere Vorzüge des Dreckschweins auf. Und dann seine Nachteile. Das Negative überwog.
"Du weeßt nich, wie de meesten Männer sind, wenn se 'ne halbnackte Frau sehen", behauptete sie etwas unmotiviert. Dann kicherte sie:
"Aber vielleicht weeßt du's ja doch. Du bist een janz stilles Wasser."
Sie erwartete, dass er nun mit seiner Potenz prahlte. Aber ihre treuherzige Schamlosigkeit machte ihn stumm. Natürlich zog sie naive Schlüsse aus seiner Sprachlosigkeit. Vielleicht machte sie sich sogar über seine Fassungslosigkeit lustig. Er wusste, wie verletzlich er war, wenn er belächelt wurde. Also versuchte er gerade noch rechtzeitig die Flucht nach vorn.
"Und ich soll dir helfen", stellte er abschätzig fest und hoffte, dass ihr Versuch, ihn auf ihr Niveau zu ziehen, durch seine nicht zu übersehene Arroganz fehlschlagen würde.
Sie spürte, dass er nahe daran war, ihr eine hochmütige Absage zu erteilen, und wurde schlagartig demütig. Es war wie ein unbewusster Reflex, den sie im Umgang mit zahlenden Männern gelernt hatte. Beinahe übergangslos fiel sie in die Rolle des bewundernden Weibchens:
"Ich bitte dich darum."
Sie redete wieder Hochdeutsch. Er grinste zufrieden, hielt sich aber mit Äußerungen zurück. Sie musste nicht wissen, wann er mit sich im Reinen war. Dennoch ahnte er nicht, worauf das alles hinauslaufen sollte.
"Und wie soll das vor sich gehen?", fragte er, benahm sich aber gleichzeitig derart selbstgewiss, dass sie glauben musste, er wisse genau, was sie von ihm erwartete. Darum ersparte sie sich eine Antwort und versuchte stattdessen, ihn mit Versprechungen zu locken:
"Et soll dir ooch nich zum Schaden jereichen."
Er hob unschlüssig seine Schultern und gab einen zögernden Laut von sich. Er wusste immer noch nicht, was sie eigentlich von ihm wollte.
"Du kannst eenen Teil des Geldes haben oder in Naturalien bezahlt werden."
Wenn sie versuchte, Hochdeutsch zu sprechen, machte sie den Eindruck eines kleinen Mädchens, das sich bemühte, artig zu sein. Aber nun ahnte er, welche Rolle er übernehmen sollte. Er wollte es genau wissen. Sie sollte es mit ihren Worten erklären.
"Red' nicht um den heißen Brei! Sag' mir in allen Einzelheiten, was du von mir willst!"
Sie blieb unter einer Straßenlaterne stehen, die noch nicht gelöscht war, und fasste nach seiner Hand. Wahrscheinlich sollte es eine Unterwerfungsgeste sein.
"Ick wusste, dass auf dich Verlass is. So ein Dreckschwein soll mich nich mehr schlagen dürfen."
Aber Georg machte seine Hand frei und insistierte: "Und wie soll das praktisch vor sich gehen?"
Sie schilderte es ihm. Mit beschönigenden Worten. Soweit sie dazu in der Lage war: Er solle sich in der Nähe aufhalten, wenn sie ihren Nach-Feierabend-Geschäften nachging. Sobald sie Gefahr witterte, würde sie rufen oder schreien, je nach Schwere der Bedrohung. Dann hätte er in Erscheinung zu treten. Und gegebenenfalls einzuschreiten.
"Du würdest zehn Prozent kriegen - - oder wat de sonst von ma willst."
Sie klapperte tatsächlich mit ihren Augenlidern.
Schließlich einigten sie sich auf ein Viertel ihres nächtlichen Einkommens.
Das war preiswert. Er wusste, was die Luden in Hamburg erhielten. Im Zweifel alles. Aber Hilde – eigentlich hieß sie Wilhelmine – war keine Professionelle. Und er war es auch nicht. Er leistete ihr eine Art Freundschaftsdienst. Mehr nicht. Da waren fünfundzwanzig Prozent genug.
Und im Übrigen erhielt er seine Naturalie heute schon. Als Vorschuss. Umsonst.
Sollte er Gewissensbisse oder ähnliche Skrupel gehabt haben – er verdrängte sie. Darüber hinaus war er sein Geld wert. Hilde wusste es. Und er auch. Spätestens als sie eines Nachts in einem zwielichtigen Hotel zu dreien über sie herfallen wollten und er alle drei angetrunkenen Tölpel mitsamt ihren Messern, die sie plötzlich in ihren Händen hielten, die Treppe hinunterwarf. Sie dankte ihm auf ihre Art.
Er hatte sich ausbedungen, dass niemand von seinem Beistand erfahren dürfe.
"Du erzählst keinem Menschen etwas von mir."
Er drohte ihr. Dennoch erzählte sie ihrer Freundin Marie von ihm. Während einer Samstagnacht trafen sie sich zu dritt.
"Wir sind im Excelsior verabredet", verkündete Hilde stolz.
Das Hotel Excelsior war ein zweitklassiges Haus in einer Nebenstraße des Kurfürstendamms, dort wo er seinen Glanz zu verlieren beginnt. Aber für Hilde war das Hotel ein Aufstieg. So vornehm war sie noch nie verabredet gewesen.
"Wir treffen beide denselben Mann. Marie hat das arrangiert."
"Wenn es euch nichts ausmacht - - "
Er hatte weder Hilde noch ihrer Freundin etwas zu verbieten.
"Er zahlt gut", erstickte Marie alle vielleicht doch noch versteckten Einwände, "und ohne zu handeln."
So lernte er Marie kennen.
Ein paar Tage später sprach Hilde ihn während einer Zigarettenpause im Hinterhof der Neuköllner Bierschwemme leise an, obgleich sie sonst jeden auffälligen Kontakt am Arbeitsplatz vermieden.
"Kannst du heute Abend Marie begleiten?"
Zögernd sagte er zu. Er hätte nicht sagen können, warum ihn ein ungutes Gefühl beschlich, als er Hildes Freundin ins Hotel brachte. Marie schien kein guter Umgang zu sein. Seit Hilde sie ständig traf, vernachlässigte sie ihre Arbeit vor der Theke. Sie war müde und unfreundlich. Ihre nächtlichen Ausflüge häuften sich. Die Bekanntschaften wurden wahllos.
Für Georg waren die Nächte in den fragwürdigen Hotels leicht verdientes Geld. Selten nur musste er einschreiten, und wenn ihm danach war, schlief er mit Hilde – vorher, nachher oder wenn sie nicht verabredet war. Und nun kam Marie dazu. Ein unbefangener Beobachter würde behaupten, er hätte zwei Mädchen laufen. Die Situation behagte ihm nicht.
Nach zwanzig Minuten, die er rauchend und wartend auf dem Hotelflur verbracht hatte, gesellte sich Marie wieder zu ihm. Sie nahm seinen Arm und grinste ihn an:
"Das war wohl nichts. Er war schon fertig, als es noch gar nicht angefangen hatte."
Sie gab ihm sein Geld.
Sie gingen durch den warmen Sommerabend. Marie erzählte, dass sie Hilde schon seit ihrer gemeinsamen Kindheit kannte. Sie seien in der gleichen Gegend aufgewachsen.
"Nach der Schule haben wir uns aus den Augen verloren."
Wieder getroffen hätten sie sich in der Bierschwemme, in der Hilde und er, Georg, langweilige Säufer bedienten. Sie sei damals schon freiberuflich tätig gewesen. Sie lachte:
"Ich hatte einen gutaussehenden Mann am Arm, der mich freihielt, als Hilde uns bediente und wir uns wiedererkannten."
Georg fragte sich, ob sie ihm die Zufriedenheit mit ihrem Leben vorspielte. Im Grunde interessierte es ihn nicht. Er hing seinen eigenen Gedanken nach, während sie munter plapperte. Dann stockte das einseitige Gespräch und nach einer kleinen Weile des Schweigens fragte sie:
"Bringst du mich nach Haus?" Und als er zögerte, fügte sie hinzu: "Ich wohne allein."
Es wurde eine unvergessene Nacht.
Wenn er mit Hilde schlief, gingen sie routiniert miteinander um. Sie wussten, was sie wollten und was der andere zu bieten hatte. Sie waren aneinander gewöhnt wie ein altes Ehepaar. Mit Marie war alles anders. Es machte ihr Spaß, mit ihm zu spielen, ihn zu verlocken, ihn hinzuhalten, mit ihm zu experimentieren, sich ihm zu versagen, um ihn Augenblicke später zu wilden Zirkusnummern zu provozieren. Endlich schlief er erschöpft ein. Aber noch im Morgengrauen weckte sie ihn mit verlangenden Zärtlichkeiten und geflüsterten Hinweisen, was er zu tun habe.
Zum ersten Mal seit er in Berlin war, kam er zu spät zum Dienstbeginn.
Marie mit ihrer ausgelassenen Fröhlichkeit und einem unerschöpflichen Verlangen nach seinen Umarmungen zerstreute seine Bedenken, die er wegen seines nächtlichen Nebenerwerbs gegenüber seinem Arbeitgeber hegte. Er war schon immer mit wenig Schlaf ausgekommen. Aber nun schmolzen seine Ruhephasen auf drei bis vier Stunden täglich zusammen. Er wurde fahrig.
Gleich nach seiner Ankunft in Berlin war er einem Sportclub beigetreten, in dessen Turnhalle er mit Hanteln trainieren konnte. Zwar besaß er keinen Wettkampfehrgeiz mehr, aber er wollte in Form bleiben. Zwei Vormittage in der Woche blieben dem Training vorbehalten, auch wenn es ihm immer schwerer fiel, rechtzeitig aufzustehen. Nachmittags und abends bediente er die Gäste in der Brauereigaststätte. Nachts war er oft bis in die frühen Morgenstunden mit den Mädchen unterwegs, und wenn Marie nicht einschlafen konnte – und sie legte es darauf an, munter zu bleiben –, verführte sie ihn zu ständig neuen Spielen in ihrem breiten Bett. Es schien Georg, als wolle sie ihm und allen Anderen beweisen, dass sie ihren Beruf liebte, und manchmal fühlte er sich als Laborratte, mit der sie experimentierte, bis sie mit einer neuen Stellung, einem bisher unbekannten Reiz oder einer anderen Überraschung zufrieden war und damit gleichsam an die Öffentlichkeit gehen konnte. Es war ein anstrengendes Leben. Aber er lernte viel bei ihr.
"Deine zukünftige Frau – falls du jemals heiraten solltest, du bist nicht der Typ dafür – wird es mir danken", machte sie sich über seine gelegentlichen puritanischen Skrupel lustig. Dann lachte er zwar, war aber nicht sicher, dass sie mit ihren bedenkenlos genossenen Sottisen wirklich den besseren Teil des Lebens durchspielte.
Glücklicherweise fiel ihm seine Arbeit am Gast nicht schwer. Er besaß eine natürliche Gabe für das rechte Maß an Ergebenheit, ohne unterwürfig zu wirken. Die Leute, denen er die Bestellungen servierte, waren der Meinung, er sei sein Trinkgeld wert. Mit seinen Kollegen, denen er mit Sicherheit an Körperkraft, aber wohl auch geistig überlegen war, kam er gut aus, ohne Freundschaften zu schließen. Den in größeren gastronomischen Betrieben schnell entstehenden betrügerischen Interessengruppen zum Nachteil der Eigentümer schloss er sich nicht an. Er machte rasch deutlich, dass er auf der Seite der Arbeitgeber stand, denen er sich durch seine Herkunft als zugehörig betrachtete. So blieb er meist ein Fremder unter den Bedienern, die ihm mit unverkennbarem Misstrauen begegneten.
"Er bildet sich ein, etwas Besseres zu sein", hörte er mehr als ein Mal von verschiedenen Serviererinnen, deren Schmeicheleien er uninteressiert belächelt hatte. Er geriet in den Ruf eines Einzelgängers, wurde bespöttelt, bewundert, beneidet und schließlich in Ruhe gelassen. Man hatte sich an ihn gewöhnt. Er war es zufrieden, tat seine Pflicht, war nichtssagend freundlich zu jedermann, wich Freundschaften aus und ließ sich auf keine Klüngelei ein. Dennoch lernte er schnell, wie man als angestellter Kellner mit kleinen oder größeren Betrügereien seinen kärglichen Lohn aufbessern kann. Wenn sich eine gefahrlose Gelegenheit ergab und er keine Mitwisser fürchten musste, brachte er Bier am Bufettier vorbei zum Gast, löste entwertete Bons mehrfach am Ausschank ein, prellte angetrunkene Gäste, hinterging die Brauerei bei der Anlieferung der Bierfässer, betrog bei der Eintragung seiner Arbeitszeiten, behielt größere Trinkgelder für sich, statt sie in den Tronc zu zahlen, aus dem nach einer fest gefügten hierarchischen Ordnung die Servicekräfte einen zusätzlich Lohn erhielten, und bereitete sich mit dem so erworbenen Wissen über die Umgehungsmöglichkeiten der Kontrollen auf seine zukünftige Rolle als Gastronom vor.
Dass er ein Fremdkörper im Personalbestand war, fiel zuerst den Oberkellnern auf, denen er zugeteilt wurde. Manche förderten ihn, aber die meisten betrachteten ihn als potentiellen Konkurrenten. Er überlegte, ob er ihnen erzählen sollte, dass er keinerlei Ambitionen besaß, in der geknechteten Gilde der Kiestreter – die Bedienungen im Biergarten und auf der kiesbestreuten Terrasse wurden so genannt – Karriere zu machen. Sein Ehrgeiz war größer. Er sah sich als Pächter bedeutender brauereieigener Unternehmen und später – wahrscheinlich – als Eigentümer von Restaurants und Hotels. Aber solche Pläne gingen niemand etwas an. Er hielt es für besser, sich keinem anzuvertrauen. Weder hinsichtlich seiner Zukunftshoffnungen noch sonstiger beruflicher Ideen. Pläne gedeihen erfolgreich im Stillen. Dabei blieb er. Auch als er eines Tages in das Büro des Pächters der Neuköllner Bierschwemme gerufen wurde.
"Direktor Obermeier hat sich nach dir erkundigt", sagte der Pächter mit einigem Befremden in der Stimme.
Obermeier gehörte zum Vorstand der Brauerei.
"Bist du mit ihm verwandt?"
Hilfs-Commis wurden geduzt.
"Nein."
Georg war bisher nicht bekannt, dass sein Vater – niemand sonst konnte die Aufmerksamkeit des Direktors in München auf ihn in Berlin gelenkt haben – einen so guten Draht zur Brauerei besaß.
"Und wie gefällt es dir bei uns?"
"Danke, gut. Ich habe viel gelernt."
Gewöhnlich wusste er, was die Leute von ihm hören wollten. Das gehörte zur Trinkgeld-Philosophie.
"Dann berichte das Direktor Obermeier."
Obermeier war das Mitglied des Vorstands, das für die guten Kontakte zu den Pächtern der Brauerei zuständig war. Als er eines Tages die Berliner Bierschwemme besuchte, fragte er Georg im Büro des Pächters, wo er bisher Dienst getan habe, wofür er sich besonders interessiere und ob er spezielle Wünsche hinsichtlich seiner Ausbildung hege.
"Ich möchte - - vielleicht später einmal - - -", immer schön bescheiden auftreten, " - - - in der Ausgabekontrolle tätig werden - - - " und diesen Oberkellner-Strebern das Leben schwer machen, fügte er im Geiste hinzu.
"Mal sehen, was wir machen können - - wenn du dich anstrengst - - - "
Einstweilen bekam er ein Buch in die Hand gedrückt. Leitfaden für die Gastronomieberufe. Er hatte noch nie davon gehört, dass es Bücher über Kneipen gab. Was das wohl für Sprücheklopfer waren, die Lehrbücher über den Verkauf von Alkohol an schwachköpfige Säufer schrieben.
Aber dann fand er den Inhalt des Buchs doch ganz interessant. Er war froh, dass er nicht seinem ersten Impuls nachgegeben und den schmalen Band einfach weggeworfen hatte. Der Autor beschrieb Vorgänge im Betriebsablauf, über die er selbst noch nie nachgedacht hatte. Manche Artikel las er immer wieder, bis er sie fast auswendig kannte. Und am Schluss des Textes gab der Autor Hinweise auf andere Bücher. Alles für Gastwirte – von denen die meisten keine Ahnung hatten, dass es gebildete Leute gab, die sich über ihren Beruf Gedanken machten.
Auch Marie machte sich über ihn lustig, als sie ihn ins Lesen vertieft sah. Aber sie lachte nur ein Mal und dann nie wieder über seine Bücher. Denn es blieb nicht bei diesem ersten, geschenkten Buch. Als er glaubte, alles verstanden zu haben, was der Leitfaden beschrieb, begann er sich zu fragen, was die anderen Autoren, deren Bücher im Anhang aufgeführt waren, wohl über die Gastronomie geschrieben haben mochten. Er überlegte ernsthaft, ob es sich lohnen könnte, sein für die eigene Gaststätte zurückgelegtes Geld für noch ein Buch auszugeben.
Wenn er unterwegs in der Stadt an einem Buchladen vorbeikam, blieb er vor dem Schaufenster stehen. Aber niemals entdeckte er einen der auf den letzten Seiten seines Leitfadens aufgezählten Titel in der Auslage.
Noch nie hatte er einen Fuß in eine Buchhandlung gesetzt. In manche der Läden konnte er von außen hineinsehen. Die Wände waren raumhoch mit Büchern verstellt. Die Kunden sprachen mit den Verkäufern, die ein wichtiges Gesicht machten. Oder sie standen vor den Regalen, nahmen ein Buch heraus und begannen, darin zu lesen, ohne es vorher bezahlt zu haben. Manche vermittelten ihm den Eindruck, sie wollten das Buch gar nicht kaufen, sondern im Laden lesen. Vielleicht war das sogar erlaubt, denn niemals sah er einen Buchhändler seinen Kunden ermahnen, das Buch wieder zurückzustellen.
Der halbverhungerte Theo, der abends immer in das Neuköllner Lokal kam, um seine Zeitungen an die Gäste zu verkaufen, würde zu zetern beginnen, wenn jemand seine frisch gedruckten Blätter erst lesen und dann – vielleicht – bezahlen würde. Und was Georg besonders wunderte, war, dass der eine oder andere Kunde im Buchladen das Buch, in dem er gelesen hatte, wieder in das Regal zurückstellte und ohne überhaupt etwas gekauft zu haben das Geschäft verließ.
Es dauerte ein paar Wochen, ehe er sich entschloss, eine Buchhandlung tatsächlich zu betreten.
Die Kunden durften anscheinend wirklich tun und lassen, was sie wollten. Er hatte einen Laden entdeckt, in dem eine junge Verkäuferin die Leser bediente. Junge Frauen fand er weniger furchteinflößend als die alten Männer, die in den meisten anderen Buchhandlungen als Verkäufer angestellt waren. Seinen Leitfaden hatte er mitgenommen. Es konnte sicher nicht schaden, wenn die Buchhändlerin wusste, dass er bereits ein Buch besaß.
"Ich möchte dies Buch hier kaufen", sagte er, nachdem die Verkäuferin, die er von der Straße aus beobachtet hatte, ihn endlich entdeckte und nach seinen Wünschen fragte. Es schien zum guten Ton zu gehören, die Kunden nicht mit Fragen zu belästigen. Er wunderte sich, wie die Leute ihren Umsatz machten.
Mit dem Finger zeigte er auf das teuerste Buch, das in seinem Leitfaden für die Gastronomieberufe aufgeführt war. Seltsamerweise hatte es weniger Seiten als ein paar billigere, die da auch erwähnt wurden. Aber wenn er schon ein Buch kaufte, durfte es ruhig das teuerste sein. Vielleicht beeindruckte das auch die Verkäuferin.
"Wahrscheinlich haben wir das nicht im Bestand", sagte das Mädchen bedauernd. "Ich muss es für Sie bestellen."
Sie blätterte in einem dicken Wälzer. Ein so schweres Exemplar von Buch hatte er noch nie gesehen. Höchstens auf Bildern. Anscheinend enthielt es alle Titel, die jemals gedruckt worden waren. Die Verkäuferin blickte wieder auf.
"Es gibt eine neue Auflage. Schon die zweite nach der, die in Ihrer Bibliographie erwähnt wird. Soll ich sie Ihnen zur Ansicht bestellen? Sie ist etwas teurer geworden."
Sie nannte den aktuellen Preis.
Er war verwirrt. Was war eine 'neue Auflage'? Wieso konnte die kleine Verkäuferin – bestimmt nicht älter als er – ein Wort wie 'Bibliographie' fließend aussprechen, und was bedeutete es überhaupt? Wo lernt man so etwas?
Aber tapfer nickte er und fügte ein krächzendes "Ja, bitte" hinzu.
"Es wird ein paar Tage dauern. Der Verlag hat hier kein Auslieferungslager und ich glaube nicht, dass der Grossist ein so seltenes Fachbuch vorrätig hat."
Sie fragte ihn nach seinem Namen und seiner Adresse und händigte ihm zur Erinnerung die Durchschrift ihrer vorgedruckten Notiz aus.
"Kann ich sonst noch etwas für Sie tun?"
Er schüttelte den Kopf und stolperte verwirrt zum Ausgang. Als er sich bewusst wurde, dass er einen kläglichen Abgang machte, blieb er abrupt stehen, fasste sich an den Kopf, als ob er etwas vergessen hätte, und ging zurück an eines der Regale im Hintergrund, wo er wahllos ein Buch herauszog, darin blätterte und es wieder zurückstellte. Er hatte vor Aufregung kein Wort lesen können und jeden Augenblick damit gerechnet, dass ihm jemand das Buch aus der Hand riss und ihm in Rechnung stellte. Aber nichts geschah. Im Gegenteil, als er wieder an der Verkäuferin vorbeiging, nickte sie ihm lächelnd zu und sagte höflich Auf Wiedersehen. Er lächelte zurück und atmete tief auf, als er endlich wieder auf der Straße stand.