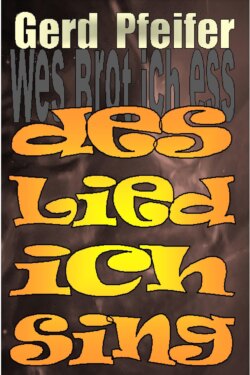Читать книгу ...des Lied ich sing' - Gerd Pfeifer - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der alte Mann liegt in seiner Badewanne
ОглавлениеEr hält die Augen geschlossen und denkt über seine Jugend nach. Das heiße Wasser besänftigt seinen schmerzenden Rücken. Aber ganz durchdringt die Wärme seinen gebrechlichen Körper nicht mehr. Auf seiner Stirn stehen Schweißperlen, dennoch ist ihm kalt. Hin und wieder schreckt er aus dem Sekundenschlaf alter Leute, dem er sich willig überlässt, öffnet den Wasserzulauf und mischt heißes Wasser unter den Schaum, der gnädig seinen faltigen Körper verhüllt.
Er leidet nicht unter Schlaflosigkeit. Wenn er gegen elf oder zwölf Uhr abends sein Bett aufsucht, schläft er sofort ein. Am nächsten Morgen erwacht er zwischen fünf und sechs Uhr. Dann liegt er zwischen den warmen Laken und führt gemächlich seine Gedanken spazieren. Bis er rund zwei Stunden später ins Bad geht, um sich für sein einsames Frühstück anzukleiden. Er liebt diese Zeitspanne zwischen Wachen und Träumen. Für ihn ist sie die produktivste Zeit des Tages. Zwar sind die meisten Gedanken, denen er während dieser Wachträume nachhängt, praktisch wertlos. Es geschieht selten, dass er sie für das tägliche Einerlei nutzen kann. Aber sie beweisen ihm, dass er noch nicht völlig senil ist.
In diesen zwei Stunden spricht er mit den Geistern seiner Vergangenheit. Öfter noch diskutiert er politische Alltagsfragen, soweit sie ihn interessieren. mit imaginären Kontrahenten. Er versucht, seine Überzeugungen dezidiert zu formulieren, entwirft diffamierende Äußerungen und polemisiert gegen Politiker im Allgemeinen und ihre Steuerpolitik im Besonderen. Hier entstehen die einstudierten Texte seiner verbalen Ausfälle gegen das Zeitgeschehen, dem er sich mehr und mehr entzieht, gegen die Agitatoren der öffentlichen Meinung, gegen die Protagonisten der political correctness und die Beschränkung persönlicher Freiheiten durch den Staat zu Gunsten einer versprochenen, aber nicht realisierbaren Sicherheit, gegen die Diffamierung seiner Generation durch die aktuelle Geschichtsschreibung, gegen das Weltgeschehen in Vergangenheit und Gegenwart und gegen die deutschen und alle anderen Politiker.
Vor Utas Tod stritt er in diesen frühen Morgenstunden stumm mit ihr über das Scheitern ihrer Ehe. Er rekapitulierte, was sie ihm vorgeworfen hatte. Schlagfertig war er noch nie gewesen. Aber hier im Morgengrauen fielen ihm die richtigen Antworten ein. Er stellte sich vor, wie er hätte argumentieren können, wenn ihm die eloquenten Erwiderungen rechtzeitig über die Lippen gekommen wären.
Diese im Geiste geführten Auseinandersetzungen enthoben ihn der Mühe, tatsächlich mit ihr zu streiten. Er hatte bereits alle Argumente in seiner Fantasie mit ihr ausgetauscht. Es gab nichts mehr zu sagen. Sie waren sich in seiner virtuellen Welt nicht einig geworden; in der Realität würden sie ebenso ergebnislos streiten. Der Aufwand, die Diskussionen mit ihr tatsächlich zu führen, lohnte nicht. Und so unterblieben die Gespräche, die ihre Ehe vielleicht gerettet hätten.
Ein Mal nur hatte er der Versuchung nicht widerstehen können, einen morgens im Geiste formulierten Zynismus tatsächlich anzubringen. Das war anlässlich der offiziellen Einweihung einer damals dem letzten Schrei moderner Architektur entsprechenden Wohnmaschine. Zusammen mit dem bekannten Kaffeeröster und einer gräflichen Vermögensverwaltung hatte er eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts gegründet, die als Bauherrin aufgetreten war.
Die publikumswirksamen Namen hatten den damaligen Bundeswohnungsbauminister – eine Charge, die es wegen der allgemeinen Wohnungsnot zu der Zeit noch gab – angelockt. Er kam mit seinen Beschützern, die angestellt waren, ihr Leben für ihn zu opfern, und großer Entourage angerauscht, um sich vor dem scheußlichen, fand Georg, Betonbau filmen und fotografieren zu lassen.
Leutselig unterhielt er sich vor den Kameras mit den Bauherren, als Georg ihn mit scheinheiliger Verwunderung fragte, ob er sich denn für derart unersetzlich und wichtig halte, dass er selbst in der politischen Provinz ein mit Steuern der kleinen Leute finanziertes, schusssicher gepanzertes Auto benutzen müsse. Minister seien doch beliebig austauschbar, wie man aus der Prozedur der Regierungsbildung wisse, in deren Verlauf die Ministrablen wahllos und ohne Eignungsnachweis die Ministerien unter sich aufteilen. Da sei der Aufwand für vorsorgliche Lebensrettungsmaßnahmen doch eigentlich nutzlos verschwendet, vielleicht sogar Missbrauch von Steuermitteln.
Der Minister hatte ihn mit offenem Mund eine oder zwei Sekunden angestarrt und sich dann dem nächsten Bewunderer zugewandt. Der Kaffeeröster grinste, zwinkerte mit den Augen und vermied danach jeden persönlichen Kontakt mit Georg.
Georgs Bemerkung blieb ohne erkennbare Folgen. Dass seine Partei den Minister, der Zinsen nicht von Annuitäten zu unterscheiden wusste, wenige Wochen nach der Einweihung der Wohnmaschine tatsächlich zur Abdankung zwang und ihn durch einen noch weniger geeigneten Parteifreund ersetzte, wollte Georg nicht auf seine Fahnen schreiben. Später wurde der ohne besondere Ehren entlassene Ressortchef neben einer Reihe anderer abgehalfterter Politiker in den Aufsichtsrat einer staatlichen Mittelstandsbank berufen, die während einer kleineren Börsenturbulenz mit Milliardenbeträgen aus Steuermitteln saniert werden musste. Keiner der Verantwortlichen wurde zur Rechenschaft gezogen. Die vor der politischen Macht sich fügende Presse nannte nicht einmal Namen.
Das alles ist lange her. Der entmachtete Minister lebt nicht mehr. Wahrscheinlich hatte er Georgs Einwurf nach ein paar Tagen vergessen. Politiker müssen belastbar sein.
Der alte Mann seufzt. Heute enthält er sich solcher Eskapaden. Nicht weil ihm der Mut fehlte oder die eher kindische Freude an der Provokation. Aber es ist so sinnlos, die Dummheit in der Politik bekämpfen zu wollen. Nicht einmal Lächerlichkeit kann ihre absurde Selbstverliebtheit beeinträchtigen. Politiker sind nicht von diesem Stern. Sie leben in einer virtuellen Welt, die mit dem Leben ihrer Wähler, die sie wie unmündige Kinder zu gängeln belieben, nichts gemein hat.
Der alte Mann ruft sich zur Ordnung. Er ist zu alt, um sich derart gehen zu lassen. Andererseits sind diese Momente, da er sich ärgert und sein Herz schneller schlägt, die wenigen Augenblicke, in denen er spürt, dass er noch lebt – allen Ärzten zum Trotz. Er lächelt breit und zufrieden vor sich hin. Wie im Schlaf nach einem schönen Traum.
An den Inhalt seiner nächtlichen Träume kann er sich selten erinnern. Meistens durchlebt er in ihnen immer wieder einander ähnelnde Situationen: Er befindet sich auf einer verzweifelten Suche – nach seinem Auto, einem Hotel, einer fremden Haustür, nach seinem Büro oder einer Verabredung. Er hat es eilig, möchte pünktlich sein. Äußerlich ruhig überlegt er methodisch, warum er den rechten Ort nicht findet. Befremdliche Hindernisse geraten ihm in den Weg. Er steigt über Zäune und Hecken, befreit sich aus schmerzhaftem Dornengestrüpp, überwindet Sumpf- und schmutzige Wasserflächen, steht vor verschlossenen Türen, leidet unter zäher Bewegungsunfähigkeit, kommt trotz quälender Anstrengung nicht voran, seine Höhenangst macht ihm zu schaffen. Niemals kommt er an, und wenn er resigniert die Suche abbricht, erwacht er. Und hin und wieder überfällt ihn auch sein Kriegstraum.
Vor Jahren hat er versucht, den ständig wiederkehrenden Traumthemen und ihren unbefriedigenden Abläufen einen Sinn abzutrotzen. Er hat Bücher gekauft und über manifeste und latente Trauminhalte, über Verdichtung, Verschiebung und symbolische Darstellung der Traumarbeit und über die Zensur des Ich gelesen. Für eine auch nur annähernd fassbare Traumdeutung hat die Lektüre nicht gereicht. Sie hat nur sein Vorurteil bestärkt, dass Psychologie aus kabbalistisch verbrämten Binsenwahrheiten besteht, die mit einer kryptischen Terminologie einen unhaltbaren Wissenschaftsanspruch erhebt. Er hält sie für Scharlatanerie.
Inzwischen hat er eine Sitzposition in der Wanne gefunden, die seinen schmerzenden Rücken entlastet. Noch ein letztes Mal lässt er heißes Wasser nachlaufen. Entspannt schließt er die Augen, verweilt behaglich an der Schwelle zwischen Schlaf und Wirklichkeit, auf seinen Lippen immer noch das gelassene Lächeln.
Es ist erstaunlich, wie genügsam die Wonnen des Alters werden. Noch in seiner Jugend fürchteten die Leute, in einer gefüllten Badewanne einzuschlafen. Er entsinnt sich der Mahnungen seiner Mutter, er könne träumend ertrinken. Es fasziniert ihn, wie schnell scheinbar gesichertes Wissen veraltet. Worüber die heutigen Generationen wohl in fünfzig Jahren belustigt lächeln werden? Vielleicht über das schwafelnde Gerede der gegenwärtig regierenden Politiker? Kein junger Mensch, der heute lebt, kann begreifen, wie halbwegs vernünftige Leute in den dreißiger und vierziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts die geifernden Hetztiraden eines Adolf Hitler ernst nehmen konnten. Zugegeben, heute klingt das alles schwülstig, antiquiert und unglaubwürdig. Aber damals trafen begnadete Redner wie Goebbels oder der Führer aller Deutschen den Geist der Zeit. Die Leute waren begeistert. Und der leichtgläubige Pöbel ließ sich gern aufhetzen. Georg erlebte ihn hautnah.
Es geschah, nachdem er von einem Besuch seiner Eltern nach Berlin zurückgekehrt war. Zu seinem zwanzigsten Geburtstag – '... und in einem Jahr bist du volljährig und kannst auf eigenen Füßen stehen ...', hatte seine Mutter geschrieben – erhielt er zusammen mit den üblichen Glückwünschen die Mitteilung, dass sie endlich die richtige Immobilie für ihr Café gefunden habe. Die Gelegenheit sei derart günstig gewesen, dass sie das Gebäude sogar fast ohne Fremdmittel habe kaufen können. 'So hat sich die Wirtschaftskrise für deinen Vater und mich doch noch zu einem Segen entwickelt', schrieb sie.
Er war, sobald er ein paar freie Tage erhielt, nach Altona gefahren, um das Haus zu besichtigen und die Lage zu beurteilen. Er fühlte sich seinen Eltern inzwischen auch in fachlicher Hinsicht überlegen. Tatsächlich war er der Meinung, sie in letzter Minute vielleicht noch vor einem Fehlgriff bewahren zu müssen. Aber seine Befürchtungen erwiesen sich als grundlos:
Es handelte sich um ein schönes Eckhaus, das vor elf Jahren gebaut worden war und einem jüdischen Arzt gehörte, der mit seiner Familie ins Ausland wollte. Insoweit war es ein Notverkauf und entsprechend preisgünstig. Für einen flüchtigen Augenblick versetzte sich Georg in die Lage der Auswanderer und schätzte sich glücklich, dass sein Vater kein Jude war. Tiefere Gedanken machte er sich nicht. Viele Juden gingen außer Landes. Es war nicht ihre Zeit in Deutschland. Später unter einer anderen Regierung würde sich das wieder ändern. Dann wären es vielleicht die Katholiken oder die Kommunisten, der Adel, die Polen die Schurken aus den Schurkenstaaten, die Muslime, die Heuschrecken, die Besserverdienenden oder die Gastwirte, die Leute, die fliehen müssten. Neue Regierungen brauchen neue Opfer. Und niemand weiß, wen es das nächste Mal trifft. So ungewiss ist das Leben für die Leute draußen im Land; und das war nicht nur Georgs Meinung.
Aber das Haus, das seine Eltern gekauft hatten, versprach ein Stück sichere Zukunft. Es war beinahe ideal geeignet für die Realisierung der Pläne seiner Mutter. Das etwas erhöht liegende Erdgeschoss konnte mit einem modernen Glasvorbau in den breiten Garten zur Straße hin erweitert werden. Es würde ein attraktiver Wintergarten entstehen – etwas völlig Neues im Viertel –, der dem baulichen Ensemble eine gewisse herrschaftliche Note verliehe, meinte selbst sein Vater.
Die Ausbaupläne waren bereits genehmigt, der notarielle Kaufvertrag geschlossen und der Kaufpreis in bar – das hatte den Ausschlag gegeben – entrichtet. Einen kleinen Kredit brauchten seine Eltern nur noch für den Umbau. Sie besaßen die Angebote mehrerer Banken, die sich vom hohen Eigenkapitalanteil des Gesamtfinanzplans beeindruckt zeigten.
Auch die Brauerei, mit der sein Vater seit Jahren zusammenarbeitete und die Verpächterin der Bierschwemme in Berlin war, in der Georg arbeitete, zeigte sich interessiert. Sie wollte die gesamten zusätzlichen Um- und Ausbaukosten im Rahmen eines Getränkeliefervertrags finanzieren.
Hier waren sich Georgs Eltern nicht einig. Wilhelm neigte dazu, die Offerte der Brauerei anzunehmen:
"Ich arbeite schon lange mit ihnen zusammen", argumentierte er. "Sie haben mich noch nie im Stich gelassen, weder in guten noch in schlechten Zeiten."
"Du hast ja auch immer pünktlich gezahlt", warf seine Mutter ein. "Für die Brauerei hat es mit uns noch nie schlechte Zeiten gegeben."
"Das ist doch der Punkt", widersprach sein Vater. "Die Leute kennen mich, und wenn – gerade zu Anfang – das Café nicht so laufen sollte, wie du dir das vorstellst - - "
Seine Frau wollte protestieren, aber Wilhelm hob beschwichtigend die Hand und mahnte:
"Du steckst da auch nicht drin - - und wenn es wirklich nicht so anläuft, wie du das ausgerechnet hast, dann kann man mit den Brauereileuten sicher besser reden als mit der Bank, denn die hat doch keine Ahnung von unserem Geschäft. Die finanzieren nur das Haus."
Georg schwieg zu dem Disput. Er hatte nicht die Absicht, sich zu exponieren und später vielleicht Vorwürfe hören zu müssen, weil er dieser oder jener Meinung zuneigte. Aber er stand Verträgen mit Brauereien grundsätzlich skeptisch gegenüber und sympathisierte mit der Ansicht seiner Mutter, die das Bankangebot bevorzugte.
"Stell' dir vor, es gibt noch einmal eine Inflation", stritt sie weiter, "dann tilgen wir den gesamten Bankkredit mit einer Tageseinnahme und haben ein schuldenfreies Haus ohne Brauereibindung und andere Wertminderungen."
Georg wunderte sich. Seine Mutter hatte die Verträge tatsächlich gelesen und die wichtigen Teile offenbar auch verstanden. Zum ersten Mal fand er die Idee, ein Café unter der Leitung seiner Mutter zu betreiben, nicht mehr völlig abwegig.
Und seine Mutter setzte sich durch.
Vor allem ein Argument überzeugte Wilhelm: "Wenn es wirklich Schwierigkeiten geben sollte, können wir den Bankkredit immer noch mit einem Brauereidarlehen ablösen."
Das überzeugte seinen Vater, und insbesondere versetzte es ihn in die Lage, seinen Vertrauten aus der Brauerei die Ablehnung des Angebots ohne Gesichtsverlust zu begründen.
Georg war mit der Entwicklung und dem Ende der Diskussionen zufrieden. Allerdings hatte er damit gerechnet, dass die alten Herrschaften ihn bitten würden, zurückzukommen und wenigstens während der Eröffnungsphase Hilfe zu leisten. Aber offenbar hielten es seine Eltern für selbstverständlich, dass er inzwischen ohne sie auskam, auch wenn er erst in nunmehr einem halben Jahr volljährig sein würde. Ebenso wenig bedurften sie seiner Hilfe. Er war freiwillig nach Altona gekommen, um ihre Pläne zu begutachten. Sie hatten ihn nicht gerufen. Aber ein wenig enttäuscht war er doch.
Seine Mutter, die das Gastzimmer der Eckkneipe seines Vaters kaum noch betrat – als ob es der zukünftigen Inhaberin eines bürgerlichen Cafés unwürdig sei, Trinker und Taugenichtse, aus denen Wilhelms Kundschaft nach ihrer Meinung vorwiegend bestand, freundlich zu bedienen –, fragte ihn beiläufig nach seinem Liebesleben. Er empfand die überraschende Einmischung in sein Privatleben als ungehörig, gab aber nach kurzem Zögern bereitwillig Auskunft über beide, Marie und Ellen. Er verschwieg die Rolle, die er in Maries Dienstleistungsgewerbe übernommen hatte. Vielleicht hätte seine Mutter moralische Bedenken geäußert. Aber sonst redete er ziemlich frei über sein Leben mit Marie.
"Hauptsache, du bindest dich nicht zu früh", sagte seine Mutter nur.
Und dann berichtete er in einem Augenblick familiärer Vertrauensseligkeit auch noch von seinen Ausflügen ins Berliner Kulturleben mit Ellen. Er war der Meinung, es müsse sie freuen, wenn er gleichsam zwei Stufen der gesellschaftlichen Hierarchie auf einmal erklomm. Aber er hatte sich getäuscht. Seine Mutter war eher entsetzt als begeistert:
"Das muss ein Ende haben", meinte sie finsteren Blicks. "Ihr passt nicht zusammen. So hoch hinaus – das kann kein gutes Ende nehmen. Du musst immer daran denken, woher du kommst."
Er wollte widersprechen, sie auslachen, ihr sagen, dass zum Glück das gesellschaftliche Kastenwesen der modernen Welt bedeutungslos, wenigstens aber durchlässig geworden sei. Aber seine Mutter hörte nicht mehr zu. Sie schüttelte verständnislos ihren Kopf und murmelte empört vor sich hin:
"... Gesangsunterricht - - lächerlich ..."
Sie wusste schon immer: Bildung macht unzufrieden. Und Bücher verderben den Charakter. Sie sprachen nie wieder über seine Frauen.
Georg kehrte nach Berlin zurück. Es war fast wie eine Heimkehr. Sein Elternhaus war ihm fremd geworden. Während der Eisenbahnfahrt dachte er über seine Eltern nach. Er konnte nicht leugnen, dass er sie auf eine gewisse Art beneidete. Sie hatten es geschafft. Ihr Ziel, den sozialen Aufstieg zu Kaffeehausbesitzern hatten sie erreicht. Er wusste nicht, ob sie nun glücklicher waren als zuvor; aber er spürte, dass sie – wäre der Umbau erst einmal fertiggestellt und das Café eingerichtet – ihr Leben als vollendet betrachten würden. Der Kreis hatte sich für sie geschlossen. Sie würden sich berechtigt fühlen, in Würde abzutreten, wenn die Zeit gekommen war. Er musste sich um sie keine Sorgen machen.
Aber Ellen beunruhigte ihn. Auf dem Weg zu dem kleinen Café – gleich sein erster Weg in Berlin hatte ihn in die Buchhandlung geführt – war sie fahrig, und als sie an ihrem gewohnten Tisch saßen und ihren Kaffee tranken, schaute sie an ihm vorbei. Offenbar verbarg sie etwas vor ihm. Ihre Hände wollten nicht zur Ruhe kommen. Sie spielte mit dem Kaffeelöffel, nahm die Zange aus der Zuckerdose, rückte ihre Tasse zurecht und antwortete geistesabwesend auf seine Fragen.
Erst als er sich über den schmalen Tisch lehnte, ihre Hände festhielt – es war die erste gesellschaftlich nicht unbedingt sanktionierte Berührung – und ihren leeren Redefluss mit einem lauten Räuspern unterbrach, blickte sie ihn an. Mitten im Satz hörte sie auf zu sprechen, biss auf ihre Lippen, senkte den Blick und studierte das Muster des nicht mehr ganz sauberen Tischtuchs. Dann wurde sie sich seiner Berührung bewusst, zog beinahe brüsk ihre Hände zurück und sagte tonlos:
"Wir dürfen uns nicht mehr sehen."
Er hatte mit allerlei weiblichen Zierereien gerechnet, die er hätte belächeln können. Auch die Sorgen einer verwöhnten Tochter aus gutem Haus, die sie bei aller Intelligenz und Belesenheit – und allen Klischees eines Zeitalters der Emanzipation zum Trotz – auch war, hätte er mit seinem jungenhaften Optimismus beiseite gewischt. Aber dieser Verzweiflung, dieser stillen Resignation, mit der sie ihrer Freundschaft ein Ende bereiten wollte, hatte er nichts entgegenzusetzen. Verblüfft sah er sie an, sprachlos und überrumpelt.
Schließlich fragte er: "Was ist geschehen?"
Seine Stimme schwankte, und er versuchte, seine plötzliche Heiserkeit durch ein trockenes Hüsteln zu verbergen. Es klang affektiert, und später glaubte er, sie für eine Weile mit offenem Mund angestarrt zu haben. Zuerst schüttelte sie nur den Kopf als schäme sie sich, seine Frage offen zu beantworten; doch als er insistierte, erzählte sie stockend, was sie derart aufgewühlt hatte. Und zum ersten Mal seit er denken konnte trat die Politik tatsächlich in sein Leben.
Die im April verbotenen Wehrorganisationen der Nationalsozialisten waren im Juni wieder zugelassen worden. Die Folgen waren blutige Freudenfeste der braunen Horden, wie sie von einem kleinen Teil der Presse genannt wurden. Die meisten Zeitungen und der größte Teil der Bevölkerung standen längst hinter ihnen. Sein Vater hatte ihm von Schlägereien in Altona erzählt. Er nahm solche Prügeleien, selbst wenn ein wenig Blut floss, nicht besonders wichtig. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich, war eine stehende Redewendung in seinem Elternhaus. Wilhelm hielt seine Gaststube mit resoluter Körperkraft, einem Gummiknüppel unter der Theke und einem stählernen Totschläger neben der Kasse sauber. Wenn die Polizei eintraf – falls sich uniformierte Beamte überhaupt die Mühe machten, in das Arbeiterviertel auszurücken –, war in aller Regel schon wieder Ruhe eingekehrt. Wilhelm ließ nicht zu, dass an seinem Tresen handgreiflich über Politik oder Religion diskutiert wurde.
"Das macht gefälligst draußen. Im Regen", sagte er und behielt seine Rechte vorsorglich unter dem kupfernen Spülbecken. Oder:
"Bei mir ist jeder gern gesehen, der seinen Schnaps bezahlt." Und:
"Ob du an den lieben Gott, einen Sack Zement oder daran glaubst, dass zwei Pfund Rindfleisch eine gute Suppe machen, geht mich einen Scheißdreck an. Und deinen Nachbarn auch." Und immer wieder:
"Politik ist ein schmutziges Geschäft."
Insoweit war Georg der Sohn seines Vaters. Religion und Politik standen auf der Liste seiner Tabuthemen. Niemals hätte er Ellen oder ihre Eltern nach ihren politischen oder religiösen Ansichten gefragt. Auch Maries Wunsch, am Sonntagmorgen in die Kirche zu gehen, hatte er nicht kommentiert. Nur mitgehen wollte er nicht.
Aber nun wurde er plötzlich mit dem ganzen politischen Dreck der Gegenwart konfrontiert. Und am widerwärtigsten war, dass Ellen von ihm erwarten durfte, Stellung zu beziehen, Partei zu ergreifen, eine Meinung zu vertreten – Dinge, die ihm zutiefst zuwider waren. Schweigend hörte er zu:
"Sie haben Vaters Apotheke beschmiert", erzählte sie mühsam beherrscht. Ihr tränenloses Gesicht mit den roten Flecken nervöser Anspannung auf Stirn und Wangen beschämten ihn. Lieber hätte er sie weinen sehen – eine weibliche Reaktion, die er kannte. Aber ihre tonlose Stimme, die fahrigen Bewegungen mit der flachen Handfläche über das Tischtuch, die flatternden Augenlider und das Unvermögen, ihn ruhig anzusehen - - all die äußeren Zeichen innerer Zerrissenheit machten ihn verlegen.
Vor allem verstand er den Grund der Aufregung nicht. Ein paar bescheuerte Neider hatten die Apotheke eingesaut. Na, und - -, war er versucht, Ellen zu beruhigen. Selbst seinem Vater hatte eine Handvoll besoffener Schnapsnasen schon einmal das große verhängte Fenster mit Pflastersteinen eingeworfen, weil die Tür am frühen Morgen noch verschlossen war. Wilhelm war in aller Ruhe nach draußen gegangen, hatte den Rädelsführer zusammengefaltet, mühelos in die Gaststube getragen, lang ausgebreitet auf die Theke gelegt, seinem Sohn – Georg war damals höchstens dreizehn Jahre alt – den Gummiknüppel gegeben und befohlen:
"Wenn er sich bewegt, hau' ihn auf die Nuss. Aber kräftig. Ich gehe und hole die Blauen."
Der Mann, der da lag, war ein Stammkunde. Kohlenschlepper. Er wohnte mit Frau und Tochter ein paar Straßen weiter. Georg kannte ihn. Ein stiller Zeitgenosse mit einem eingefallenen Gesicht, in dessen Falten der feine Kohlenstaub festgewachsen war. Nur wenn er zu viel getrunken hatte, wurde er aufsässig. Später, falls er sich überhaupt erinnerte, entschuldigte er sich bei seinen Kontrahenten: "Das nächste Mal hau' mir einen in die Fresse, dass ich liegen bleibe. Dann mache ich wenigstens keinen Unsinn."
Jetzt fing er an, Wilhelm zu beschimpfen. Georg hielt ihm mit seiner schwieligen Gewichtheberhand den Mund zu. Er wehrte sich nicht, sondern blieb ruhig auf dem Tresen liegen, bis Wilhelm mit einem Polizisten zurückkam. Der befahl ihm aufzustehen, und dann unterschrieb er, langsam und mit der Zunge zwischen den Lippen, einen Schuldschein für die Glasscheibe. Im Hinausgehen beschwerte er sich bei Wilhelm:
„Du hättest den Kleinen zu den Blauen schicken sollen. Als ich einen Schnaps haben wollte, hat er mich fast erwürgt."
Wilhelm rief ihn zurück und spendierte ihm ein kleines Bier: "Auf Kosten des Hauses."
Ihre gegenseitige Achtung blieb unverändert.
Das alles wollte Georg 'seiner Sängerin', wie er sie im Stillen und ein wenig stolz nannte, zum Trost erzählen. Aber er konnte es nicht. Er wäre sich kindisch vorgekommen. Ihre Verzweiflung war zu tief für lustige Anekdoten.
Das Gesindel, das in der Nacht die Apotheke beschmiert hatte, waren Fremde gewesen. Unbekannte. Womit konnten sie Ellens Vater derart verächtlich machen, dass Ellen, die gefasste, kühle Buchhändlerin, derart außer Fassung geriet? Was hatten sie auf die Wand geschrieben? Er war wirklich naiv. Nachträglich hätte er sich nicht gewundert, wenn sie geglaubt hätte, er wolle sich über sie lustig machen.
So fragte er sie nach den Schmierereien. Immer wieder. Aber sie antwortete nicht. Sie tat, als müsse er wissen, was geschehen war. Und warum. Er war hilflos, wollte sie beruhigen, trösten. Aber wie, wenn er nicht wusste, was sie verstört hatte? Sie saß ihm gegenüber, war aufgelöst, kopflos und ängstlich. Und ebenso konfus – das entnahm er ihren fast gestammelten Sätzen – lief offenbar ihr Vater in seinem Haus umher, wollte keine Polizei, weigerte sich, Anzeige zu erstatten. Und auch Ellen besaß kein Vertrauen zur Justiz.
"Die kommen erst gar nicht", hatte sie resigniert auf seine Vorhaltungen erwidert. Eine Welt, ihre Welt schien für sie zusammengebrochen zu sein. Hoffnungslos saß sie mit ihm an einem Tisch und war doch meilenweit von ihm entfernt.
Er verstand das alles nicht.
Schließlich sah Ellen ihn ratlos an. Zum ersten Mal schien sie sich seiner Gegenwart heute bewusst zu werden. Sie lächelte vage. Als ob sie um Entschuldigung bäte. Ihre Hände kamen zur Ruhe. Mit einem jämmerlich kleinen bestickten Taschentuch betupfte sie ihre Augen, die rot und tränenlos durch ihn hindurchzusehen schienen.
"Sie wissen wirklich nicht, was uns und anderen geschehen ist!", stellte sie erstaunt fest. "Sie haben keine Ahnung."
Konsterniert schüttelte sie ihren Kopf. Georg fühlte sich einfältig, blauäugig, unwissend und auf eine erbärmliche Art schuldig, wusste aber eigentlich nicht warum.
"Nein", sagte er schlicht und wahrheitsgemäß, lächelte entschuldigend, "sagen Sie's mir!"
Prüfend blickte sie ihn an, wollte Gewissheit haben, fürchtete, dass er sich über sie lustig machen könnte. Nach einer Weile schien sie seinem schüchternen Lächeln Glauben zu schenken.
"Mein Vater ist Jude", sagte sie leise und schaute sich vorsichtig und verschämt in dem kleinen Café um, das fast leer war und in dem niemand Notiz von ihnen nahm. Selbst die Bedienung stand interesselos an der Kasse und blätterte in einer Illustrierten.
Georg war nahe daran, nun doch noch 'na, und – ' zu fragen. Bis ihm gerade noch die Karikaturen in den Zeitungen einfielen, die dickbäuchige, krummnasige alte Männer mit Stirnlocken und steifen Hüten zeigten; sie saßen auf Geldsäcken und wurden für die Wirtschaftskrise verantwortlich gemacht: Juden. Er hatte die Zeichnungen kaum beachtet, auch die Hetztiraden im Radio und die Flugblätter auf den Straßen nicht ernst genommen. Es wird viel gelogen in den Zeitungen, und das Papier der Politschriften ist besonders geduldig. Allerdings musste er zugeben, dass er noch nie darüber nachgedacht hatte, ob es tatsächlich Menschen gibt, die hinter dicken, ledergepolsterten Türen ihre Hände reiben und schadenfroh über die Nöte der Anderen feixen. Oder ist die Szene nur ein Bild aus der Vorstellungswelt der ewigen Verlierer, die verbittert sind, weil sie nicht selbst hinter den schalldichten Türen zum Geld sitzen? Und falls es die Händereiber doch gibt - - sind es Juden? Warum? Warum ausgerechnet Juden? Was sind Juden eigentlich?
Er entsann sich einer Szene in der abendlichen Gaststube seines Vaters. Wilhelm stand hemdsärmelig hinter dem Tresen und zapfte Bier. Mit todernster Miene, die er immer aufsetzte, wenn er einen Scherz machen wollte, zeigte er auf die Zeitung, die zusammengefaltet vor ihm lag, und sagte zu dem Gast vor ihm:
"Ihr Juden vergiftet jetzt auch unsere Brunnen und fresst kleine Kinder aus Altona. Das weiß inzwischen jeder."
Der schwarze Ira, der immer leise nach Fisch roch, auch samstags, wenn er einen schwarzen Anzug trug und nicht im Fischereihafen arbeitete, stand vor dem Tresen und wartete auf sein Bier. Mit ähnlich ernstem Gesicht antwortete er langsam und ließ jedes Wort genüsslich auf der Zunge zergehen:
"Und ihr dämlichen Christen geht nur in die Kirche, um euren Heiland aufzufressen und sein Blut zu trinken." Er schüttelte sich und tat angewidert: "Barbaren!"
Scheinbar böse blickten die beiden Männer sich an. Ira sah wirklich aus wie die Judenkarikaturen in den Zeitungen. Große Nase, überall schwarze Haare, in der Nase, in den Ohren, auf den Armen. Georgs Mutter hatte gelegentlich darüber gesprochen und gemeint, dass sie nicht mit ihm verheiratet sein wollte. Wilhelm hatte gesagt, dass er nicht einmal wisse, ob Ira wirklich Jude sei.
"Vielleicht weiß er es selbst nicht so genau. Jedenfalls geht er nicht in die Synagoge."
In die Fopperei der beiden Männer am Tresen mischte sich eine Stimme aus dem Hintergrund, wo eine Skatrunde zu vieren saß, so dass immer ein Spieler frei blieb:
"Über Kirchen darfst du mit Wilhelm nicht reden. Er hat noch nie eine von innen gesehen."
Und eine andere Stimme aus der Runde warf ein: "Und mit Ira nicht über Kinder. Er weiß nicht einmal, wie man sie macht."
Ira war seit vielen Jahren verheiratet, aber Kinder hatte er nicht.
Die Neckereien in der Schankstube schienen nur herzlos. Die Männer kannten sich seit Jahren. Die Scherze blieben immer die gleichen. Es gab kaum etwas, das man einander übelnahm. Ein Außenstehender hätte vielleicht wirklich geglaubt, sie seien eine große Familie – Jude, Christ, Katholik, Protestant, Agnostiker, Ungläubiger oder der Mann, der an den Sack Zement glaubte, von dem Wilhelm gern sprach.
Und nun war Ellen fast zusammengebrochen, weil ihr Vater Jude war und ein paar braune Stürmer das an die Apotheke geschmiert hatten. Er verstand die Aufregung noch immer nicht. Aber sie blieb unbeirrbar: "Wir dürfen uns nicht mehr sehen", sagte sie ein ums andere Mal. Er konnte reden, so viel er wollte.
Sie blieb bei ihrer Meinung. Auch unterwegs noch, als er sie wie immer zurück in die Buchhandlung brachte, flehte sie ihn geradezu an:
"Sie machen sich unglücklich, wenn Sie sich in der Öffentlichkeit mit mir sehen lassen."
Georg hielt sich nicht an ihre Mahnung. Er kam wie immer, stellte sich vor den Buchladen und nickte ihr zu. Aber sie folgte seiner stummen Einladung nicht. Vehement schüttelte sie ihren Kopf und wandte sich ab. Schließlich ging er hinein und verlangte ausdrücklich nach ihrer Bedienung. Das Ergebnis war, dass sie weinte. Er hatte sie in Verlegenheit gebracht.
Ein paar Mal passte er sie ab, wenn sie den Laden verließ. Sie duldete nicht, dass er sie begleitete. Auf seine Argumente, seinen fröhlichen Optimismus, mit dem er ihre Angst vor Diffamierung und Diskriminierung ins Lächerliche zu ziehen versuchte, reagierte sie wütend oder mit traurigem Weinen. Sie war der festen Überzeugung, dass es sich als Verhängnis erweisen würde, wenn er weiterhin ihre Nähe suchte. Gleichzeitig versuchte sie, ein normales Leben zu führen. Sie ging ins Theater, besuchte ihren Gesangslehrer, bediente die Kunden in der Buchhandlung und besuchte hin und wieder ihren Vater in der Apotheke – Wände und Fenster waren von den Schmierereien wieder befreit – und ging gemeinsam mit ihm Arm in Arm nach Haus.
Nur seine, Georgs, Gegenwart mied sie.
Er fand das alles heraus, weil er sie von ferne beobachtete und verfolgte. Manchmal glaubte er, sie habe ihn gesehen, aber nicht beachtet. Er kam sich dumm vor und gedemütigt.
Was gingen ihn diese Schläger an, die sich in den Straßen prügelten? Mochten sie kommen, er würde mit ihnen fertig werden. Vorsichtshalber hatte er eine teleskopartige Stahlrute erworben, die er ständig bei sich trug. Illegal. Zwar fürchtete er niemand, aber die Zeiten waren unsicher, und viele Hunde können auch eines Bären Verderb sein. Dennoch verstand er Ellens Angst nicht. Mit ihrem alten Vater ging sie allein durch die Straßen. Das war gefährlich. Aber ihn schickte sie fort.
Zur Eröffnung des Cafés fuhr er nach Altona. Seine Mutter wollte es allein führen. Wilhelm blieb in der Eckkneipe. Vorsorglich. Falls das Café sich als Reinfall erweisen würde, könnte die Schnapsbude – seine Mutter fand immer neue Namen für 'Wilhelms Zeitvertreib' – zum sicheren Hort werden. Sollte aber Wilhelms Schenke den guten Ruf des bürgerlichen Cafés gefährden, würde er den Pachtvertrag mit der Brauerei unverzüglich kündigen. Das hatte er versprochen.
Für die Bahnreise hatte Georg ausreichend Lektüre mitgenommen. Obgleich Ellen unverkennbar die Nase gerümpft hatte, war er schon vor Monaten einem Buchclub beigetreten. Nun wurden ihm regelmäßig Bücher ins Haus gesandt. Georg hatte eine Vorliebe für die plötzlich in Mode gekommenen russischen Autoren entwickelt. Aber er konnte sich in seinem Zugabteil nicht konzentrieren. Seine Gedanken kreisten unentwegt um Ellen, ihren Vater, dessen Ehe mit einer Christin, Ellens Zukunftsangst und um die Frage, wie er, Georg, überhaupt in ihr Weltbild passte.
Sie war älter als er, vernünftiger, gebildeter. Warum hatte sie sich mit ihm abgegeben? In ihren Augen musste er nichts weiter sein als ein kräftiger Kellner, der bisher bestenfalls die erste Stufe der Hierarchieleiter in der Gastronomie erklommen hatte. Sein Verstand reichte gerade aus, ein paar Erörterungen über Tischdekorationen in einem Lexikon des Gastgewerbes zu verstehen. Dostojewski für interessante Literatur zu halten, fiel ihm nicht leicht, obgleich er fasziniert war von den Beschreibungen der Gedankengänge seiner Titelhelden.
Und was wollte er von Ellen? Liebte er sie? Fühlte er sich von ihrem nicht zu leugnenden Interesse an ihm geschmeichelt? Sie kannten sich fast zwei Jahre, und eigentlich war nichts zwischen ihnen geschehen. Kein Kuss, nicht einmal eine flüchtige Zärtlichkeit.
Konnte sie ihn überhaupt für einen Mann halten? Sie nannten sich immer noch bei ihren Familiennamen.
Und was war sie für ihn? Wenn er die Frage ehrlich beantwortete - - eigentlich konnte er sich nicht vorstellen, so vorbehaltlos und fröhlich mit ihr zu schlafen wie mit Marie oder mit - - . Wollte er überhaupt mit ihr schlafen? Gab es doch so etwas wie Freundschaft zwischen Frauen und Männern? Angenommen, er betrachtete sie überhaupt nicht als Frau - - was faszinierte ihn? Warum suchte er immer noch ihre Nähe? Und wie passte Marie ins Bild?
Als er den Zug verließ, hatte er nur ein paar Seiten über Raskolnikows Leben gelesen. Die längste Zeit war er in eigene Gedanken versunken gewesen. Die Antworten auf seine Fragen war er sich schuldig geblieben. Die einzige Gewissheit, die er mitnahm in die neue Wohnung seiner Eltern über dem Café, war die Erkenntnis, dass Ellen ihm umso fremder wurde, je mehr er über sie nachdachte. Er ahnte, dass all die unbeantworteten Fragen das Band zwischen ihnen – falls es jemals mehr als ein spinnwebdünner Faden gewesen sein sollte – verwirrt, wahrscheinlich zerrissen hatten.
Er suchte nach einem Gefühl des Bedauerns, nach Trauer oder Schmerz. Aber er empfand nur eine gewisse Leere – und auch die war, kaum gefühlt, schon vorbei.
Als seine Mutter, die trotz aller professioneller Härte ein gutes Gespür für seine Gefühle besaß, ihn nach Ellen fragte – sogar ihr Name war ihr noch geläufig –, schüttelte er seinen Kopf und meinte:
"Du hattest Recht. Das war nichts."
Und er wunderte sich, wie wenig er bei diesen Worten empfand.