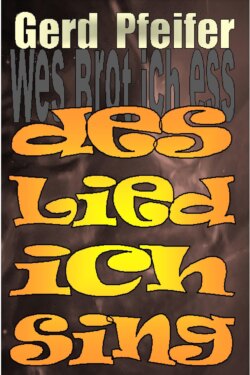Читать книгу ...des Lied ich sing' - Gerd Pfeifer - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der alte Mann sitzt an seinem Schreibtisch
Оглавлениеim Arbeitszimmer und schaut wie oft in letzter Zeit durch das Bild seiner Frau hindurch in die Ferne der Vergangenheit. Wäre er abergläubisch, er würde an seinen nahen Tod glauben. Aber noch fühlt er sich gesund, vielleicht ein wenig müde. Die Altersgebrechen, die ihn plagen, nimmt er wie seine Ärzte als natürliche Reaktion seines Körpers auf die Abnutzungen hin, die er ihm zugemutet hat. Warum soll er klagen? Die jungen Leute – und alle Leute sind jung in seinen Augen – kennen doch nur eine Erwiderung:
"Sie besitzen ein gesegnetes Alter!"
Als ob das ein Argument ist.
Die Erinnerungen, denen er neuerdings gern nachhängt, sind erfreulicher als die Gegenwart. Zwar waren die Zeiten damals nicht leichter und angenehmer auch nicht - - wahrscheinlich waren sie eher schlimmer, aber er war jung, seine Erlebnisse neu, die Erwartungen unbekümmert und das Leben eine Fundgrube glücklicher Umstände.
Heute liest er überall, dass die Zeiten damals einen Umbruch ankündigten, dass die Republik verspielt wurde und der Beginn einer neuen, schlimmeren Ära bevorstand. Er war sich dessen nicht bewusst. Zwar gab es Schlägereien auf den Straßen, Uniformen, Halstücher, Abzeichen und Armbinden in den verschiedensten Farben, Kundgebungen, Demonstrationen, Aufmärsche und Reden von vielerlei Leuten, auch in der Bierschwemme.
Aber das war nicht seine Welt. Mochten die Leute sich wegen einer dummen Idee, eines Glaubens, einer politischen Überzeugung, aus Rache oder anderen Gründen gegenseitig die Köpfe einschlagen. Ihn betraf das nicht. Er hatte keine Zeit für solchen Unsinn. Und ohnehin war Politik damals schon ein schmutziges Geschäft, mit dem er nichts zu tun haben wollte. Ebenso wenig wie heute.
Und er will nicht an gestern denken. Er muss seine Rede für die Einweihung der Georg-Schäfer-Allee vorbereiten.
Die Peters hat ihm gesagt, dass der Bürgermeister, diese politische Schlafmütze, eine Laudatio zu halten gedenke. Er wird sich einmal mehr eine ermüdende Ansprache mit einer Anhäufung platter Redensarten anhören müssen. Der Langweiler von der falschen Partei – obgleich eigentlich alle Parteien falsch sind – wird langatmig seine eigenen bürgermeisterlichen Meriten preisen und dann – gnädig – seine, des Georg Schäfers Verdienste um die Stadt etwas weniger euphorisch würdigen, das heißt, er wird die wohllöbliche Vergangenheit beschwören.
"Aber der alte Mann wird nicht mitspielen", hat er gestern zu der Peters gesagt. "Ich werde eine optimistische Rede über die Zukunft halten. Aufrührerisch und anklagend. Die verkalkten Krämerseelen der Lokalpolitiker müssen aufgeschreckt werden."
Und dann hat er ihr aufgegeben, einen frechen, aufrüttelnden Text zu entwerfen: "Genau das Gegenteil dessen, was sie von einem alten Mann erwarten."
Aber als sie den Auftrag, eine Rede vorzubereiten, an den jungen Mann weitergibt, den Georg vor ein paar Monaten eingestellt hat, 'um nicht nur alte Gesichter zu sehen', wie er ihr auf ihre verwunderte Frage nach dem Sinn eines weiteren Mitarbeiters erläuterte, dämpft sie dessen begeisterten Elan mit der simplen Feststellung:
"Lassen Sie sich nicht von seinen Frechheiten täuschen, die er hier im kleinen Kreis zum Besten gibt. Zwar kann er Politiker nicht leiden, aber er hat noch nie in der Öffentlichkeit etwas Abfälliges über sie gesagt."
Dabei würde es ihm wirklich Spaß machen, die gewählten Besserwisser der Politikerkaste zu provozieren, zu erschrecken, bloßzustellen und zu schockieren. Er weiß, dass man von ihm behauptet, er finanziere anonym Prozesse gegen die Stadt vor den Verwaltungsgerichten. Soviel ist von seiner Abneigung gegen die Gängelung durch die neidzerfressenen Kommunalpolitiker doch an die Öffentlichkeit gelangt.
Aber niemand weiß wirklich etwas darüber. Auch seine engsten Mitarbeiter nicht. Und er macht sich ein Vergnügen daraus, den Gerüchten nicht ernsthaft entgegenzutreten. Seine öffentlichen Dementis sind halbherzig. Er ist ein seniler alter Mann, vermögend, kaum verwundbar, dem seine verqueren Ansichten nachgesehen werden. Es gibt wenig Freuden im Alter. Diese gönnt er sich.
Er nimmt den Hörer seines Nostalgie-Telefons und lässt sich mit der Peters verbinden:
"Haben Sie den Text fertig?"
Die Peters ist wie vieles aus seiner engeren Umgebung ein Relikt aus der Vergangenheit. Im buchstäblichen Sinn ein Überbleibsel. Fast zwanzig Jahre ist sie jünger als er. Seit einunddreißig Jahren arbeitet sie für ihn. Über die Hälfte dieser Zeit hatten sie ein Verhältnis miteinander. Eine Zeitlang haben sie so gut wie jede Mittagspause gemeinsam in seinem Bett verbracht. Irgendwo in dem großen Bürohaus, das der Grundstein seines Vermögens ist und das ihm noch gehört, war immer ein Zimmer frei, das er sich möblieren ließ, 'um allein sein zu können', wie er behauptete. Dorthin zog er sich mittags zu einer Ruhepause zurück. Sie folgte ihm nach einer Weile.
Es war eine seltsame Beziehung. Beide waren sie verheiratet. Sie mit einem sehr viel älteren Mann; fast so bejahrt wie er. Und er mit Uta, die er praktisch seit Wilhelm juniors Geburt nicht mehr angefasst hatte.
Sie hatten beide nicht das Gefühl, Ehebruch zu begehen. Wahrscheinlich weil keine Liebe im Spiel war. Ihre Verbindung beschränkte sich auf den reinen Akt. Niemals verspürten sie das Bedürfnis, sich gegenseitig beim Vornamen zu nennen. Selten nur fielen private Worte. Meistens ging sie ins Büro zurück, bevor ihm die Augen zufielen. Es wäre ihm peinlich gewesen, in ihrer Gegenwart zu schlafen.
Nach fast siebzehn Jahren endete der sexuelle Part ihrer Beziehung. Die gemeinsamen Mittagspausen waren zur Routine geworden. Sie schliefen miteinander wie ein altes Ehepaar. Aus Gewohnheit. Aber reden konnten sie beide nicht über ihr merkwürdiges Miteinander. Damals nicht, und heute – nach so langer Zeit – erst recht nicht. Offenbar fehlen ihnen die Worte.
Sie sind beide keine Menschen, die Freundschaften schließen können. Beichtväter brauchen sie nicht. Ihre Probleme lösen sie allein. Sich anderen gegenüber zu öffnen, ist ihnen nicht gegeben, und je mehr ihnen das Alter zusetzt, umso verschlossener werden sie. Auch in ihrer Beziehung zueinander.
Nach sechzehn Jahren gemeinsamer Mittagspausen begannen sie, immer seltener 'Bis nachher' zu sagen – ihr unverfänglicher Geheimcode, mit dem sie sich verabredeten. Bis sie eines Tages merkten, dass sie ganz aufgehört hatten, sich zu treffen. Georg wusste nicht, ob sie erleichtert war oder das Ende bedauerte. Eigentlich interessierte es ihn auch nicht. Es war vorbei. Als er es ihr sagte, tropfte eine Träne in ihren Mundwinkel.
Ihr verlässliches geschäftliches Miteinander änderte sich nicht. Sie genoss sein gleichbleibendes Vertrauen. Ihre Loyalität blieb unverändert. Noch immer sind sie das eingespielte Team. Seit über dreißig Jahren.
"Ich komme wahrscheinlich nicht ins Büro", sagt er jetzt. "Sobald Sie den Text geschrieben haben, lassen Sie sich bitte hierherfahren. Den endgültigen Wortlaut können Sie hier zu Papier bringen."
"Wir sollten ein paar Kopien für die Presse ziehen", wirft sie ein.
"Dafür ist morgen früh noch Zeit."
Er legt ohne Abschiedsfloskel auf.
Für eine Minute oder so starrt er auf die Fotografie der aktiven Mitglieder des Rasensportvereins Teutonia in Altona, die altmodisch gerahmt in seinem häuslichen Arbeitszimmer hängt. Er kann sich genau an das Atelier des Fotografen und die langwierigen Vorbereitungen für die zwei Blitzlichtaufnahmen erinnern.
Dann wandern seine Gedanken zurück nach Berlin: Als sein Vater wegen eines Schlaganfalls ins Krankenhaus kam, hatte seine Mutter ihn angerufen. Zu der Zeit kamen fünf Telefone auf hundert Haushalte in Berlin. Private Ferngespräche waren teuer und wenigen Privilegierten vorbehalten. Gewöhnlich wurden Telegramme verschickt, wenn schlechte Nachrichten übermittelt werden sollten. Aber diesmal hatte seine Mutter wirklich Angst um Wilhelm. Und um sich und ihre Zukunft. Was sollte aus ihr werden, wenn Wilhelm tatsächlich stürbe? Und aus der Gaststätte? Oder ihrem Café? Solche Fragen rechtfertigten ein Telefongespräch.
Der Leiter des Personalbureaus gestattete ihm nach Rücksprache mit dem Pächter, unverzüglich nach Hamburg zu reisen. Am nächsten Abend stand er hinter der elterlichen Theke und versuchte, sich an bekannte Gesichter und ihre Namen zu erinnern.
Seine Mutter beklagte den nachlassenden Umsatz. Die Weltwirtschaftskrise wagte ihre ersten Angriffe auch auf das Geschäft mit dem Alkohol. Aber sein Vater, als er wieder halbwegs bei Verstand war, tat die Klagen seiner Frau mit einer Handbewegung ab.
"Schnaps geht immer", behauptete er. "Wenn die Leute Sorgen haben, brauchen sie Alkohol. Und wer keine Sorgen hat, macht sich welche."
Gemeinsam verachteten sie ihre besten Kunden, deren Ehefrauen am Freitag, wenn der Lohn ausgezahlt wurde, vor den Fabriktoren standen, um ihrer Männer mit der vollen Lohntüte habhaft zu werden, bevor sie in der nächsten Eckkneipe verschwanden. Oft warteten sie vergebens. Die Männer nahmen einen Seitenausgang oder hatten die Fabrik vorzeitig verlassen und einen Kollegen gebeten, ihre Stempelkarte in den Zeitautomaten zu stecken. Praktizierte Arbeitnehmersolidarität.
Es gab kaum jemand, der sich der Bitte um einen solchen Freundschaftsdienst versagen konnte. Georg wusste es, weil auch die Berliner Bierschwemme die Kontrollautomaten des Reichsausschusses für Arbeitszeitermittlung benutzte.
Seine Misshelligkeiten mit dem dürren Otto rührten nicht nur von der nassen Hose her, die er dem hageren Intriganten im Zorn bereitet hatte. Vorher schon waren sie mit Worten aneinander geraten, als Georg sich weigerte, für Otto und seine Freunde die Stempelkarten zu manipulieren.
"Ich betrüge nicht", hatte er schlicht gesagt und musste sich Kollegenschwein nennen lassen.
Länger als zwei Wochen dauerte der Krankenhausaufenthalt seines Vaters. Er riss unerwartete Löcher in den Sparstrumpf der Familie. Anschließend sollte sich der Kranke schonen. Aber bereits nach einem Tag untätigen Herumsitzens kam er zurück hinter den Tresen. Die beiden Männer teilten sich die Zeit am Zapfhahn. Sie verstanden sich besser als zuvor, besser auch als Georg erwartet hatte. Er begann, seinen Vater 'Wilhelm' zu nennen. Beide hielten den Vornamen für besser als familiäre Anreden vor der Kundschaft.
Insgesamt sechs Wochen blieb Georg in Altona, dann fuhr er zurück nach Berlin. Die Weltwirtschaftskrise hatte die deutsche Wirtschaft fest im Griff. Aber der Alkoholumsatz wurde kaum in Mitleidenschaft gezogen.
Georgs Platz im Bierpalast blieb ihm erhalten. Er wurde sogar befördert. Seine Loyalität begann sich auszuzahlen. Er bekam den Posten an der Ausgabekontrolle und machte sich noch unbeliebter bei seinen früheren Kollegen, weil er ihre Tricks kannte, die kleinen Schwindeleien und Diebstähle unterband und den Mut zu größeren Betrügereien im Keim erstickte.
Seine Vorgesetzten waren mit ihm zufrieden. Dennoch war die Verführung groß. Auch für ihn. Einer der intelligenteren früheren Kollegen machte ihm eine Art unverbindliches Angebot. Er schilderte in aller Ausführlichkeit, wie frühere Kontrolleure eine Menge Geld nebenbei verdient hatten. Die Offerte war unverfänglich formuliert; einem unvoreingenommenem Beobachter wäre der Bericht wie eine freundschaftliche Lehrstunde für den Neuling hinter dem Tresen vorgekommen, damit er nicht auf ähnliche Machenschaften hereinfiele. Georg winkte ab. Bandenkriminalität – darauf würde es letztlich hinauslaufen – war nichts für ihn.
Marie hatte er eine Ansichtskarte aus Altona gesandt und ihr in dürren Worten seine plötzliche Abreise erklärt. Sie benachrichtigte Hilde über seinen Verbleib. Dann kam er nach Berlin zurück. Hilde sah ihn hinter dem Tresen. Sie schien verlegen, mied ihn, erst seinen Blick und dann seine Gegenwart. Marie, die ihn erwartet hatte und anscheinend ausgehungert über ihn hergefallen war – Georg fühlte sich geschmeichelt –, berichtete ihm am nächsten Morgen wie nebenbei, dass Hilde während seiner Abwesenheit freiwillig zu einem professionellen Beschützer übergelaufen war.
"Ich habe ihr ins Gewissen geredet. Aber sie hatte Angst, allein zu arbeiten. Sie war nicht zu überzeugen. Nun hat sie Angst vor dir."
Georg war eher erleichtert. Zwar war es leicht verdientes Geld, als Leibwache der Mädchen durch die Absteigen der Hauptstadt zu ziehen, auch dass die Mädchen und nicht er die treibende Kraft der Zusammenarbeit waren, entlastete ihn moralisch; aber es blieb ihm doch ein fader Geschmack nach Zuhälterei auf der Zunge, wenn er in einer stillen Stunde über seinen Begleitservice nachdachte.
Gleich am nächsten Tag passte er Hilde vor der Garderobe ab und zog sie zu einer Zigarettenpause in den dunklen Hinterhof zwischen hohle Bierfässer und stinkende Abfalltonnen. Sie hatte tatsächlich Angst vor ihm. Es war eine beklemmende Situation. Für beide. Wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Er nahm seine Zuflucht zu Grobheiten:
"Du bist verrückt, wenn du fürchtest, ich könnte dir etwas antun."
Sie presste sich nur umso enger an eines der Bierfässer.
"Nun hör' schon auf, hier herumzuzittern. Ich vergreife mich nicht an kleinen Mädchen. Wenn du glaubst, einen richtigen Zuhälter zu brauchen, ist das deine Sache. Ich hoffe nur, dass du weißt, was du tust. Und komm' bloß nicht mit deinem Luden an, weil er mir einen guten Tag wünschen will."
Marie hatte die Vermutung geäußert, dass der Professionelle auf die Idee kommen könnte, ihm Hilde gleichsam abzukaufen. In was für eine Gesellschaft hatten ihn die Mädchen da gebracht! Er warf seine Zigarette fort und trat sie aus.
"Mehr wollte ich nicht von dir."
Sie schien ihm nicht zu glauben. Mit schreckgeweiteten Augen schaute sie zu ihm auf. Es war peinlich.
Erst nach einer Weile hörte sie auf zu zittern. Staunende Erleichterung zog über ihr Gesicht. Er konnte in ihrem Mienenspiel lesen wie in einem Bilderbuch.
"Du – du bist mir wirklich nicht böse?"
"Hilf, Himmel! Nein! Du kannst mit deinem Leben machen, was du willst. Ich habe damit nichts zu tun."
Er wandte sich wütend ab und ging zurück hinter seinen Tresen mit den aufgespießten Kassenbons.
Während der nächsten Wochen brachte sie ihn des Öfteren außer Fassung, weil sie glaubte, ihm Dankbarkeit erweisen zu müssen. Sie bot sich ihm an:
"Lass’ es uns machen – wie in früheren Zeiten. Ich bin nicht in Eile."
Einmal brachte sie ihm goldfarbene Manschettenknöpfe. Prächtig geschmacklos. Erst nachdem er Marie gebeten hatte, ihr die Demutsbezeugungen auszureden, konnte er wie mit den anderen weiblichen Bedienungen kollegial mit ihr verkehren.
Nach drei Monaten wurde sie fristlos entlassen und erhielt Hausverbot. Sie hatte mehreren Gästen zu offensichtlich Avancen gemacht. Er sah sie nicht wieder.
Im Dezember – es hatte den ersten richtigen Schnee gegeben und Berlin war zwei Tage lang in bräunlichem Schneematsch versunken – erhielt er einen langen Brief von seiner Mutter. Die Gäste blieben aus, klagte sie. Sein Vater sei müde, lustlos und unleidlich zu den Gästen. Und nun sei er auch noch von der Spanischen Krankheit befallen. Nur mit Mühe sei er morgens zu bewegen, sein Bett zu verlassen, und sie leide darunter, dass die Suche nach einem geeigneten Haus für ihr Café nicht weiterkomme.
Es war die unausgesprochene Bitte, nach Haus zu kommen.
Zum zweiten Mal machte er sich auf den Weg von Berlin nach Altona. Schweren Herzens diesmal, denn was sollte aus seinen eigenen Zukunftsplänen werden, wenn seinem Vater etwas zustieße? Reichten die durch Inflation und Wirtschaftskrise nun doch dezimierten Ersparnisse seiner Eltern für einen auskömmlichen Lebensabend? Und waren die Pläne seiner Mutter mit dem Café überhaupt noch realistisch?
Aber die häuslichen Verhältnisse waren weniger desolat als seine Mutter sie beschrieben hatte. Die schwere Erkältung – als nichts anderes stellte sich die angebliche Spanische Krankheit heraus – war so gut wie überwunden, als Georg in der Weihnachtswoche die mit einem nadelnden Adventskranz geschmückte Schankstube in Altona betrat. Dennoch konnte er sich eines gewissen Gefühls der Fremdheit nicht erwehren – mehr noch als bei seinem ersten Besuch nach den Jahren in Berlin. Er wunderte sich, dass sein Vater der Erste war, der diesen emotionalen Abstand von seinem Elternhaus spürte. Eigentlich hatte er erwartet, dass seine Mutter vor allen anderen wahrnehmen würde, wie er sich von ihnen löste. Aber sie schien seine Fremdheit nicht zu bemerken. Sie war völlig von der Idee gefangen, endlich ihr lang ersehntes Café zu eröffnen.
Vielleicht war es nur Wunschdenken, wenn sie unentwegt von einer gemeinsamen familiären Zukunft in ihrem Caféhaus sprach – möglicherweise wider besseres Wissen oder Ahnen. Die Gefühle seiner Mutter erschlossen sich ihm weniger als Wilhelms heimliche Wünsche nach Stille, Ruhe und Abgeschiedenheit. Er war die Säufer, die er bediente, ihre abgeschmackten Sprüche, die sich nie veränderten, die verzweifelte Sucht nach Vergessen, die seine Stammkunden immer wieder vor den Tresen trieb, einfach leid. Selbst das Geld, das er hinter der Theke verdiente, wurde ihm mehr und mehr gleichgültig. Manchmal glaubte Georg, in der scheinbaren Altersweisheit seines alten Herrn einen Hauch von Todessehnsucht zu spüren.
Noch vor wenigen Monaten wäre er damals in lautes Gelächter ausgebrochen, wenn ihm jemand derart makabre Gedanken unterstellt hätte. Sie sind unproduktiv, sogar gefährlich; davon war er überzeugt.
Aber gleichzeitig fühlte er sich von ihnen auf eine Weise angezogen, die ihm zugleich fremd und vertraut schien. Als beträte er Neuland, von dem er ahnte, dass es einmal seine Heimat sein würde. Er fühlte, dass er sich verändert hatte. Über Wilhelms Beweggründe nachzudenken, die Psyche seiner Mutter ergründen zu wollen und seinen eigenen Charakter spöttisch zu hinterfragen, waren ihm bisher nicht bekannte Beschäftigungen. Die Buchhändlerin hatte sie ihm während der letzten Monate erschlossen.
Als er das neue Lexikon des Gastgewerbes abholte, hatte er vor dem Schaufenster gewartet, bis sie eine Kundin nach einem längeren Gespräch verabschiedete. Dann ging er geradewegs zu ihr, präsentierte die Kopie des Bestellzettels und sagte:
"Ich möchte dies Buch abholen."
Anscheinend hatte sie ihn gesehen, wie er vor dem Ladengeschäft gewartet hatte. Jedenfalls meinte sie ernsthaft und ohne belehrend zu wirken:
"Sie müssen nicht draußen ausharren, wenn ich nicht frei bin. Kommen Sie herein und schauen Sie sich um." Und dann fügte sie mit einem kleinen Lächeln hinzu: "Niemand wirft Sie hinaus, wenn Sie in Büchern blättern, die Sie interessieren."
Er fühlte sich dumm und unwissend. Aber es machte ihm nichts aus. Sie wusste ohne Zweifel mehr über Bücher als er. Das war deutlich erkennbar. Auch ihr. Aber sie wurde darüber nicht herablassend. Sie war einfach nur freundlich. Er fasste Vertrauen zu ihr.
Noch in der gleichen Nacht, als er in dem neuen Buch nach Dienstschluss zu blättern begann, wusste er, dass sich das Lexikon nicht zum Durchlesen eignete. Aber es enthielt ausführliche Darstellungen von Vorgängen, die in dem ersten Buch, dem Leitfaden, nur kurz erwähnt wurden. Und der Autor beschrieb, wie die Tricks der schwarzen und weißen Brigaden in den Betrieben unterbunden werden können. Wenigstens einige von ihnen. Die meisten Abwehrmaßnahmen kannte er bereits. Bei anderen Beschreibungen musste er grinsen, weil der Autor zu naive Vorstellungen von der betrügerischen Energie eines durchschnittlichen Gaststätten-Angestellten besaß. Dennoch lernte er dazu. Und immer wieder stand ihm das Bild der Buchhändlerin vor Augen, wenn er sein Lexikon aufschlug. Wie sie ihn ansah, wie sie lächelte, als sie ihn belehrte – was sie wohl von ihm dachte? Oder war er nur ein Kunde wie viele, den sie vergaß, sobald er den Laden verließ? Kein Zweifel, sie lebten in grundverschiedenen Welten. Das ahnte er mehr als es ihm wirklich bewusst war. Dennoch wollte er sie wiedersehen. Nicht nur in dem Laden. Sein traditioneller Erfolg bei den weiblichen Bedienungen und Maries Zuneigung – und sie besaß wahrhaftig Erfahrung und hatte es nicht nötig, ihm schöne Augen zu machen – flößten ihm Mut ein.
Er ging zielbewusst, ohne die Bücher in der Auslage auch nur anzusehen, in den Buchladen, stellte sich an eines der Regale, nahm wahllos ein Buch heraus und blätterte sich durch die Seiten, ohne wirklich zu lesen. Wahrscheinlich hätte er es verkehrt herum halten können, ohne es zu bemerken. Von Zeit zu Zeit blickte er auf und suchte seine Verkäuferin. Er entdeckte sie nicht. Sie war nicht da. Er stellte enttäuscht das Buch zurück, schlenderte an einen der Tische, die in der Mitte des Verkaufsraums aufgestellt waren, nahm auch hier ein Buch in die Hand, las ein paar Zeilen, ohne sich bewusst zu werden, was da geschrieben stand, und überlegte, was er tun könne. Einfach das Buch zurückzulegen und kommentarlos aus dem Laden gehen, erforderte zu viel Selbstbewusstsein. Er fühlte sich jetzt schon beobachtet. Als ob die Blicke des gesamten Ladenpersonals auf ihn gerichtet seien. Alle schienen zu wissen, dass er nicht hierher gehörte.
Sollte er nach der Buchhändlerin fragen? Er kannte ja nicht einmal ihren Namen. Es wäre auch zu privat. Er würde sich lächerlich machen. Hatte in der Bierschwemme jemals ein Gast nach ihm oder nach seinem Namen gefragt? Aber was konnte er sonst tun? Schon viel zu lange stand er an diesem Tisch.
Schließlich kam ihm die rettende Idee. Ein Verkäufer, der ihn bereits abschätzend in Augenschein genommen hatte, wie er glaubte, stand in der Nähe. Er wandte sich ihm zu und fragte nach dem Lexikon des Gastgewerbes, das er bereits besaß. Sie hatten es beim ersten Mal, als er es direkt kaufen wollte, nicht auf dem Lager gehabt; wahrscheinlich stand es auch heute in keinem ihrer Regale. Hoffentlich.
Er hatte Glück. Der Verkäufer sah nach, kam zurück und bedauerte:
"Wir haben es leider nicht vorrätig."
Dann bot er ihm an, es zu besorgen. Aber Georg winkte ab, bedankte sich und verließ den Laden. Draußen atmete er erleichtert auf.
Es dauerte länger als eine Woche, ehe er sich wieder in die Nähe des Buchladen wagte. In der Zwischenzeit überlegte er, ob sie wohl die Stellung gewechselt habe. Vielleicht war sie längst in einer anderen Buchhandlung beschäftigt. Dann hätte er sie verloren. War das wichtig? Warum? Sie war eine Buchhändlerin, die ihm ein Lexikon verkauft hatte. Nichts weiter.
Aber er wollte sie wiedersehen. Dessen war er sicher, und er verbot sich, tiefer nach seinen Gründen zu graben. Er mochte sie. Na, und? Warum suchte er nach Gründen? Das war müßig. Begründungen gibt es immer. Für alles.
Diesmal sah er sie schon von weitem durch die Schaufensterscheibe. Er beobachtete sie, halb verdeckt durch die Auslagen. Dennoch bemerkte sie ihn. Kopfschüttelnd. Er verstand die Geste nicht. Schüttelte sie ihren Kopf verständnislos wegen seines absonderlichen Verhaltens – das war sein erster, beinahe schuldbewusster Gedanke – oder wollte sie ihm bedeuten, dass sie keine Zeit für ihn habe? Alles an ihr war ihm fremd: ihre natürliche, selbstbewusste Haltung; dabei war sie auch nur als Verkäuferin beschäftigt; ihr selbstverständlicher Umgang mit belesenen Leuten; ihre Anmerkungen zu seinem Benehmen, aus dem sie erkannte, wie fremd ihm der Umgang mit Büchern war. Sie lebte wirklich in einer anderen Welt – und war ihm dennoch merkwürdig vertraut.
"Warum verstecken Sie sich?", fragte sie, als er vor ihr stand. Wieder mit diesem Lächeln, das ihn auf einem anderen Gesicht wahrscheinlich verletzt hätte.
"Ich habe mich nicht versteckt", antwortete er fast trotzig. Das war nicht die Wahrheit. Sie wussten es beide. Er sah es in ihren Augen, und da musste er ebenfalls lachen. "Und ich will kein Buch kaufen", fügte er mutig hinzu.
Sie schaute ihn fragend an, aber so als wisse sie, was er als nächstes fragen und was sie darauf antworten würde. Sie war sich ihrer so sicher. Und er zögerte wie ein dummer Junge vor einer großen Entscheidung. Schließlich sprudelte es wie auswendig gelernt aus ihm heraus, und wahrscheinlich war ihr völlig klar, dass er den Satz tatsächlich geprobt hatte:
"Ich habe heute Nachmittag frei. Können wir zusammen eine Tasse Kaffee trinken? Oder etwas anderes? Was immer Sie möchten."
Das Gefühl, ein schüchterner Idiot zu sein, breitete sich unaufhaltsam in ihm aus. Und vertiefte sich noch, als er es bemerkte. Aber er würde es sich nie verzeihen können, wenn er die Frage nicht gestellt hätte. Erwartungsvoll schaute er sie mit großen Augen an. Bis er es merkte, weil sie ihn lächelnd und prüfend zugleich anblickte. Da ließ er gelangweilt seinen Blick über die Bücherregale gleiten. Dennoch sah er aus den Augenwinkeln, wie ihre Lider ein Mal, zwei Mal kurz flatterten. Er wollte nicht glauben, dass sie sich über ihn lustig machte. Schließlich nickte sie, und er hätte beinahe blöd und wie befreit gegrinst. Sie blickte auf die große Uhr über der Kasse und meinte freundlich und gar nicht überrascht:
"In zehn Minuten kann ich eine Pause machen. Wenn wir in der Nähe bleiben, wird es für eine Tasse Kaffee reichen."
"Ich warte draußen", erklärte er schnell und bevor sie ihn auffordern konnte, in einem der vielen Bücher zu blättern. Er wusste nicht, was er hätte antworten sollen, wenn ihn jemand gefragt hätte, was er da an den Regalen treibe.
Sie nickte, ahnte wohl seine Unsicherheit und wandte sich ab.
Pünktlich nach zehn Minuten kam sie aus dem Laden. Sie sah ihn sofort auf der gegenüberliegenden Straßenseite und kam mit ungewöhnlich ausgreifenden Schritten trotz ihres langen, engen Rocks auf ihn zu. Bevor er etwas sagen konnte, schlug sie ein kleines Stadtteil-Café gleich um die Ecke vor:
"Sie machen einen guten Kaffee, und wir müssen nicht lange laufen", begründete sie ihre Wahl.
Weiter als bis zu seiner Einladung hatte er sich das Treffen mit ihr nicht ausgemalt. Für den Fall einer abschlägigen Antwort hatte er sich einen ehrenvollen Abgang ausgedacht. Aber für mehr hatte seine Fantasie nicht ausgereicht. Nun musste er improvisieren. Und er hatte keine Ahnung, worüber er mit einer Buchhändlerin sprechen könnte. Wahrscheinlich war es aussichtslos, ihr mit irgendetwas imponieren zu wollen. Womit könnte er sich in ihren Augen schon hervortun? Seine Kellnerprobleme würden sie wohl kaum interessieren. Eigentlich zum ersten Mal wurde ihm so richtig bewusst, dass er ein Leben wie Millionen anderer führte. Nichts hob ihn aus der Masse heraus. Es gab nichts, worauf er besonders stolz hätte sein können, nichts, womit er ihr Interesse wecken konnte. Er überließ ihr die Gesprächsführung. Vielleicht zählte sie ja trotz ihrer intellektuellen Überlegenheit, die er ohne Zögern anerkannte, zu jenen Menschen, die gern über sich reden. Er hatte die Erfahrung gemacht, dass dieser Versuchung kaum jemand widerstehen kann.
Im Preußischen Verein für Kraftsport, dem er hier in Berlin beigetreten war und in dessen Sporthalle er mit den aktiven Gewichthebern trainierte, um nicht aus der Übung zu kommen, gab es einen Arzt, einen richtigen Doktor, der tatsächlich nur ein Thema kannte: Doktor Maximilian Windhorst. Alle machten sich über ihn lustig – selbst in seiner Gegenwart, wenn er von seinen Erlebnissen mit Kranken, Kollegen und Schwestern, von seinen Absichten, Gefühlen und Erfahrungen berichtete. Den meist gutmütigen Spott nahm er gelassen hin. Nichts war ihm wichtiger als eine hingerissene Zuhörerschaft. Und nichts und niemand bedeutete ihm mehr als Doktor Windhorst.
Aber die Buchhändlerin, die seinen Namen und selbst seine Adresse durch die Buchbestellung kannte, die er selbst aber noch nicht nach ihrem Namen gefragt hatte, wich allen direkten oder versteckten Fragen nach ihrem Leben aus. Lieber ließ sie sich von ihm erzählen, wie er die Wirklichkeit erlebte.
"Was treiben Sie?", fragte sie ihn. "Beruflich, zum Beispiel?"
Für einen Augenblick zögerte er und überlegte, ob er ihr tatsächlich von seinem eher tristen Leben, von seinem nichtssagenden Elternhaus und von seinen Plänen für die Zukunft wahrheitsgemäß berichten sollte. Es wäre ein Leichtes gewesen, ihr strahlende Lügen über seine Lebensumstände aufzutischen. Aber er hätte damit nur eingestanden, dass er sich seines wahren Lebens schämte. Er entschied sich, nicht zu lügen. Es wäre nicht richtig gewesen. Trotz aller Durchschnittlichkeit, die sein Leben bestimmte – er wollte kein Anderer sein. Er war Georg Schäfer. Entweder sie akzeptierte ihn, wie und was er war, oder sie machte sich über ihn und sein Mittelmaß – wenn er es denn überhaupt besaß – lustig. Dann würde er sie auch mit Lügen nicht beeindrucken können. Nicht auf Dauer.
Also erzählte er ihr brav von seinen Eltern, von ihrer Kundschaft, von seines Vaters überstandener Krankheit, von seinem eigenen Verlangen, dem Dunstkreis des Schankraums in Altona zu entkommen, und dass er in der Neuköllner Bierschwemme doch im gleichen Milieu geblieben war. Über Hilde und Marie verlor er kein Wort. Und auch seine Zukunftspläne behielt er weitgehend für sich.
"Ich habe nur über mich geredet", entschuldigte er sich, als sie zur Uhr schaute. Sie trug eine kleine goldene Uhr mit einem Milanese-Armband. Bei Hilde oder Marie hätte er gewusst, dass es Messing oder ein anderes goldfarbenes Metall wäre, aber sie trug wahrscheinlich echtes Gold.
"Dabei weiß ich nicht einmal, wie Sie heißen", fuhr er mutig fort.
Diesmal entschuldigte sie sich, blickte ihn prüfend an, als überlege sie, ob er es wert sei, ihren Namen zu erfahren, und antwortete nach einem kurzen Zögern:
"Ich bin Ellen Charlotte Kleeberg."
Immer noch schaute sie forschend in seine Augen, als erwarte sie eine bestimmte Reaktion. Er fühlte sich unsicher unter ihrem Blick, wusste nicht, womit sie rechnete und trat einfach die Flucht nach vorn an:
"Müsste ich Sie kennen? Sind Sie irgendwie bekannt? Oder Ihr Vater?"
Sie schüttelte den Kopf und lachte seltsam befreit auf:
"Nein, ich bin keine bekannte Person. Ich habe nur mit einer anderen Reaktion gerechnet."
Aber was sie eigentlich erwartet hatte, wollte sie nicht sagen. Auf alle Fragen schüttelte sie nur lächelnd ihren Kopf.
Er gestattete ihr nicht, den Kaffee zu bezahlen. Es gab eine kurze Diskussion. Aber er setzte sich durch.
Auf dem Weg zurück in die Buchhandlung nahm sie seinen Arm und erzählte von ihren Kollegen, die stolz waren auf das Wissen, das sie sich angelesen hatten. Nun versuchten sie, ihr mit der durch den Umgang mit Büchern erworbenen Urteilskraft zu imponieren. Georg fühlte sich – wieder – ihr und ihrem Umkreis hoffnungslos unterlegen. Aber er lachte mit ihr über die kleinen Angebereien der Männer aus der Buchhandlung, über die sie sich lustig machte, ohne bewusst verletzend zu sein. Sie schien ihn, den Gastwirtssohn, der stolz auf den Besitz zweier Bücher war, zu mögen.
Die gemeinsamen Besuche des kleinen Cafés wurden zu einer ständigen Einrichtung. Wenn es ihm möglich war, tagsüber eine Stunde Pause zu machen, fuhr er mit der S-Bahn bis zum Kurfürstendamm, ging ein paar Minuten zu Fuß bis zur Buchhandlung, machte Ellen auf sich aufmerksam, sie nickte, und nach ein paar weiteren Minuten verließ sie den Laden. Gemeinsam schlenderten sie dann in das Café, tranken Kakao, Tee oder Kaffee, unterhielten sich angeregt, bis es für Ellen Zeit wurde, in die Buchhandlung zurückzukehren. Dann gingen sie den gleichen Weg gemächlich zurück und nachdem sie im Laden verschwunden war, sprang er auf die nächste Bahn und fuhr zurück hinter seinen Tresen und die Spieße mit den Ausgabebons.
Ihn verlangte nicht nach mehr. Es schien, als ob Doktor Max, wie der egomanische Assistenzarzt ein wenig spöttisch im Preußischen Verein für Kraftsport e.V. genannt wurde, Unrecht hatte, als er behauptete, dass es Freundschaft zwischen Männern und Frauen nicht geben könne.
Allerdings war es für Georg einfach, wenn er sich mit Ellen auf Gespräche über Bücher und seine Gedanken über die Welt und sein Leben beschränkte – bis vor Kurzem hätte er nicht geglaubt, dergleichen überhaupt führen zu können –, denn für die mehr körperliche Kommunikation gab es ja Marie. Mit ihr hatte er stillschweigend ein Arrangement getroffen, das beide zufriedenstellte. Er war liebenswürdig zu ihr und gab ihr ein wenig Sicherheit in ihrem unsteten Leben. Vielleicht hielt sie seine Höflichkeit sogar für eine Art Liebe, auch wenn er den kompromittierenden Satz nie ausgesprochen hatte. Auch nicht in den intimsten Augenblicken. Jedenfalls erhielt sie, wofür sie ihn bezahlte: Schutz. Und auch er bekam, was er wollte: etwas Zweisamkeit, Geld, ein wenig Abwechslung und eine Menge Lust. Es war ein brauchbares Übereinkommen.
Seine Zusammenkünfte mit Ellen dagegen schienen wie von einem anderen Stern. Und auch ihre Gespräche handelten selten von ganz alltäglichen Dingen. Manchmal glaubte Georg, da sei ein Band zwischen ihnen. Sie verstanden sich. Auch ohne Worte. Dann schauten sie schweigend aus dem mit gerafften Tüllgardinen verhängten Fenster des kleinen Cafés, und wenn ihre Blicke sich trafen, lächelten sie einander zu, ohne sich verpflichtet zu fühlen, etwas zu sagen.
Ellen ging jeden zweiten Tag in der Woche zu einem Gesangslehrer. Singen war ihre große Leidenschaft. Aber man sah es ihr nicht an, fand er. Sie trug keine langen Schals, trällerte nicht ständig bekannte Melodien vor sich hin, redete nicht über absolutes Gehör oder Stimmschonung – kurz, sie benahm sich wie ein normales Mädchen.
Die Künstler, die er kannte – wenn sie nach Vorstellungsschluss noch auf ein Bier mit großem Getöse den halben Gastraum in Altona unterhielten und Wilhelm wie einen alten Freund behandelten –, waren alle ein wenig verrückt. Jedenfalls taten sie so. Er berichtete ihr von den lärmenden Leuten mit den weiten Abendmänteln und ihren Gepflogenheiten. Ellen hatte gelacht und gemeint, dass sie keine Künstlerin sei.
"Ich bin Buchhändlerin. Singen ist Freizeitvergnügen."
Er glaubte ihr nicht.
"Niemand geht drei Mal in der Woche zum Gesangsunterricht nur zum Zeitvertreib."
Da gab sie zu, dass sie ein Abkommen mit ihrem Vater getroffen habe. Sie hatte ihm versprochen, zunächst einen ordentlichen Beruf zu erlernen, weil eine moderne junge Frau auch allein im Leben stehen können muss. Danach dürfe sie eine künstlerische Laufbahn einschlagen.
"Nun habe ich einen ordentlichen Beruf. Glücklicherweise. Aber die Wirtschaftskrise lässt es nicht zu, dass ich ihn aufgebe und ein Konservatorium besuche. Die Geschäfte meines Vaters gehen nicht so gut. Ich muss meinen Beitrag zum Familieneinkommen leisten."
Sie lächelte bedauernd und ein wenig hilflos.
Ihr Vater, berichtete sie weiter, sei Apotheker, der wie die meisten berufstätigen Menschen unter der Wirtschaftskrise zu leiden habe.
"Wir sind wahrscheinlich nicht arm", meinte sie, "aber es ist auch nicht so, dass wir im Wohlstand schwelgen. Vater will sich nicht an den Leiden der Kranken bereichern. Er steht in dem Ruf, Arzneimittel auch kostenlos abzugeben, wenn es ihm notwendig erscheint. Entsprechend hat sich seine Kundschaft entwickelt."
Sie vertieften das Thema nicht. Alle litten unter dem Niedergang der Wirtschaft. Über Deutschland, den Versailler Vertrag, die Reparationszahlungen, Innen- oder Außenpolitik sprachen sie nicht. Es wäre lachhaft gewesen, mit Ellen die Weltlage zu erörtern. Darüber hinaus besaß er keinerlei politische Überzeugung. Richtig war, was der jeweilige Gast meinte.
An dem gleichen Abend begleitete er Marie. In dem etwas weniger als üblich heruntergekommenen Hotel, in dem er auf sie wartete und das sogar zwei korbgeflochtene Sessel, eine echte Palme und eine Handvoll Pfauenfedern auf geschnitzten Blumenständern in jeder Etage besaß, stellte er sich vor, wie es wäre, nicht mit Marie, sondern mit Ellen zusammen zu leben, ihr Gesangstudium zu finanzieren, mit ihr zu schlafen und für sie eine Opernkarriere zu arrangieren.
Es war eine absurde Vorstellung. Er schimpfte sich ernsthaft einen Narren. Sie sei älter als er, hatte sie behauptet, nachdem er von seinen Lebensumständen berichtet hatte. Das war nicht wichtig, fand er. Für schwerwiegender hielt er die Tatsache, dass sie aus völlig unterschiedlichen Sphären stammten. Ellens Vater war Apotheker. Zwar unterscheidet sich die Tätigkeit eines Apothekers nicht grundsätzlich von der eines Gastwirts – beide betrügen die Kunden mit dem Inhalt ihrer Flaschen und Gläser, war seine Überzeugung –, aber so ein Provisor handelt auf einer akademischen Ebene, während Georg und sein Vater ungebildete Leute mit ordinären Kunden waren. Er spürt es an jedem Satz, den sie ordentlich und druckreif zu Ende spricht, während er Halbsätze stammelt, deren Inhalt nur errät, wer weiß, was er eigentlich sagen will. Sie hat es ihm nicht so deutlich gesagt, aber unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass er seine Sprache verbessern müsse. Es ist ein Wunder, dass er nicht beleidigt war.
Sie begann, ihm Bücher mitzubringen, die sie bereits gelesen hatte, und forderte ihn auf, sich eine Meinung zu bilden und darüber zu sprechen.
"Sie sollten nicht nur Fachbücher lesen, sondern auch Belletristik", sagte sie.
Er wusste nicht, wovon sie sprach. Aber er merkte sich das Wort, schlug seine Bedeutung in einem Konversationslexikon nach, das er sich in einer anderen Buchhandlung gekauft hatte, und benutzte es bei der nächstbesten Gelegenheit selbst. So lernte er, dass es unterschiedliche Literaturgebiete gibt, erweiterte seinen Wortschatz, übte sich im Argumentieren und erwarb sich eine gewisse Eloquenz. Selbst dies Wort kannte er inzwischen.