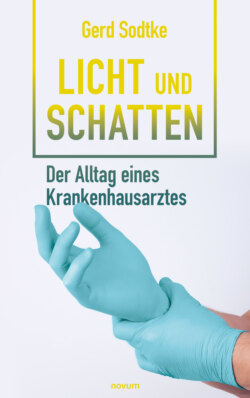Читать книгу Licht und Schatten – der Alltag eines Krankenhausarztes - Gerd Sodtke - Страница 12
Оглавление8 Ungeklärte Fieberschübe
Nun war ich bereits einige Jahre an diesem Krankenhaus tätig. Ich hatte viel erlebt, gründliches Arbeiten gelernt, die täglichen Herausforderungen wurden langsam zur Routine. Bisweilen konnte es dennoch geschehen, dass man bei einer vermeintlichen Routinearbeit auf den Boden der Wirklichkeit zurückgeholt wurde.
Meine neue Patientin war erst wenige Tage zuvor aus dem Krankenhaus eines Nachbarortes entlassen worden, wo sie zehn Tage lang wegen einer Lungenentzündung behandelt worden war. Kaum zu Hause angekommen, hatte sie nach wenigen Tagen erneut Fieber entwickelt. Der Hausarzt hatte sie darauf in unsere Klinik eingewiesen. Auf das vorherige Krankenhaus war sie aus verständlichen Gründen nicht so gut zu sprechen.
Sie sollte eine sehr geduldige Patientin werden. Sie war vielleicht 55 Jahre alt, groß gewachsen, von schlanker Statur, und dichte, pechschwarze, relativ kurz geschnittene Haare umrahmten ihr blasses Gesicht. Sie war eine höfliche Person, bescheiden, auffallend still, sehr ernst, das Lachen war ihr offenbar vergangen. Sie war bisher immer gesund gewesen, die Mandeln waren vor langer Zeit operiert worden, in relativ jungen Jahren hatte sie einen Herzschrittmacher bekommen, darüber hinaus bot ihre Vorgeschichte keine Auffälligkeiten.
Nun hatte sie also wieder hohes Fieber, nur wenig Husten ohne Auswurf, und in der Blutuntersuchung fanden sich hohe Entzündungswerte und eine leichte Blutarmut, die ihre Gesichtsblässe erklärte. Eine solche Blutarmut ist bei chronischen Infekten nicht ungewöhnlich. Die Röntgenaufnahme zeigte eine etwas ungewöhnliche Lungenentzündung mit einer eher keilförmigen Verschattung. Die übrigen Untersuchungen, auch das EKG, waren in Ordnung, ganz überwiegend handelte es sich um Impulse des Herzschrittmachers, dessen Unterstützung sie wohl dringend benötigte. Die wenigen körpereigenen Herzaktionen im EKG zeigten keine Auffälligkeiten.
Da sie bereits in dem auswärtigen Krankenhaus Antibiotika bekommen hatte, entnahm ich zunächst Blutkulturen. Dabei wird eine Blutprobe in ein Blutkulturfläschchen gegeben, das eine Nährlösung enthält, auf der die Bakterien wachsen können, wenn welche vorhanden sind. Die Blutkulturflaschen wurden im Brutschrank warm gehalten und mit dem nächsten Transport in ein Speziallabor gesandt. Sollten Bakterien enthalten sein, so könnte man feststellen, um welche Bakterien es sich handelt, und das wirksame Antibiotikum austesten. Die Blutkulturen waren jedoch negativ, so erfuhren wir einige Tage später. Negativ im medizinischen Sprachgebrauch bedeutet, dass keine Bakterien gefunden worden waren.
Wir waren also gezwungen, ohne einen Erregernachweis eine Antibiotikatherapie zu beginnen. Das Fieber fiel zwar ein wenig, das Röntgenbild mit seiner keilförmigen Verschattung blieb jedoch völlig unverändert. Diese Keilform störte uns ungemein, denn eine Lungenentzündung hätte eine eher wolkige, flächenhafte Verschattung im Röntgenbild hervorgerufen. Wir ließen daher eine spezielle Lungenuntersuchung, ein Szintigramm, anfertigen: Dieses zeigte einen Lungeninfarkt, also das Resultat einer Lungenembolie. Bei der Lungenembolie wird eine Lungenarterie durch ein Blutgerinnsel verschlossen, sodass dieser Bereich der Lunge nicht mehr durchblutet wird und dadurch ein idealer Nährboden für die Ansiedlung von Bakterien entsteht. Allerdings lag eine Beinvenenthrombose als Ausgangspunkt des Blutgerinnsels nicht vor. Wir ergänzten die Therapie durch ein zweites Antibiotikum und begannen eine blutverdünnende Therapie, um die Durchblutung in der verstopften Arterie zu verbessern und um weitere Embolien zu verhindern.
Diese Erweiterung der Therapie zeigte nun endlich Wirkung. Die Patientin entfieberte vollständig, die Röntgenkontrolle war in Ordnung. Die Patientin fühlte sich deutlich besser, und das Lächeln in ihren Augen kehrte zurück. Allerdings störte mich, dass die Entzündungswerte im Blut keinerlei Besserungstendenz zeigten.
Der Frieden währte leider nicht sehr lange. Nur eine Woche später kam der Rückschlag: erneuter steiler Fieberanstieg, Schüttelfrost, diesmal Husten mit eitrigem Auswurf. Nun zeigte das Röntgenbild eine typische Lungenentzündung, allerdings in der anderen Lungenseite! Neben der körperlichen Schwäche durch den neuerlichen hochfieberhaften Infekt war die Patientin niedergeschlagen, ihre aufkeimende Hoffnung auf eine dauerhafte Genesung war verflogen, sie war enttäuscht, fast deprimiert. Sie wurde von Tag zu Tag stiller und besorgter, sie hatte berechtigte Angst um ihren Gesundheitszustand.
Nichts kann aus Sicht von Patienten so quälend und lähmend sein wie Ungewissheit, aus Sicht eines Arztes in gewisser Weise auch, wobei die „Lähmung“ des Arztes eher einem Ansporn weicht, die korrekte Diagnose zu finden. Ungewissheit beherrscht die Gedanken, setzt sich im Kopf fest und raubt den Schlaf. In dem Maß, in dem die Ungewissheit wächst, sinkt der Glaube an eigene Stärke. Diese Ungewissheit kann sicherlich zermürbender sein als selbst die Kenntnis einer sehr ungünstigen Diagnose. Es schien so, als ob die Patientin an genau diesem Punkt angelangt war. Wir führten ausführliche Gespräche, ich versuchte, sie in jede unserer Überlegungen und Entscheidungen mit einzubeziehen. So entwickelte sich eine sehr offene, ehrliche Beziehung zwischen Arzt und Patientin. Sie blieb geduldig, sie vertraute uns. Und mir ließ sie keine Ruhe. Patienten mit einem solch ungeklärten Krankheitsverlauf verfolgten mich gedanklich nicht selten bis in meine eigenen vier Wände.
Also setzte ich mich zu Hause spät abends vor dem Schlafengehen noch vor meinen großen, alten Bücherschrank und durchstöberte mehrere dicke internistische Fachbücher nach Erkrankungen mit wiederkehrenden Fieberschüben, zum Beispiel verschiedene rheumatische Erkrankungen, wie auch viele andere Krankheiten. Draußen war es bereits Nacht geworden, durch die geöffnete Balkontüre wehte ein Hauch frischer Nachtluft in den Raum. Die zugezogenen Vorhänge wiegten sich leise im Wind. Hin und wieder bellte draußen ein Hund auf der Straße, ein später Heimkehrer fuhr mit dem Auto vorbei. Ein aufgeschreckter Vogel flog laut rufend durch den Garten. Im Haus war es ganz still, meine Familie schlief schon lange. Für den kommenden Tag machte ich mir einige Notizen für ergänzende Blutuntersuchungen, bevor ich mein nächtliches Studium beendete.
Ich war zu dem Ergebnis gekommen, dass der Schüttelfrost, der die Fieberschübe meiner Patientin begleitete, wie auch die Höhe des Fiebers eindeutig für eine bakterielle Infektion sprachen, obwohl wir diese Bakterien bislang noch nicht hatten nachweisen können. So macht man sich als Arzt auch in seiner Freizeit weit mehr Gedanken, als mancher Patient glauben mag. Besonders die ungeduldigen Patienten, oder eben auch Patienten mit einem langwierigen Krankheitsverlauf, ließ ich bisweilen einmal wissen, dass sie mich bis in solche späten Nachtstunden beschäftigten. Hierdurch wich häufig ihre Ungeduld einem besseren Verständnis für die besonderen Herausforderungen der Diagnosestellung und Behandlung.
Selbst der alte, erfahrene Chefarzt war mittlerweile ziemlich ratlos. Bei seiner nächsten Visite ordnete er an, dass sämtliche Untersuchungen bei unserer Patientin zu wiederholen wären. Dazu gehörten leider auch die Erhebung der Krankenvorgeschichte und der körperliche Untersuchungsbefund. Vor meinen Augen, aber wenigstens nicht vor der Patientin, zerteilte er meine zeitaufwendig und akribisch ausgefüllten mehrseitigen Formulare in immer kleinere Schnipsel. Ungläubig und hilflos stand ich daneben und musste die Vernichtung meiner Aufzeichnungen mit ansehen. Es half nichts, wir mussten noch einmal ganz von vorne beginnen. Wir ließen die Patientin bewusst auffiebern, indem wir die bisherigen Antibiotika vollständig absetzten, und nahmen dann erneute Blutkulturen sogar auch nachts zum Zeitpunkt des Fiebergipfels ab. Inzwischen vermuteten wir schon, dass irgendwo im Körper dieser Patientin sozusagen ein Nest oder Depot von Bakterien sitzen musste, aus dem die Bakterien mit dem Blutstrom in andere Organe, in diesem Fall die Lunge, geschwemmt wurden. Dieser Vorgang wird Sepsis, im Volksmund Blutvergiftung, genannt. Die Sepsis ist unbehandelt ein lebensgefährliches Krankheitsbild. Nur fehlte uns dafür eben der Beweis, wir mussten zwingend die Bakterien im Blut finden. Auch das Ergebnis der mehrfach entnommenen neuen Blutkulturen blieb jedoch negativ. So setzten wir abermals ohne Bakteriennachweis ein anderes Antibiotikum ein und hatten Erfolg, auch diese Lungenentzündung bildete sich zurück. Alle, die Patientin, und nicht zuletzt auch wir Ärzte, waren erleichtert und guter Hoffnung.
Es folgte der nächste Fieberschub mit Schüttelfrost! Mittlerweile wurde der Krankheitsverlauf der Patientin natürlich im Arztkollegium bei den täglichen Besprechungen intensiv diskutiert, und wir kamen zu der Entscheidung, sie in die Uniklinik zu verlegen. Wir waren bei diesem ungeklärten Krankheitsverlauf deutlich an unsere Grenzen gestoßen, traten auf der Stelle, waren keinen Schritt weitergekommen.
Nur drei Tage nach der Verlegung erhielt ich von demjenigen Kollegen in der Uniklinik, dem ich den schwierigen Fall bereits vorab telefonisch ausführlich geschildert hatte, eine Rückmeldung: „Wir haben sofort neue Blutkulturen abgenommen, es wurden Streptokokken nachgewiesen.“ Mir verschlug es die Sprache. Ungläubig dachte ich darüber nach, wie das möglich sein konnte. In unseren zahlreichen Blutkulturen war nie der Nachweis von Bakterien gelungen. Wir waren also sehr wohl auf dem Weg zur richtigen Diagnose gewesen, aber die Blutkulturen hatten versagt. Wo konnte nur der Fehler liegen? Lag es an der Nährlösung in den Blutkulturflaschen, oder waren sie im Labor nicht adäquat angesetzt und untersucht worden, oder hatten sie auf dem Transport in das Fremdlabor gelitten? Und wie sollten wir überhaupt zukünftig vorgehen, wenn unsere Blutkulturen regelmäßig versagten? Ich war mehr als enttäuscht und auch erzürnt, unsere ganze wochenlange Mühe war vergeblich geblieben.
Solche Fragen musste ich immer sofort klären, ich führte zahlreiche Telefonate mit unserem eigenen Labor, wie auch mit dem Fremdlabor in der Mikrobiologie. Im Endeffekt habe ich das Rätsel der erfolglosen Blutkulturen nicht lösen können. Einige Wochen später erhielten wir allerdings neue Blutkulturflaschen von einer anderen Herstellerfirma, möglicherweise als direkte Folge dieser Geschichte. Die neuen Blutkulturen funktionierten dann einwandfrei, wir erhielten mit ihnen genau die Ergebnisse, die zu erwarten waren.
Der Nachweis ausgerechnet von Streptokokken, die sich auf den Kulturnährböden gerne kettenförmig anordnen und daher ihren Namen tragen, ist nicht so günstig, können sie doch allzu häufig zu einer Herzmuskelentzündung führen. Dies kann eine sehr heimtückische Krankheit sein, da sie nicht immer, wie eben auch bei unserer Patientin, im EKG zu erkennen ist. Und die Ultraschalldiagnostik des Herzens steckte damals gerade erst in ihren Anfängen. Mit Ultraschall hätte man die Diagnose leichter stellen können, da sich die Bakterien allzu gerne auf den Herzklappen ansiedeln.
Etwa drei Monate später kam die Chefarztsekretärin freudestrahlend, mit einer Tageszeitung über ihrem Kopf wedelnd, auf dem Stationsflur geradewegs auf mich zugelaufen. Sie war eine kleine, lebhafte Person, durchaus gutmütig, äußerst redselig und furchtbar neugierig. Sie musste ihre Nase rein überall hineinstecken, und dank dieser ungewöhnlichen Veranlagung wurde sie für uns Assistenzärzte zu der wichtigsten Informationsquelle unserer Abteilung. Nur die letzten Neuigkeiten der obersten Führungsebene, die sie nebenbei aufschnappte, behielt sie natürlich für sich, um sich keinen Ärger einzuhandeln. Über das aktuelle Stimmungsbarometer des Chefarztes waren wir aber stets zuverlässig informiert, ein nicht zu unterschätzender Vorteil besonders vor einer angekündigten Chefarztvisite. Ihre eigentlichen Pflichtaufgaben als Chefsekretärin erledigte sie im Handumdrehen, ihre flinken Finger flogen in einer schwindelerregenden Geschwindigkeit über die Tastatur des Computers. Ich hegte schon den ernsthaften Verdacht, dass sie sich dieses rasante Arbeitstempo nur angeeignet hatte, um genügend Zeit für ihr Hauptinteresse, nämlich den gepflegten Informationsaustausch, zu finden. Oftmals begann sie ihre Vorträge mit den bedeutsamen Worten „Stellen Sie sich nur vor …“ oder „Haben Sie schon gehört …?“, worauf postwendend ein ausführlicher Bericht über die letzte Neuigkeit folgte.
An diesem Morgen rief sie mir also bereits von Weitem auf dem Stationsflur entgegen: „Haben Sie heute schon die Zeitung gelesen? Schauen Sie mal, was ich gefunden habe, Herr Doktor!“ Sie tippte mit der Spitze ihres rechten Zeigefingers auf eine Zeitungsannonce, die klein gedruckt, aber schwarz umrandet war. Ich beugte mich interessiert über die Zeitung, in der schwarz auf weiß geschrieben stand: „Herzlichen Dank sage ich meinen Lieben zu Hause, meinen Verwandten und Freunden nah und fern, die während meines langen Krankenhausaufenthaltes an mich dachten. Danken möchte ich auch Dr. Sodtke und den Schwestern der Station IC und Dr. S. wie der gesamten 1. Med. Abt. der Uniklinik Düsseldorf.“ – Unterschrift meiner Patientin. Diese öffentliche Danksagung war insofern mehr als erstaunlich, als wir durch das Versagen unserer Blutkulturen rein gar nichts zu der eigentlichen Diagnosefindung hatten beitragen können. Wir hatten lediglich die wiederkehrenden Lungenentzündungen behandelt, ohne aber die Ursache dafür zu finden.
Nur wenige Tage nach dem Erscheinen dieser Annonce rief sie mich an, und ich erfuhr das vorläufige Ende ihrer ungewöhnlichen Leidensgeschichte. Als Ursprung ihrer wiederholten Blutvergiftungen hatte man die Sonde des Herzschrittmachers identifiziert, von dort aus waren die Bakterien (Streptokokken) immer wieder in ihr Blut gelangt. Die Sondenspitze ihres Herzschrittmachers lag korrekt am Boden der Herzkammer, war dort mit einem winzigen Drahthäkchen im Herzmuskel verankert worden und im Laufe der Jahre wohl vollständig in den Muskel eingewachsen. So musste die Sonde unter dem Schlüsselbein, wo sie an die Schrittmacherbatterie unter der Haut angeschlossen war, freigelegt und mit Gewichten ein dauerhafter Zug ausgeübt werden, damit sich die Sondenspitze lockerte. Es war ein sehr schmerzhaftes Verfahren, das wohl mehrere Tage gedauert hatte, wie sie berichtete. Während dieser Zeit hatte man sie mit starken Schmerzmitteln versorgt. Schließlich hatte man die Sonde entfernen können und eine neue Schrittmachersonde gelegt. Durch die Bakterien habe sie auch eine Herzmuskelentzündung bekommen. Während der mehr als zweimonatigen Behandlung in der Uniklinik habe sie dauerhaft Antibiotika bekommen. Seitdem seien keine weiteren Fieberschübe mehr aufgetreten. Ich erklärte ihr noch einmal mein aufrichtiges Bedauern über unsere unergiebigen Blutkulturen und wünschte ihr von ganzem Herzen gute Besserung.
Fünf Jahre nach diesen Ereignissen trat ich in einer kleinen, aufstrebenden Stadt in der Nähe meine erste Oberarztstelle auf der Inneren Abteilung des dortigen Krankenhauses an. Gemeinsam mit dem bisherigen Oberarzt, der die Chefarztstelle übernommen hatte, wurde ich der Lokalpresse vorgestellt. Bereits am nächsten Tag erschien ein ausführlicher Zeitungsbericht mit entsprechenden Fotos.
Wenige Tage später wurde ich durch den Pförtner über Funk ans Telefon gerufen. Eine Frauenstimme nannte ihren Namen. Ich wusste sofort, wer sie war, wenn auch inzwischen fünf lange Jahre nach unserer Begegnung vergangen waren. Sie war meine ehemalige Patientin mit der infizierten Herzschrittmachersonde. Es ging ihr wohl den Umständen entsprechend gut, wie sie erzählte. Sie hatte mit Freude den Bericht in der Zeitung gelesen und wünschte mir viel Erfolg und Glück in meiner neuen Position als Oberarzt.
Sie hatte mich mit ihrem Anruf nach dem langen Zeitraum seit ihrer damaligen Verlegung in die Uniklinik vollkommen überrascht. Selten habe ich mich mehr über ein Zeichen der Dankbarkeit gefreut, das sie mir auf ihre ruhige und stille Weise für die damalige Behandlung und Begleitung vermittelt hat.
Dankbarkeit als Erinnerung des Herzens.