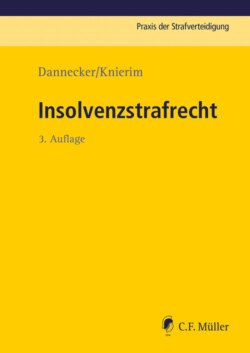Читать книгу Insolvenzstrafrecht - Gerhard Dannecker - Страница 46
На сайте Литреса книга снята с продажи.
a) Der insolvenzrechtliche Überschuldungsbegriff
Оглавление56
Die Überschuldung nach § 19 Abs. 2 InsO bezeichnet zunächst einen Zustand, in dem bei einer juristischen Person oder einer Personengesellschaft das Vermögen des Schuldners die Verbindlichkeiten nicht mehr deckt. Der Zustand der Überschuldung ist von der Unterbilanz[15] und der Unterkapitalisierung[16] abzugrenzen. Für die Feststellung einer Überschuldung nach § 19 InsO ist allerdings keine bilanzielle Überschuldung im Sinne einer Handelsbilanz maßgeblich, sondern eine an rechtlichen Erwägungen ausgerichtete Gegenüberstellung von Aktiva und Passiva, die Erstellung einer/-s so genannten „Überschuldungsbilanz/-status“.[17] Bei der Bewertung offenbaren sich regelmäßig Schwierigkeiten. Zwar können handelsrechtliche Form- und Inhaltsvorschriften uneingeschränkt auf die Erstellung einer Überschuldungsbilanz übertragen werden.[18] Die Frage nach der Überschuldung eines Unternehmens lässt sich aber nur über die lückenlose Erfassung des kompletten Vermögens als inneren Wert ermitteln, was eine Handelsbilanz allein nicht zu leisten vermag. Deshalb müssen die tatsächlichen Werte zum jeweiligen Bilanzstichtag und für alle unternehmerischen Vermögenspositionen die wahren objektiven Werte ermittelt werden.[19]
57
Der Überschuldungsstatus dient der Festsetzung des stichtagsbezogenen Vermögensstandes des Unternehmens. Es soll im Interesse des Schutzes der Gläubiger die ihnen als Haftungsgrundlage zur Verfügung stehende Vermögensmasse festgestellt werden. Man unterscheidet zwischen der rein rechnerischen (formellen) Überschuldung und der rechtlichen (materiellen) Überschuldung:[20] Während erstere das Ergebnis der aufgestellten Überschuldungsbilanz ist, liegt eine rechtliche Überschuldung nur dann vor, wenn nach der rechtlichen Wertung des § 19 Abs. 2 InsO unter Einbeziehung des Prognoseelements eine Überschuldung anzunehmen ist.[21]
58
Probleme bereitet bereits die Berechnungsgrundlage der Überschuldungsbilanz. So war vor dem Inkrafttreten der InsO streitig, ob in der Überschuldungsbilanz Liquidations- oder Fortführungswerte[22] anzusetzen waren. Die h.M. im Schrifttum,[23] der sich der BGH angeschlossen hat,[24] vertrat hierbei den so genannten modifizierten zweistufigen Überschuldungsbegriff, bei dem unter Zugrundelegung von Liquidationswerten zunächst festzustellen war, ob eine rechnerische Überschuldung vorlag. Diese allein war allerdings noch nicht ausreichend für eine rechtliche Überschuldung, vielmehr musste kumulativ zur rechnerischen Überschuldung eine negative Fortführungsprognose treten.[25] Entsprechend genügte eine positive Fortführungsprognose zur Verneinung der rechtlichen Überschuldung.
59
Dieser Streit war mit dem Inkrafttreten der InsO am 1.1.1999 und dem § 19 Abs. 2 S. 2 InsO in der bis zum 17.10.2008 geltenden Fassung obsolet geworden: Der Gesetzgeber hatte sich (ausdrücklich) gegen das von der h.M. präferierte modifizierte zweistufige Überschuldungsmodell entschieden. Stattdessen war nun das herkömmliche zweistufige Überschuldungsmodell anzuwenden, nach dem in einem ersten Schritt eine Fortführungsprognose aufgestellt werden musste, bei der auf die zukünftige Ertrags- und/oder Zahlungsfähigkeit des Unternehmens abzustellen war.[26]
Der Prognosezeitraum, um den es dabei geht, ist in der InsO nicht geregelt und auch nicht eindeutig geklärt.[27] Die überwiegende Meinung in der Literatur nimmt jedoch einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren inklusive dem laufenden Geschäftsjahr an.[28] Fällt die Fortführungsprognose positiv aus, so sind in der Überschuldensbilanz Fortführungswerte anzusetzen, anderenfalls sind Liquidationswerte in Ansatz zu bringen.[29] Letztlich entscheidet damit aber allein die rechnerische Unterdeckung über das Vorliegen der Überschuldung, d. h. auch bei positiver Fortführungsprognose konnte nach alter Rechtslage eine Überschuldung angenommen werden.[30]
60
Nach Inkrafttreten der InsO im Jahr 1999 war die Überschuldung gem. § 19 Abs. 2 InsO wie folgt definiert: „Überschuldung liegt vor, wenn das Vermögen des Schuldners die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt. Bei der Bewertung des Vermögens des Schuldners ist jedoch die Fortführung des Unternehmens zugrunde zu legen, wenn diese nach den Umständen überwiegend wahrscheinlich ist.“[31] Diese Definition hat mit der Änderung des Gesetzeswortlauts des § 19 Abs. 2 InsO durch das Finanzmarktstabilisierungsgesetz (FMStG)[32] seit dem 18.10.2008 eine Modifizierung erfahren: Demnach liegt Überschuldung nur noch dann vor, „wenn das Vermögen des Schuldners die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt, es sei denn, die Fortführung des Unternehmens ist nach den Umständen überwiegend wahrscheinlich“. Diese Einschränkung des Überschuldungsbegriffs galt zunächst nur bis zum 31.12.2010; gem. Artikel 6 Abs. 3 FMStG sollte der neue Wortlaut nämlich ab dem 1.1.2011 wieder in den alten Wortlaut „zurückgeändert“ werden. Diese Befristung wurde durch das Gesetz zur Erleichterung der Sanierung von Unternehmen vom 24.9.2009[33] zunächst bis zum 31.12.2013 verlängert.[34] War bisher bei der Feststellung einer Überschuldung die Fortführungsprognose[35] lediglich bestimmend für den Wertansatz des Vermögens in der Überschuldungsbilanz,[36] so ist nunmehr eine Überschuldung nach § 19 Abs. 2 InsO bereits ausgeschlossen, wenn eine positive Fortführungsprognose vorliegt;[37] eine Überschuldungsbilanz erübrigt sich in diesem Fall also. Bei negativer Fortführungsprognose sind bei der Bewertung der einzelnen Bilanzposten im Überschuldungsstatus Liquidationswerte zugrunde zu legen.[38]
61
Mit der Neuregelung wollte der Gesetzgeber verhindern, dass Unternehmen, die durch die Finanzkrise von hohen Wertverlusten bei Aktien und Immobilien betroffen waren, wegen der dadurch eintretenden bilanziellen Überschuldung Insolvenz anmelden mussten, obwohl sie bei einer positiven Fortführungsprognose aller Wahrscheinlichkeit nach weiterhin erfolgreich am Markt operieren konnten.[39] Wie diese zunächst vorübergehende Änderung, welche die Fälle der Überschuldung deutlich reduziert haben dürfte[40] und damit naturgemäß nicht nur das Insolvenzverfahren tangierte, sondern auch die Strafbarkeit wegen eines Insolvenzdeliktes erheblich einzuschränken geeignet war, vor dem Hintergrund der im Jahr 2007 begonnenen Finanzkrise zu werten ist, soll an dieser Stelle nicht zum Gegenstand weiterer Erörterungen gemacht werden; es sei diesbezüglich auf die umfangreiche Literatur zu diesem Thema verwiesen.[41] Inzwischen hat die zunächst bis zum 31.12.2013 befristete Änderung unbefristete Geltung erlangt, so dass es sich um ein milderes Gesetz i.S.d. § 2 Abs. 3 StGB handelt.