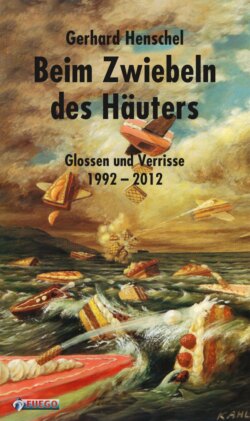Читать книгу Beim Zwiebeln des Häuters - Gerhard Henschel - Страница 17
ОглавлениеJohannes Mario Simmel träumt den unmöglichen Traum
Wenn sie einen populären Roman verreißen möchten, beschreiben deutsche Kritiker das Arbeitszimmer des Autors gern als unsaubere Küche. 1970 verriet Jürgen Eyssen in der FAZ das Geheimrezept, nach welchem Johannes Mario Simmel verfahre: »Man nehme zu denselben Teilen Sex and Crime, mische sie unter kräftigem Rütteln tüchtig durcheinander, gebe eine Prise Vulgär-Sadismus hinzu und garniere das Ganze recht appetitlich frisch mit einigen besonders exquisiten Geschmacklosigkeiten« – fertig sei der neue Simmel. Wenn es so einfach wäre, müsste nach diesem Rezept im Handumdrehen jeder Verlag zu sanieren sein. Die Formel »Man nehme etc.« stimmt natürlich nicht; sie scheint nur gut zu klingen, nach höheren Einsichten in niedere Machenschaften. Welcher Verlag würde einen Lektor einstellen, der zu vulgär-sadistischen Prisen und Geschmacklosigkeits-Garnituren riete?
Mit Johannes Mario Simmel haben sich die Kritiker nur selten größere Mühe gegeben. Bis ungefähr 1960, als ihm mit »Es muss nicht immer Kaviar sein« der Durchbruch gelang, habe er »glänzende Kritiken« bekommen und nur wenige Leser gefunden, hat Simmel einmal geschrieben. Danach sei die Leserzahl groß und die Kritik meist vernichtend gewesen. Eingehandelt hat er sich Rüffel von allen Seiten, von prüden Sittenwächtern ebenso wie von Linken, als der Vorwurf des Eskapismus noch im Umlauf war. In Frankreich oder in den Vereinigten Staaten sei das anders: »Dort zählt auch, wer eine Geschichte mit aktuellen Bezügen klar und spannend schreiben kann. Dort muss Literatur nicht immer gleich etwas Unsterbliches sein.«
Freundlichere Kritiker haben Simmel bescheinigt, er produziere »demokratische Gebrauchsliteratur« (Günther Rühle) und verbreite, wie Bertolt Brecht es empfohlen habe, mit List die Wahrheit. Der Leser werde spannend unterhalten und unaufdringlich belehrt, er empfinde Mitgefühl für die Gerechten und Empörung über die Ungerechten, woraus politisches Bewusstsein und soziales Engagement erwüchsen. Das Elend der Welt, Drogensucht, Schwerverbrechen, Rechtsradikalismus, Kriegsgefahr, Korruption und Alkoholismus hat Simmel immer wieder behandelt, natürlich auf andere Art als Freimut Duve früher mit seiner Elends-Taschenbuchreihe »rororo-aktuell«, aber ähnlich wachsam und mit Gespür für aufsehenerregende Missstände.
Aus den Elendsquartieren, aus Gefängniszellen, Luftschutzkellern oder Suchtkliniken führt die Romanhandlung regelmäßig hinauf in luxuriöse, der Mehrheit unzugängliche Kulissen der Stinkfeinen, wo sich Millionäre und Schönheiten tummeln. Thomas Lieven, der Held in »Es muss nicht immer Kaviar sein«, bevorzugt ausdrücklich »schöne Frauen, elegante Kleidung, antike Möbel, schnelle Wagen, gute Bücher, kultiviertes Essen« – normalerweise stellen sich in Simmels Romanen allerdings gerade die wohlhabenden Genießer als Schurken heraus. Schreckliches und Mondänes wechseln sich auch in billigen Illustrierten ab; auf die Nachricht vom grausigen Fund folgt zuverlässig die Home-Story über den muskulösen Krösus mit seinen antiken Wagen und schnellen Möbeln. Aber weder hiermit noch mit dem erwähnten »Man nehme«-Rezept ist der durchschlagende Erfolg zu erklären oder abzutun, den Simmel bis heute hat.
Er ist ein liebenswürdiger Mann, ein liberaler Menschenfreund, der krebskranken Kindern hilft, es vor Gericht mit Nazis aufnimmt, sich für Kollegen einsetzt und gewissenhaft Recherchen anstellt, bevor er zu schreiben beginnt, und es wäre wundervoll, ein gutes Wort über seinen neuen Roman sagen zu können – »Träum den unmöglichen Traum« –, doch es ist unmöglich.
Erzählt wird die Geschichte des alten Schriftstellers Robert Faber. Er kann nicht mehr schreiben, verzweifelt an sich selbst und am Zustand der Welt und will sich das Leben nehmen, wird jedoch im letzten Moment durch einen Anruf davon abgehalten: Faber soll sich um Goran kümmern, sein todkrankes, aus Sarajevo ausgeflogenes, jetzt in Wien darniederliegendes Enkelkind. Die Sorge um Goran führt Faber ins Leben zurück. Er trifft seine Jugendliebe Mira wieder, rekapituliert sein Leben, kann auf einmal wieder schreiben und wird schließlich erschossen, von einem rechtsradikalen Killer, wie es aussieht.
Robert Faber war auch schon in Simmels erstem Roman »Mich wundert, dass ich so fröhlich bin« der Held. Jetzt ist er Simmels Alter ego, das nicht mehr recht fröhlich sein kann und sogar das Vertrauen in die Sozialdemokratie eingebüßt hat: Faber, so wird berichtet, habe einmal »Kreisky hier und Brandt in Deutschland zu unterstützen versucht«, werde aber nichts dergleichen mehr tun: »Aus auch dieser Traum.« In einem Spiegel-Interview hat Simmel gesagt, er habe mit diesem Roman seine eigene »innere Biographie« geschrieben. Aber auch das Äußerliche, das den Lesern Gelegenheit gibt, in Jet-Set-Phantasien zu schwelgen, hat in dem Roman seine angestammten Platz gefunden.
Man erfährt, dass Faber in New York im Carlyle zu Gast war, in Madrid im Ritz, auf Capri im Quisisana, in Hamburg im Atlantic, in Los Angeles im Beverly Wilshire, in London im Claridge, in Oslo im Continental, in Cannes im Carlton, in Paris im George V, in Monte Carlo im Hôtel de Paris und in Singapur im Mandarin, aber glücklich hat es ihn nicht gemacht. Das Glück stellt sich erst wieder ein, als Robert Faber und Mira den genesenden Goran betrachten: »Mira und Faber lächelten. Eng aneinandergeschmiegt standen sie auf der Terrasse, sein Arm lag um ihre Schulter.«
Kinder, teilt einer der Ärzte mit, seien »etwas Wunderbares«, und er liebe sie alle. Das ist schön für ihn, aber nicht für den Leser, der sich von der Lektüre mehr erhofft als wohlfeile Plattheiten. Robert Faber lernt auf seine alten Tage, dass das Universum nur »eine Träne im Ozean« sei, »dass Leben und Mitleidhaben zusammengehören«, dass »die Fähigkeit, intensiv zu trauern«, etwas »unerhört Wichtiges« sei, dass Macht korrumpiere und dass alle Politiker bösartig und korrupt seien, »so wie allen Politikern alle Menschen gleichgültig sind, weil sie nur eines kennen, eines erstreben, eines wünschen: die Macht«. Mit solchen und ähnlichen Meinungsäußerungen des Romanpersonals wird keine Wahrheit listig unters Volk gebracht, sondern dummes Zeug. »Politiker!« ruft ein Pfleger im Krankenhaus aus, und der Erzähler erklärt: »In seiner Stimme schwang Abscheu.« Wenn Abscheu schwingen kann, ist alles möglich.
Die Politiker sind machtbesessen, die Taxifahrer sind ausländerfeindlich, die Bewegungen schöner Frauen haben »unendliche Grazie, die Geschmeidigkeit eines jungen Tieres«, und die Fernsehsender zeigen, Gipfel der Verruchtheit, das Unglück der Menschen. Faber denkt scharf darüber nach: »Unglück wollen wir haben, Unglück! Welche Einschaltquote hätte wohl eine Sendung mit dem Titel ›Heute habe ich Glück gehabt‹?« Das ist Medienkritik auf dem Niveau des Wortes zum Sonntag, wo die frohe Botschaft gegen die »Reizüberflutung« ausgespielt wird und immer verliert.
Die Moral der Geschichte ist hausbacken und banal, die Geschehnisse sind vorhersehbar, und der Stil ist armselig. Es leuchten »die abertausend Lichter der Stadt« unter einem »gewaltigen Himmel voller Sterne«, der nur zum Gähnen einlädt, und mitunter wird bloß noch geschlampt: »Nicht mehr der kleinsten Anstrengung mehr gewachsen, dachte er, nun, diese war die letzte.« Verwendet er ausnahmsweise einmal eine originelle Vokabel, rechtfertigt sich der Erzähler sofort: »Und diese vertretenen, alten und ausgehatschten – ja, wie man in Wien sagt, ausgehatschten – schwarzen Schuhe ...«
Bis zum Bersten mit Pathos gefüllt sind die Sprechblasen, die die Romanfiguren einander an den Kopf werfen. Als ihm sein Großvater zum ersten Mal gegenübertritt, sagt der fünfzehnjährige Goran: »Du bist meine Familie und mein einziges Land ...« Überhaupt besteht der Roman fast nur aus hölzern konstruierten Dialogen – »sagte er«, »sagte sie«, »sagte er«, »sagte sie«, heißt es ein ums andere Mal, so als habe man keinen Roman, sondern bereits das Drehbuch des Films zum Buch vor sich. Ob er einen Roman lesen werde oder nicht, hänge von der Dialogmenge ab, sagte wiederum Vladimir Nabokov: »Dialog kann deliziös sein, wenn dramatisch oder komisch stilisiert oder kunstvoll mit beschreibenden Prosapartien untermischt, mit anderen Worten: überall da, wo er stil- und strukturbildend wirkt. Wo das nicht der Fall ist, ist er nichts als automatisches Maschinenschreiben, amorphes Gebrabbel, das Seite um Seite füllt, über die der Blick des Lesers hinweg gleitet wie eine fliegende Untertasse über die Staubwüste.« Aus solchem amorphen Gebrabbel setzt sich Simmels neuer Roman größtenteils zusammen.
Unter den Autoren weltweit verbreiteter Bestseller hat vor allem Michael Crichton den drögen, auf die Dauer unerträglichen Schuss-Gegenschuss-Dialogismus auf die Spitze getrieben, ohne die Leser damit zu verschrecken. Auch Johannes Mario Simmel laufen sie nicht davon, obwohl er die Langeweile, die er mit zeitraumfressenden Romandialogen hervorruft, mit den beschreibenden Prosapartien sogar noch zu steigern weiß: »Faber ging ins Bad, duschte noch einmal, putzte lange und gewissenhaft seine Zähne und wechselte die Unterwäsche. Dann zog er eine Flanellhose und einen blauen Pullover an.« Von solchen vollkommen belanglosen, unergiebigen, nichtsnutzigen und schmählichen Mitteilungen wimmelt es im Roman. Dazwischen ziehen sich die Dialoge hin.
Er wollte »niemals Langeweile mit Literatur verwechseln und immer aufregend schreiben« – das hat Simmel, nach eigener Auskunft, schon als Neunzehnjähriger beschlossen. Der Roman »Träum den unmöglichen Traum«, sein »›summing up‹, eine Summe des Lebens« (Simmel), verströmt allerdings nichts als Ödnis – inhaltlich, moralisch und stilistisch, ohne jede Spannung und Klarheit. Um so rätselhafter ist der Erfolg, der vermutlich auch diesem Roman beschieden sein wird. Der Verlag gibt als Erstauflage 150 000 Exemplare an. Üben stilistische Reizarmut und Fahrlässigkeiten des Lektorats eine besondere Faszination auf die Leser aus? Wollen Sie partout gelangweilt werden? Oder wollen sie einfach nur eng aneinandergeschmiegt auf der Terrasse stehen und intensiv trauern?
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1.8.1996