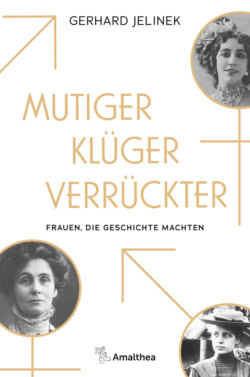Читать книгу Mutiger, klüger, verrückter - Gerhard Jelinek - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеUnterschiedlichste Bibelstellen und vor allem die nicht »offiziell« anerkannten apokryphen Evangelien nennen die Namen von sieben Frauen, die im Gefolge von Jesus ihrem Idol folgen und ihn unterstützen. Im Lukas-Evangelium heilt Jesus die Maria aus Magdala von »bösen Geistern und Krankheiten«. Die bildhaft beschriebenen »sieben Dämonen«, die Marias Körper nach der Segnung durch Jesus entfleuchen, dürften – die Bibel nicht wörtlich genommen – einfach die Schwere einer Erkrankung unterstreichen. In allen anderen Evangelien, die mangels gesicherter Quellen als zeitgeschichtliche Dokumente dienen müssen, findet sich kein Hinweis auf diese (Wunder-)Heilung. Die Frauen waren einfach da, sie folgten dem charismatischen Prediger, kümmerten sich ums Essen und unterstützten die »Jesusbewegung« nach Möglichkeit, dafür werden sie in der männlichen Überlieferung der Ereignisse gerne vergessen.
Aber diese Maria aus der Stadt Magdala genießt schon in den vier Evangelien eine Sonderstellung. Ihr Name wird immer an erster Stelle genannt. In den Mittelpunkt der Erzählungen rückt Magdalena nach der Kreuzigung von Jesus vor dem Pessachfest in Jerusalem. Sie und die anderen Frauen beobachten aus gebührender Entfernung die brutale Hinrichtung des Predigers, den die jüdische Obrigkeit bei der römischen Besatzungsmacht angeschwärzt hat. Es gilt, die Leichen noch am Freitagabend vor Sonnenuntergang, also vor Beginn des Sabbats, wenn auch nur provisorisch, zu bestatten. So will es das religiöse Gebot der Juden. So geschieht es.
Der Leichnam Jesu wird vom Kreuz genommen, in ein Tuch gewickelt und in eine Höhle gelegt. Notdürftig wird ein Stein vors Grab gerollt. Zwei römische Legionäre müssen Wache schieben. Petrus und die anderen Jünger finden in Jerusalem Unterschlupf in Wohnungen von Sympathisanten. Sie haben Angst, womöglich droht ihnen ein ähnliches Schicksal wie ihrem Meister. Sie begehen den Sabbat in bedrückter Stimmung. Der Hinrichtung am Golgatha-Felsen sind sie sicherheitshalber ferngeblieben, nur die Frauen bleiben bei Jesus – bis ans Ende. Ihre Namen sind als Zeuginnen wichtig. Drei von vier Evangelien nennen sie. Nur Lukas liefert drei Jahrzehnte nach dem Tod Jesu eine alternative Version des welthistorischen Ereignisses in seinem Evangelium. Er überlässt Maria Magdalena nicht die alleinige Zeugenschaft des Todes und später der Auferstehung Christi: »Es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, die dies den Aposteln sagten, sie und die übrigen mit ihnen.« Nach Johannes ist Maria aus Magdala die Erste, die eine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus erlebt: Nachdem Petrus und der Lieblingsjünger von der Szene abgetreten sind, befindet sich Maria aus Magdala wieder allein am Grab. Sie sieht zwei Erscheinungen, die sie fragen, warum sie weine. Im Anschluss an Marias Antwort verkündigen aber nun nicht die Engel die Auferstehungsbotschaft, Jesus tritt selbst auf; sie hält ihn für den Gärtner. Die junge Frau erkennt Jesus erst, als er sie bei ihrem Namen ruft, und antwortet ihm mit »Rabbuni!« (»mein Rabbi!«). Der nächste Satz des Jesus wird zumeist mit »Rühre mich nicht an!« oder lateinisch »Noli me tangere!« übersetzt. Da Jesus wohl Aramäisch, aber mit Sicherheit weder Griechisch noch Lateinisch gesprochen hat, sind solche überlieferten Sätze beliebig zu deuten. In der knapp 2000 Jahre alten Rezeptionsgeschichte der biblischen Texte, die Jahrzehnte nach den Ereignissen auf Golgotha niedergeschrieben wurden, gibt es manche Wandlung und Umdeutung. Der von Maria Magdalena als »Gärtner« verkannte Jesus mag wohl gesagt haben: »Halte mich nicht fest!«, oder anders: »Lass mich gehen.«
Es muss eine kurze Erscheinung gewesen sein. Denn als Simon Petrus und Johannes, der Jünger, den Jesus liebte, aus dem leeren Grab kommen, da ist der Auferstandene schon nicht mehr sichtbar. Maria aus Magdala jedenfalls übernimmt die Führungsrolle. Sie geht zu den verunsichert wartenden Aposteln zurück und verkündet: »Ich habe den Kyrios gesehen.« Die jetzt führungslosen Anhänger des Predigers haben sich in ein »Obergemach«, also in einen luftigen Raum mit Fenstern im Obergeschoß eines Hauses, zurückgezogen. Es ist wahrscheinlich das gleiche Haus, derselbe Raum, in dem die Jünger das »letzte Abendmahl« gemeinsam eingenommen haben. In den bildlichen Darstellungen, die Jahrhunderte später gemalt werden, fehlen die Frauen. Leonardo da Vinci, immerhin, gibt Johannes, dem Lieblingsjünger an Jesu Seite, ein weibliches Antlitz. Als einen der wenigen Apostel malt ihn Leonardo bartlos mit langem, wallendem Haar. Es soll Johannes, es könnte aber auch Maria Magdalena sein.
Wer war nun diese Verkünderin und Zeugin der Auferstehung, der zentralen Botschaft der sich entwickelnden christlichen Religion? Wir wissen es nicht. Eine Sünderin? Eine Prostituierte? Ihre Person wird im Laufe der christlichen Geschichte zu einer Kunstfigur. Die Formung der »biblischen« Figur passiert Jahrhunderte nach Jesu Tod, der wahrscheinlich um das Jahr 30 hingerichtet wird. Die katholische Bibelwissenschaft hat sich auf den 7. April des Jahres 30, einen Freitag vor Beginn des jüdischen Pessach-Festes, geeinigt. Die historische Person Jesus dürfte jedenfalls zwischen dem Jahr 30 und 33 getötet worden und zu diesem Zeitpunkt fast 40 Jahre alt gewesen sein.
Über Maria Magdalena weiß man nach ihrer Zeugenschaft für die Auferstehung nichts. Die Sünderin wird sie erst Jahrhunderte später. Denn die »Sünderin« des Neuen Testaments, der von Jesus verziehen wird, ist namenlos. Diese Frau lädt sich selbst ins Haus des Pharisäers Simon ein und bringt als Gastgeschenk ein Alabastergefäß mit wohlriechendem Öl mit. Sie hat von Jesus gehört und will ihn kennenlernen. Sie setzt sich zu seinen Füßen und weint so sehr, dass ihre Tränen »seine Füße benetzen«. Diese trocknet sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsst sie und salbt sie mit dem mitgebrachten Öl. Die Proteste des Simon, dem der ungebetene Gast als »Sünderin«, was immer das auch sein mag, nicht als die würdige Tischbegleitung gilt, entkräftet Jesus mit einem spontanen Gleichnis und einer Rüge für den Gastgeber. »Siehst du diese Frau? Als ich in dein Haus kam, hast du mir kein Wasser für die Füße gegeben; sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und sie mit ihren Haaren abgetrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben; sie aber hat, seit ich hier bin, unaufhörlich meine Füße geküsst. Du hast mir nicht das Haupt mit Öl gesalbt; sie aber hat mit Balsam meine Füße gesalbt. Deshalb sage ich dir: Ihr sind ihre vielen Sünden vergeben, weil sie mir so viel Liebe gezeigt hat.«
Nirgendwo in den vier »offiziellen« Evangelien steht, dass diese reuige Frau mit Maria Magdalena ident ist. In der jahrhundertelangen Überlieferungszeit werden unterschiedliche Frauenschicksale auf Maria Magdalena projiziert. Die von der Kunst willig aufgenommene und damit vorherrschende Darstellung der Maria aus Magdala etablierte sich erst Hunderte Jahre später, verbreitet vor allem durch den ersten Mönchspapst Gregor I., der die Kirche um das Jahr 600 durch die turbulente Übergangsperiode zwischen der verblassenden Antike und dem frühen Mittelalter führte. Gregor predigt über Maria Magdalena und erfindet das Bild der reuigen Sünderin.
Damit ist es nur ein kleiner Gedankensprung, und die »Sünderin«, die junge Frau aus Magdala, wird von der Gefährtin Jesu zur Geliebten. Bestsellerautor Dan Brown stilisiert einen nur bruchstückhaft überlieferten Satz aus dem – nicht kirchenamtlichen – Evangelium des Philippus als Beleg. Darin wird berichtet, Jesus habe seine Gefährtin Maria von Magdala »oft auf ihren Mund geküsst«. Leider ist gerade der Begriff »Mund« eine Textergänzung der Wissenschaft im 20. Jahrhundert. In den erhaltenen Textbruchstücken fehlen wichtige Worte. Das Wort »Kuss« in einer aus dem Griechischen ins Koptische übersetzten Schrift aus dem 3. Jahrhundert und das, was wir heute gemeiniglich mit einem »Kuss« verbinden, muss, kann oder wird aufgrund der doch ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Traditionen zwischen dem Leben frühchristlicher Gemeinden im Hellenismus und heute nicht dieselbe gesellschaftliche Bedeutung haben.
Ein wenig aussagekräftiger ist das Thomas-Evangelium, das ebenfalls zu den apokryphen Schriften zählt. Diese Sammlung von 114 Sprüchen wurde im Weltkriegsjahr 1945 ein paar Kilometer vom ägyptischen Dorf Nag Hammadi am Oberlauf des Nils entfernt in einem Erdloch von lokalen Bauern ausgegraben. In einem roten Tonkrug waren 13 in Leder gebundene Codices verschlossen, darunter auch das sogenannte Thomas-Evangelium. An diesem historischen Fund waren die Bauern aus Nag Hammadi anfangs nur mäßig interessiert, sie hatten auf Gold gehofft und sich vor bösen Geistern im Krug gefürchtet. Einer der Bauern, ein gewisser Muhammed Ali, nahm die alten Schriften mit in sein Dorf al-Qasr. Dort lagerte er sie in die Nähe des Ofens, was wiederum Alis Mutter ganz praktisch fand, weil sie damit trockenes Papyrus zum Unterzünden des Herdfeuers hatte. So verheizte sie den größten Teil des Codex XII und einige weitere lose Blätter. Gott sei Dank brachte Muhammed den verbliebenen Rest des Altpapyrus zu einem koptischen Priester, dessen Bruder wiederum den möglichen Wert erkannte und die Lederbände nach Kairo transportierte. Für 300 Pfund kaufte sie der ägyptische Staat. So blieben das ab dem 2. Jahrhundert verfasste Thomas-Evangelium, das Petrus-Evangelium, das Judas-Evangelium, das Evangelium der Wahrheit und das Philippus-Evangelium erhalten.
Und die Rolle der Männer? Die wichtigste Frau im Umfeld von Jesus, die ihn über Jahre begleitet, die in den Evangelien die Auferstehung des Gekreuzigten bezeugt und damit die zentrale Glaubensbotschaft des Christentums überhaupt erst möglich macht, diese Frau aus Magdala wird von der männlichen Geschichtsschreibung über mehrere Jahrhunderte zur »Sünderin« und »Büßerin« stilisiert. Die Mythen machen aus zumindest drei Frauengestalten des Neuen Testaments eine Maria Magdalena.
Der Bedeutung von Maria aus Magdala entspricht so ein konstruiertes Bild nicht. Der jüdische Sektenführer Jesus, der in Galiläa predigt, schart Männer und wahrscheinlich auch viele Frauen um sich. Er behandelt sie mit Respekt. Sie wird seine Gefährtin, wie andere Frauen auch. Maria Magdalena wird im Neuen Testament ein gutes Dutzend Mal erwähnt, öfter als die meisten Jünger. Die männlichen Begleiter reagieren mit Eifersucht, sie wollen das angeblich nur ihr Anvertraute erfahren. In dem apokryphen »Evangelium nach Maria« kommt es sogar zur Konfrontation zwischen dem männlichen »Apostel-Anführer« Simon Petrus und ihr, als Sprecherin der Frauen. Petrus greift sie, unterstützt von seinem Bruder Andreas, an. »Schwester, wir wissen, dass der Erlöser dich mehr liebte als die übrigen Frauen. Sage uns die Worte des Erlösers, die du erinnerst, die du kennst, nicht wir, und die wir auch nicht gehört haben.« Er muss sich aber im intellektuellen Duell mit Maria Magdalena geschlagen geben – auch weil andere Apostel Petrus »einbremsen«, ihn zur Mäßigung zwingen. Der Apostel Levi geht in Konfrontation zu Petrus: »Wenn aber der Erlöser sie würdig gemacht hat, wer bist denn du selbst, sie zu verwerfen? Sicherlich kennt der Erlöser sie genau. Deswegen hat er sie mehr als uns geliebt.« In diesen Texten spiegeln sich Auseinandersetzungen und Diskussionen der kleinen christlichen Gemeinden im 2. Jahrhundert wider. Maria Magdalena ist in manchen Texten Gesprächspartnerin von Jesus. Er erhöht sie als »Frau, die vollständig verstanden hatte«.