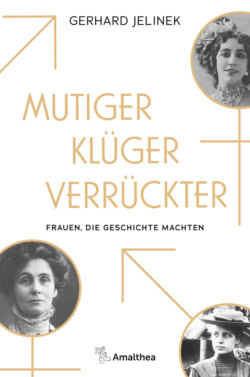Читать книгу Mutiger, klüger, verrückter - Gerhard Jelinek - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Mathilde von Quedlinburg
Оглавление»Ein Edelstein aus dem Stamm des Königshauses«
Markgraf Ekkehard I. von Meißen ist ein mächtiger Mann. Der Herzog von Thüringen hat eine Tochter. Liutgard. Sie ist ein Kind, vielleicht sechs, vielleicht acht Jahre alt. Ekkehard gehört zu den einflussreichen Fürsten im Umfeld von König Otto III. Er ist ein Heerführer, der blumig »Zierde des Reichs« genannt wird. Graf Lothar von Walbeck wiederum herrscht über die Nordmark. Er ist vielleicht nicht ganz so reich und so einflussreich wie Ekkehard, aber das soll sich eben ändern. Sein erstgeborener Sohn heißt Werner. Er ist vermutlich fünf Jahre älter als Liutgard, sie ein Kind, er ein Jüngling.
Der Markgraf und der Graf verhandeln über die Zukunft ihrer Kinder. Das ist in der Zeit und in diesen Kreisen so üblich. Heiraten hat mit Liebe gar nichts, mit Machterwerb alles zu tun. Eine Ehe besiegelt mit dem Segen der Kirche ein Bündnis, mehr nicht. Ums Jahr 997 geben die beiden angesehenen Familien offiziell die Verlobung von Liutgard und Werner bekannt. Damit hofft Lothar, die Ranggleichheit der Familie Walbeck gegenüber dem Markgrafen Ekkehard zu besiegeln. Die Verlobung wird feierlich verkündet, als fester und unlösbarer Pakt.
Liutgard wäre eine mehr als standesgemäße Braut für den Grafen der Nordmark. Doch der Brautvater überlegt es sich noch einmal. Vielleicht hat er ein lukrativeres Angebot für seine Tochter bekommen, vielleicht zweifelt er am aufbrausenden Charakter des Nordmärkers. Ekkehard I. ist ein enger Vertrauter und Weggefährte von Otto III. Die Vermutung liegt nahe, er hätte seine Tochter gern als Kaiserin gesehen. Vermutung ja, aber der Kaiser wandelt in dieser Zeit auf Freiersfüßen. Statt die Kinderbraut in die Obhut der Familie des Bräutigams zu übergeben, bringt Ekkehard die kleine Liutgard ins noble Damenstift nach Quedlinburg. Die dortige Äbtissin Mathilde soll auf die Herzogstochter aufpassen, sie erziehen und vor allem vor der Ehe mit Werner bewahren. Ekkehard will seine Tochter für einen höheren Herrn aufsparen. Das ist ein glatter Rechtsbruch.
Das gebrochene Heiratsversprechen erzürnt Graf Lothar, er muss das Verhalten des Doch-nicht-Schwiegervaters Ekkehard als Demütigung seiner Familie werten, eine Schande. So gehen Grafen und Herzöge im Mittelalter nicht miteinander um. Der halbwüchsige Sohn Werner besteigt sein Streitross und reitet mit einigen Rittern nach Quedlinburg. Die aufgebrachten Herren stürmen das wehrlose Damenstift und rauben die kleine Liutgard. Diese dreiste Aktion wird von Äbtissin Mathilde als Affront betrachtet. Immerhin ist Mathilde nicht nur eine fromme Ordensfrau. Sie ist seit dem Jahr 997 offizielle Stellvertreterin des deutschen Königs Otto III., der sich in Italien mit diversen Feinden herumbalgen muss. Und da der König Jahre fern der deutschen Lande weilt, regiert Mathilde das Reich.
Die Entführung einer ihrer Schutzbefohlenen ist ein direkter Angriff auf die Autorität des Königs und kann so nicht hingenommen werden. Die Tochter von Kaiser Otto dem Großen und Adelheid von Burgund hat schon mit zarten elf Jahren die Führung des reichen Damenstifts übernommen. Sie wird als Äbtissin direkte Nachfolgerin ihrer ebenso tüchtigen wie bestimmten und (was die Unterscheidung schwierig macht) gleichnamigen Großmutter. Die steile Karriere der hochadeligen Jungfrau ist in diesen mittelalterlichen Zeiten nichts Aufsehenerregendes. Die Umstände ihrer Kür zur Äbtissin schon. Denn Mathilde wird nicht nur von einem Erzbischof, nein, sie wird von allen Erzbischöfen des Reiches geweiht. Damit soll die Unterstützung der kaiserlichen Familie durch den gesamten Klerus öffentlich dokumentiert werden.
In Quedlinburg leben Dutzende wohlhabende Frauen, die in der Sicherheit dicker Mauern darauf warten, passend verheiratet zu werden oder als Witwe unbelästigt im Stift leben dürfen. Viele dieser Frauen haben in dem dem heiligen Servatius geweihten Stift eine eigene Dienerschaft, müssen weder Keuschheit noch Armut geloben. Die Damen werden Sanktimonialen genannt und verfügen über persönlichen Besitz. Die Stifte sind eben keine Klöster mit Klausur. Die vornehmen Frauen dürfen selbstverständlich das Stift verlassen und reisen. Wobei Reisen um die Jahrtausendwende ohnehin nicht das reine Vergnügen, sondern ein mühsames und gefährliches Abenteuer sind. Die Stellung der Stifte ist durch ihre Immunität gegenüber der Macht- und Gerichtsbarkeit von Herzögen, Grafen oder Bischöfen massiv gestärkt. Sie sind auch wirtschaftlich privilegiert, weil sie das Zoll-, Münz- und Marktrecht haben.
Quedlinburg besitzt viele Ländereien im Harzvorland, unter anderem in Ditfurt, Duderstadt oder Nienburg an der Saale. Es ist ein reiches Land. Die fruchtbaren Schwarzerde-Böden ermöglichen den Bauern zwei Ernten pro Jahr. Die Güter des Stiftes Quedlinburg gelten als die Kornkammer des Reiches. Mathilde hat aus dem Damenstift und der Pfalz Quedlinburg innerhalb weniger Jahre eine wohlhabende Stadt gemacht. Das Stift und der mächtige romanische Dom thronen auf einem Felsen oberhalb der Stadt am Rande des Harzes. Quedlinburg wird zur Hauptstadt der Ottonen, zum Mittelpunkt eines Reichs, ein »heiliger« Ort des Kaisergeschlechts, nach damaliger Vorstellung zu einem Zentrum der Welt. Das Stift, der Dom, der Ort haben für die Familie der Ottonen auch eine spirituelle Bedeutung. Sie feiern in Quedlinburg das Osterfest in aller Pracht, in der damaligen christlichen Tradition bedeutender als Weihnachten. Nach der prunkvollen Hochzeit seines Sohnes Otto II. mit der byzantinischen Prinzessin Theophanu zieht Kaiser Otto I. nach Quedlinburg. Der sächsische Chronist Widukind von Corvey überliefert das Ereignis des Jahres 978: »Mit den siegreichen Truppen zog der Kaiser, aus Gallien kommend, nach Germanien, um das nächste Osterfest im berühmten Ort Quedlinburg zu feiern.« Im Stift treffen Delegationen aus der gesamten damaligen Welt ein: Gesandte der Griechen, Beneventer, Ungarn, Bulgaren, Dänen, Slawen, die polnischen Herzöge Mieszko und Bolesław, sogar der Gesandte des Kalifen von Córdoba Ibrāhīm ibn Ya‘qūb müht sich von der Iberischen Halbinsel ins heutige Thüringen. Es ist ein mittelalterliches Großereignis mit kulturpolitischen Folgen. Eine Frau ist Gastgeberin. Die Gäste bringen kostbare Geschenke, kunstvolle Bücher und damit neues Wissen nach Quedlinburg.
Mathilde wird bereits anno 966 als Nachfolgerin ihrer Großmutter und als einzige Tochter von Kaiser Otto, dem Großen, zur Äbtissin geweiht. Im Alter von elf Jahren ist man vor Beginn der ersten Jahrtausendwende kein Kind mehr. Die Karriere der Kaisertochter und späteren Kaisertante ist vorbestimmt. Von Quedlinburg aus wird sie nicht nur mehr als 30 Jahre lang adelige Damen gottesfürchtig begleiten, sie regiert auch das ganze Reich. Die für die kurzen Lebensspannen des Mittelalters lange Stabilität sichert allein schon Macht und Einfluss. Ihre machtpolitische Bedeutung wird in zeitgenössischen Schriften mit der Bezeichnung »domina imperialis« hervorgehoben. Und sie dominiert nicht nur im Stift. Mathilde begleitet im Jahr 980 ihren Bruder Otto II. auf seinem Italienzug. Der Sachsen- und Frankenkönig soll den aus Rom vertriebenen Papst Benedikt VII. wieder in seine Rechte einsetzen. Das gelingt mit der militärischen Macht der Panzerreiterei. Mathilde bewährt sich als politische Ratgeberin. In Ravenna feiern König, Familie und Heer zusammen mit dem Papst das Weihnachtsfest. Nach diesem Erfolg ist ein noch größerer Machtanspruch für die ottonische Familie in Reichweite. Mit der byzantinischen Ehegattin Theophanu an seiner Seite nimmt Otto II. den Titel Romanorum Imperator Augustus an. Er will die islamischen Sarazenen aus Süditalien vertreiben und das eigentlich verlorene byzantinische Gebiet für das Kaiserreich erobern. Doch das Vorhaben scheitert. Otto erleidet mit seinen sächsischen Panzerreitern im Kampf gegen die Sarazenen eine schwere Niederlage, er selbst kann sich gerade noch verwundet retten, stirbt aber auf dem Weg Richtung Norden.
Schnell wird sein erst dreijähriger Sohn zum König gekrönt, nur mit großer Mühe kann die Familie ihren Herrschaftsanspruch gegen den rivalisierenden bayerischen Herzog Heinrich retten. Die zeitgenössische Geschichtsschreibung hängt dem Bayern den Beinamen »der Zänker« an: Message Control, schon anno dazumal. Der kleine Otto III. bleibt in der Obhut von Frauen. Während seiner Unmündigkeit verwalten die beiden Kaiserinnen Theophanu, Witwe von Otto II., und Adelheid von Burgund, Witwe von Kaiser Otto dem Großen, das Ostfränkisch-Römische Reich mehr als ein Jahrzehnt lang. Schwester Mathilde gewinnt politisch immer stärkeren Einfluss. Das weibliche Triumvirat harmoniert gut. De jure und de facto bestimmen also erfahrene Frauen das Schicksal des Reiches nördlich der Alpen. Der König darf inzwischen mal spielen.
Die Äbtissin beherbergt Gesandtschaften und leitet Reichstage. Kein Ritter bezweifelt ihre Autorität. Im Jahr 998 ruft Mathilde die wichtigsten Männer des Reichs zu einem Hoftag in die Pfalz Derenburg. Sie leitet die Versammlung als Vertreterin des ottonischen Königs, hört Bitten, besetzt Ämter neu und spricht Recht. Unbestritten. Das 10. Jahrhundert ist eine erstaunlich moderne Zeit, in der starke Frauen und Königinnen Macht besitzen und ausüben. Der sächsische Chronist Widukind von Corvey widmete Äbtissin Mathilde von Quedlinburg seine auf drei Bände angelegte Sachsengeschichte und charakterisiert sie durchaus schmeichlerisch »als strahlendste Herrlichkeit und funkelnder Edelstein«.
Ihr Neffe Otto III. ist zwar Kaiser des Römisch-Deutschen Reichs, aber er verlagert während seiner kurzen Regierungszeit den Schwerpunkt seiner Herrschaft nach Italien, nach Rom. In der verfallenen Tiberstadt muss er sich mit den lokalen Stadtadeligen um die Vorherrschaft in der Kirche zanken und buchstäblich prügeln. Gegen die rebellischen Adelsfamilien setzt er seinen Verwandten Bruno von Kärnten als Papst Gregor V. auf den Stuhl des heiligen Petrus. Bruno aus dem Geschlecht der Salier, ein Urenkel von Kaiser Otto, stammt – vermutlich – aus Stainach-Pürgg im Ennstal (seine Mutter ist Judith von Kärnten), und er ist damit nicht der erste deutsche Papst, sondern irgendwie der einzige »österreichische Papst«. Ist es Zufall, dass gerade in seiner päpstlichen Amtszeit, anno 996, in einer Urkunde das erste Mal der Begriff »Ostarrichi« auftaucht? Natürlich ist es Zufall, aber doch irgendwie auch symbolhaft.
Der Papst aus der Obersteiermark krönt Otto 996, da ist er gerade 16 Jahre alt, zum römischen Kaiser. Der Kirchenmann ist nur ein paar Jahre älter. Im frühen Mittelalter müssen Karrieren im Kindesalter beginnen, der Tod ist immer nahe. Nur vier Jahre amtiert Gregor V. Er wird die Jahrtausendwende nicht erleben. Kaum 27 Jahre alt, stirbt das Oberhaupt der Christenheit.
Frauen, so sie nicht im Kindbett sterben, haben ein längeres Leben, weil sie sich nicht in kriegerische Händel einlassen müssen, die definitionsgemäß für die männlichen Ritter lebensgefährlich sind. Schon als junges Mädchen ist Äbtissin Mathilde fürs Stift, seine Ländereien und ihre Mitschwestern verantwortlich. Im Jahr 999 muss sich die Stellvertreterin des Kaisers um den Brautraub kümmern. Monatelang reiten Boten zwischen den verfeindeten Familien und Quedlinburg hin und her. Dann spricht die Äbtissin ein Machtwort. Werner von Walbeck hat sich auf dem Hoftag zu Magdeburg mit der geraubten (Kinds-)Braut einzufinden, sich dort öffentlich schuldig zu bekennen, widrigenfalls er das Land zu verlassen hat. Ein Ultimatum. Mathilde setzt die Macht des Königs durch und sichert den Rechtsfrieden des Reichs. Sie tut es, weil sie die Autorität dazu hat. Tatsächlich erscheint der junge Ritter und bezeugt der Äbtissin (und damit dem Kaiser) seinen Gehorsam. Das junge Mädchen Liutgard wird wieder ihrer Familie übergeben. Geheiratet wird dennoch. Drei Jahre nach dem Hoftag von Magdeburg kann die Hochzeit nach dem Tode des Brautvaters Herzog Ekkehard stattfinden.
Werner von Walbeck hat seine öffentliche Niederlage am Reichstag nie verwunden. Rache ist freilich kein guter Ratgeber. Er verzettelt sich und sein Vermögen in weitgehend sinn- und erfolglosen Ritterfehden. Zehn Jahre nach der Hochzeit stirbt die umkämpfte Braut. Luitgards Ehemann wird geächtet (er verliert jeden Schutz und seine Vermögensrechte), weil er einen Rivalen ermordet. Er kann seinen Kopf nur durch die Bezahlung vieler Silbermünzen und durch die Preisgabe geerbten Vermögens retten. Noch einmal versucht der von Walbeck eine Sachsenbraut zu rauben. Diesmal ist es die Tochter des Herzogs Hermann Billung, Reinhilde. Das Unternehmen geht schief. Der rabiate Brautwerber erliegt, kaum 30 Jahre alt, den schweren Verwundungen, die ihm im Kampf um Reinhilde zugefügt werden.
Äbtissin Mathilde ist da schon lange tot. Wenige Wochen nach dem Reichstag von Magdeburg erkrankt die 44-Jährige an einem mysteriösen Fieber und stirbt. Kaiser Otto III. weilt in Rom. Er lässt auf die Grabplatte seiner getreuen Stellvertreterin ein Loblied gravieren: »Dem Irdischen, oh Schmerz! Enthoben« Das Jahrbuch des Quedlinburger Stiftes notiert: »Der Tod raubte einen Edelstein aus dem Stamm des Königshauses.« Viel schöner kann ein Nachruf kaum sein.
Und Otto III.? Auch dem kinderlosen Kaiser ist kein langes Leben beschieden. Er stirbt zwei Jahre nach Mathildes Tod. Bei einem Festmahl ist er noch bester Dinge, plötzlich wird dem Kaiser übel, er muss sich übergeben, verliert das Bewusstsein und stirbt, mutmaßlich an einer Pilzvergiftung. War es Mord? Wahrscheinlich, doch an Beweisen fehlt es. Nach gut 1000 Jahren sind die Spuren verwischt.