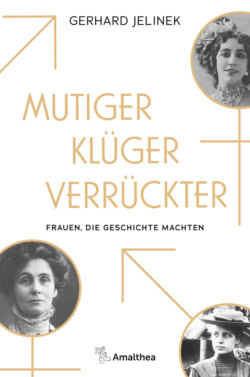Читать книгу Mutiger, klüger, verrückter - Gerhard Jelinek - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеMit dem Hinweis auf einen »Leierspieler« macht sich der römische Geschichtsschreiber posthum über Kaiser Nero lustig, dessen historisches Andenken in der Zeit der Nachfolger mit kräftigen (Ab-)Strichen zur Karikatur verkommt. Kaiser Nero Claudius Caesar, mit dem Beinamen Germanicus, soll ja den – angeblich von ihm gelegten – Brand Roms vom Turm des Maecenas aus beobachtet und mit Versen zum Fall Trojas zur von ihm gespielten Leier begleitet haben. So wird Nero von der Nachwelt dargestellt, eine lächerliche Karikatur eines grausamen Herrschers.
Alles nicht wahr. Bei allen Eigenarten des knollennasigen Kaisers, der sich mehr als Künstler denn als Staatsmann sah – zu der Zeit, als der verheerende Brand ausbricht, weilt Nero eine Tagesreise entfernt in seiner Sommerresidenz. Er eilt ins brennende Rom, öffnet seine Häuser für die Obdachlosen und senkt den Getreidepreis. Seinem Nachruf wird das nichts nützen. Geschichtsschreiber Tacitus macht Geschichte, auch über den Umweg einer keltischen Königin. Nachdem Boudicca auf ihrem Streitwagen, dekorativ von ihren geschändeten Töchtern flankiert, von Clan zu Clan gefahren ist und die Männer mit Hohn und Spott über den schwulen Kaiser Nero kampfeslustig gestimmt hat, gibt sie ihren Clan-Führern den Befehl zum Angriff.
Die Vorzeichen stehen gut. Ein von der Königin unter ihrem Wallegewand verborgener Hase wird freigelassen und läuft just in die von Druiden als günstig bezeichnete Richtung. Boudicca hätte sich besser nicht auf den Nager verlassen sollen. Es wird ihre letzte Schlacht, ihr letzter Tag. Der Hase hat geirrt.
Die Niederlage der zahlenmäßig weit überlegenen keltischen Krieger gegen gut organisierte vier Legionen beendet den Aufstand gegen die Besatzungsmacht. Königin Boudicca wird nicht in der Schlacht getötet, sie kann fliehen, stirbt aber. Die Vermutung, dass sie sich selbst opfert, opfern muss, liegt nahe. In die Hände der Feinde will sie nicht fallen.
Die wahre Geschichte der keltischen Königin, die es mit Rom aufnahm, über Monate die Besatzer der britischen Insel in Furcht und Schrecken versetzte und ihre Stammeskrieger gegen römische Legionen in eine Schlacht führte, wird »always remain in the grey shadow of history«. Denn die zwei historischen Berichte über den Aufstand der keltischen Königin gegen das Römische Imperium wurden von ihren Gegnern verfasst. Der Politiker und Historienschreiber Publius Cornelius Tacitus hat immerhin einen privaten Zugang zu einem Zeitzeugen. Sein Schwiegervater Gnarus Julius Agricola diente zur Zeit des Aufstandes in einer der römischen Legionen in der Provinz, er übernahm später das Kommando der XX. Legion und den Oberbefehl in der Provinz Britannien.
Eine andere Version der Geschichte wird in der Historia Romana des Lucius Cassius Dio Cocceianus 150 Jahre nach den Ereignissen in der englischen Provinz verfasst. Bei aller Unschärfe der römischen Zeitgeschichte-Erzählung, die sich weniger an der historischen Wahrheit denn an der propagandistischen Wirkung für den römischen Hausgebrauch orientiert, ist der Aufstand zweier mächtiger keltischer Stämme gegen die Römer historisch belegt. Archäologen können die Brandspuren in den Erdschichten der von Boudiccas Heerscharen abgefackelten Siedlungen, etwa dem heutigen Colchester (Camulodunum), analysieren und ziemlich exakt auf die Jahre 60/61 nach Christus datieren. Auch Ausgrabungen in London und St. Albans (Verulamium) liefern Beweise für größere Brände in der Zeit. Alles, was von Boudicca blieb, ist Asche.
Seit Monaten schon hat Boudicca, die Witwe des Königs der Icener Prasutagus, mit ihren keltischen Kriegern die von den römischen Besatzern gegründeten südenglischen Städte überrannt, die Häuser geplündert, ihre Bewohner erschlagen und Feuer gelegt. In der jungen römischen Provinz Britannien kommt der Warenverkehr zum Erliegen, das damals schon wohlhabende Londinium wird buchstäblich dem Erdboden gleichgemacht. Heute, fast 2000 Jahre später, identifizieren Archäologen anhand einer Brandschicht unter der Erde den Zeitpunkt der Zerstörung des römischen Londons. Rund 70 000 Menschen fallen dem Rachefeldzug der zwei keltischen Stämme Icener und Trinovanten zum Opfer. Im fernen Rom nimmt die Nobilitas unter Kaiser Nero von den Unruhen im fernen Britannien nur beiläufig Notiz. An den Rändern dieses Weltreichs müssen immer wieder römische Legionäre aufständische Stammesfürsten bekriegen. Die raue Gegend auf der britischen Insel spielt im römischen Machtkalkül nur eine Nebenrolle. Immerhin schafft es der Aufstand der Kelten-Königin in die Annalen Roms. Eine Zeit lang war sogar befürchtet worden, die Provinz im Westen könnte wieder verloren gehen.
Schon der große Julius Cäsar hatte ja seinerzeit nach seinem Gallien-Feldzug zwei Legionen, darunter seine getreue X. Legion, im Spätsommer des Jahres 55 vor Christus über den Ärmelkanal verschifft, um die wilden Stämme der Insel zu unterjochen. Gerüchte über reiche Gold- und Silbervorkommen beflügelten das Interesse des Feldherrn. Die dort ansässigen Britonen empfingen Cäsar eher unfreundlich. Nur mühsam konnte sich der spätere Diktator ans Land kämpfen und dort festsetzen. Die ständigen Kämpfe mit den störrischen Briten, die keine Neigung zeigten, irgendeinem fernen Kaiser in Rom Tribut zu zahlen, überforderten Cäsars Legionen. Die fehlende Willkommenskultur der Einheimischen, raue Winde, hohe Wellen und ausbleibender Nachschub veranlassten Cäsar, nach ein paar Wochen wieder nach Gallien zurückzusegeln. Das militärische Abenteuer hatte zwar einige Siege über schlecht organisierte und intern zerstrittene Stammeskrieger in kleineren Scharmützeln gebracht, aber sonst wenig. Im fernen Rom ließ sich das insulare Abenteuer aber dennoch mächtig in Szene setzen. Der Senat bewilligte Cäsar ein 20-tägiges Dankesfest, das zur innenpolitischen Popularitätssteigerung des Kriegshelden beitragen konnte.
Noch ein zweites Mal, ein Jahr später, versuchte Cäsar, diesmal mit vier Legionen, die Insel zu unterwerfen, aber auch dieses Unternehmen blieb nicht nachhaltig. Es sollte gut 100 Jahre dauern, ehe Britannien tatsächlich unter Kaiser Claudius zur römischen Provinz wurde, wirklich friedlich wurde es nie. Das bewährte römische System, lokale Stämme mit Gewalt und/oder finanziellen Zuwendungen als Verbündete gegen andere noch aufsässige Stämme zu gewinnen, funktionierte auch auf der Insel.
Der König des mächtigen keltischen Stamms der Icener schloss mit den Invasoren einen Vertrag, der die kulturelle Unabhängigkeit seines Volkes und ihm die Macht sichern sollte. Mit der römischen Lebensart konnten sich die Kelten nicht anfreunden. Warme Bäder, opulente Festmahle und Männer, die sich wie Frauen kleideten, waren nicht nach dem Geschmack der Männer und Frauen des britischen Nordens. Der ehrgeizige Statthalter Publius Ostorius Scapula provozierte durch den Bau von römischen Militärlagern im Gebiet der Icener einen Aufstand, der durch andere mit Rom verbündete Stämme niedergeworfen werden konnte. Ein neuer Stammeskönig mit dem schönen Namen Prasutagus wurde zum Vasallen Roms, seine Ehefrau Boudicca regierte an seiner Seite und übernahm nach dem Tod ihres Gemahls um das Jahr 60 nach Christus die Führung des Stammes. Die Existenz des Königs ist immerhin durch Münzfunde belegt. Die Rolle seiner Gattin durch römische Schriftquellen. Prasutagus hat sich während der Eroberung Britanniens durch Kaiser Claudius friedlich unterworfen und so seinen Status als König mit der Zustimmung Roms bewahrt.
Warum Boudicca und ihr Stamm zum Aufstand gegen die Römer gedrängt werden, bleibt im Nebel der Geschichte verschwommen. Es gibt immerhin eine Version, die eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat. Prasutagus versuchte, in seinem Testament der Familie den Thron zu erhalten, und setzte seine beiden Töchter als Erbinnen und schlauerweise Roms Kaiser Nero als Miterben ein. Ein Drittel des Besitzes sollte also an die Römer gehen, womöglich als Rückzahlung bedeutender Unterstützungen Roms für die Treue des Vasallenkönigs. Der Plan scheiterte. Eine weibliche Erbfolge passte einfach nicht ins römische Weltbild, und das Drittel Erbe für Kaiser Nero schien zu gering, wenn man sich doch mit Gewalt alles holen konnte. Die umfangreichen Besitztümer des verstorbenen Königs Prasutagus wurden beschlagnahmt. Der letzte Wille des Vasallenkönigs landete im Staub East Anglias. Römische Legionärssandalen trampelten drüber hinweg. Die ehrwürdigen Mitglieder der aristokratischen Oberschicht des stolzen Stammes wurden wie Sklaven behandelt. Boudicca dürfte auch die Rückzahlung der römischen Kredite für nachrangig gehalten haben. Bei den Sesterzen verstanden die Römer aber keinen Spaß. Die Witwe von König Prasutagus wird öffentlich ausgepeitscht, ihre beiden jungfräulichen Töchter geschändet, also von Legionären vergewaltigt. Ein Frevel. Diese Form der Bestrafung mag zeit- und lokaltypisch gewesen sein, dem Ethos einer Kulturnation entsprechen die Taten der Veteranen nicht. In der Schilderung der britischen Ereignisse durch den Historiker und Politiker Dio bleiben diese unrühmlichen Vorfälle schamvoll unerwähnt.
Eine Frau, eine keltische Königin gar, kann die erlittene Schmach nicht erdulden. Boudicca wird zur Feindin Roms. Es gelingt ihr, den benachbarten Stamm der Trinobantianer zum Aufstand gegen die Besatzer aufzuwiegeln. Unter ihrer Führung zieht eine staatliche Streitmacht der Britonen gen Süden ins Herzland der Provinz. Sie wollen an den dort angesiedelten römischen Veteranen, die für ihre Militärdienstzeit mit bäuerlichem Grund und Boden entlohnt werden, Rache üben.
Als Erstes erreichen die Aufständischen Camulodunum (das heutige Colchester), eine römische Kolonie entlassener römischer Soldaten. Sie haben mit dem Geld der unterjochten Trinobantianer ein Heiligtum für Kaiser Claudius erbaut. Die Kelten empfinden das als Provokation ihrer Götter. Der Tempel zur Vergöttlichung des römischen Kaisers wird zum Symbol für die Versklavung der Stämme.
Camulodunum wird überrannt und bis auf die Grundmauern niedergebrannt, alle römischen Einwohner sterben. Zwei Tage lang kann sich eine kleine Truppe noch im Tempel verschanzen, ehe auch er fällt. Die Figur des Kaisers Claudius stürzt. Boudiccas Truppen ziehen weiter nach Londinium (London) und Verulamium (St. Albans). Der Erfolg der keltischen Königin spricht sich auf der Insel herum. Ihr Heer erhält Zulauf von anderen Stämmen. Bis zu 100 000 Kämpfer wagen den Aufstand gegen das allmächtige Rom. In Londinium bricht Panik aus, die Stadt wird evakuiert. Boudicca und ihre Truppen verwüsten auch den erst vor wenigen Jahren gegründeten Handelsposten an der Themse und ziehen weiter gegen Westen.
Roms Provinzstatthalter Suetonius Paulinus ist gerade anderweitig beschäftigt. Seine Legionen versuchen, Aufstände walisischer Stämme im Westen der Insel zu bekämpfen. Nur mit Mühe kann er Soldaten gegen Boudiccas Kämpfer aufbringen. Die Legio IX Hispana, einer der ältesten Truppenteile des Römischen Weltreichs, scheitert mit einem Gegenschlag und wird von der Übermacht der Kelten schwer geschlagen, aber nicht vernichtet.
Die Stämme marschieren weiter gegen Westen. Schon fürchtet Suetonius Paulinus den Verlust Britanniens. Seiner Karriere in Rom wäre eine peinliche Niederlage nicht gerade förderlich. Kaiser Nero erwägt gar, die widerspenstige Provinz aufzugeben.
Bei Wroxeter, einem heute unbedeutenden Dorf in der Grafschaft Shropshire, befindet sich damals die viertgrößte Stadt der römischen Provinz. Viroconium Cornoviorum markiert einen Endpunkt der römischen Hauptverkehrsachse, die einst von Dover quer durch Mittelengland bis nach Wales führte. Es ist ein strategisch bedeutsamer Ort. Dort kommt es anno 61 zur Schlacht.
Die kriegerische Königswitwe kommandiert ein für damalige Verhältnisse stattliches Heer. Zwischen 150 000 und 200 000 Kelten sollen sich versammelt haben. Die Zahlen sind freilich mit großer Skepsis zu behandeln. Denn die Krieger zogen mit der ganzen Familie in die Schlacht. Jedenfalls waren die beiden Stämme den vier römischen Legionen, darunter die Legio II Augusta und die Legio II Hispana, mit ihren knapp 13 000 Mann zahlenmäßig weit überlegen. Die professionelle Kriegsmaschinerie der Römer versteht jedoch ihr Handwerk. Suetonius Paulinus positioniert die Legionen so, dass er einen dichten Wald im Rücken hat. Er fürchtet einen Hinterhalt. Vor den Römern liegt ein freies Feld, begrenzt durch eine Schlucht. Das engt den Operationsraum für die keltischen Massen ein. Über den Verlauf der Schlacht ist wenig bekannt. Sie endet nach mehreren Stunden mit einer vernichtenden Niederlage der Kelten, die für ungestümes Vorrücken, weniger aber für strategische Schlachtenführung bekannt sind. Die Römer metzeln die Angreifer blutig nieder, die ihr Heil nur noch in heilloser Flucht suchen können. Angeblich sterben nur 400 Römer, aber Zehntausende Kelten.
Römische Kriegsberichte, auch wenn sie von Tacitus Jahrzehnte später auf Pergament geschrieben werden, sind selten akkurat. Tatsächlich dürften rund 4000 römische Soldaten am Schlachtfeld bleiben, so viele Legionäre beordert Nero aus den germanischen Provinzen zur Stärkung der Legionen über den Kanal.
Am Sieg in der Schlacht besteht freilich kein Zweifel. Mehr keltische Opfer als die Kampfhandlungen selbst fordert die Hungersnot nach dem Aufstand. Da praktisch der gesamte Stamm brennend, mordend und plündernd durch Südengland gezogen ist, bleiben die heimatlichen Felder in East Anglia unbeackert. Ohne Aussaat keine Ernte. Es wird anderthalb Jahrzehnte bitterste Not bedeuten, ehe die römische Militärherrschaft über die Reste des geschlagenen Stammes wieder durch eine eigene Verwaltung abgelöst wird.
Königin Boudicca verschwindet im historischen Nebel, gelegentlich taucht sie im Mittelalter als sagenumwobene Figur wieder auf, nur um gleich wieder ins Mystische zurückzutreten. Die kriegerische Königswitwe wird erst im Zeitalter von Queen Victoria wieder in der englischen Geschichte etabliert. Der Name Boudicca lässt sich irgendwie vom keltischen Wort »Sieg« ableiten. Für Königin Victoria wird die Keltenkönigin damit zur Namensverwandten. Die Verehrung der längst vergessenen Königin gipfelt in einer mächtigen Statuengruppe, die Prinz Albert beim Bildhauer Thomas Thornycroft beauftragt. Die streitbare Dame thront seit 1907 auf einem Wagen mit ihren Töchtern und kontrolliert heute die Westminster Bridge beim Parlamentsgebäude. So huldigt ausgerechnet jene Stadt der Frau, die sie einst verwüstete.