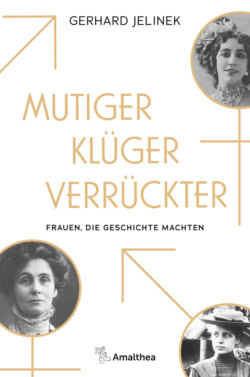Читать книгу Mutiger, klüger, verrückter - Gerhard Jelinek - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Lilith
Оглавление»Ich will nicht unter dir liegen«
Als Gott den ersten Menschen geschaffen hatte, sagte er: ›Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei.‹ Und er schuf ihm eine Frau – gleich ihm – aus Erde und nannte sie Lilith.« Adam und Eva. Der erste Mann und die erste Frau. Falsch. In der hebräischen Mythologie heißt die erste Frau Lilith, nicht Eva. Die trifft erst später im Paradies ein. So beginnt die Geschichte der Menschheit in einem Dreiecksverhältnis. Gott erschafft Adam, den Menschen. Weil sich dieser einsam fühlt und das bunte Liebesleben der paarweise erschaffenen Tiere mit sich steigerndem Missvergnügen betrachtet, bittet er Gott, ihm ein Gegenstück zu schaffen. Gott zeigt sich verständnisvoll. Der Herr des Himmels und der Welt geht also nach dem gleichen bewährten Rezept vor. Wie bei Adam nimmt er Erde, Staub, Lehm und formt ein Geschöpf »nach seinem Ebenbild«. Mit Haut und langen Haaren. Adam hat eine Frau. Er kann nun die heißen sumerischen Nächte zu zweit verbringen. Es könnten paradiesische Zustände sein.
Aber der erste Mann Adam erweist sich als einfallsloser Liebhaber, seine Lilith hingegen ist eine selbstbewusste Partnerin. Sie pocht auf Gleichberechtigung in allen Lagen. Schließlich habe Gott sie aus dem gleichen Stoff geformt wie das männliche Pendant. Auch in ihrer Sexualität will Lilith gleichberechtigt sein, ihre Wünsche sind denen des Mannes nicht nachgeordnet. Wieder beschreibt die alte Überlieferung die Szene im Garten Eden klar und deutlich. Bald begannen die beiden zu streiten. Lilith sagte zu Adam: »Ich will nicht unter dir liegen.« Und er sagte: »Ich will nicht unter dir liegen, sondern auf dir, weil du verdienst, die Unterlegene zu sein und ich der Überlegene.« Sie sagte zu ihm: »Wir sind beide gleich, weil wir beide aus Erde gemacht sind.«
Der Geschlechterkampf hat also schon im Garten Eden begonnen. Aber Lilith fackelt nicht lange herum. Sie ruft den Namen ihres Schöpfers und erhebt sich in »die Lüfte der Welt«. Lilith scheint also durchaus Engelseigenschaften gehabt zu haben. Sie fliegt. Mit dieser Kunst ist sie aber nicht allein. Das Verlassen des Paradieses bleibt nicht unbemerkt. Nach einem Hinweis von Adam schickt der althebräische Gott der Mythen drei Engel aus, die Adams Frau wieder ins Paradies locken sollen. Lilith weilt derweilen am Roten Meer, heißt es geografisch eher unbestimmt. Da wir uns den Garten Eden irgendwo im Lande der Sumerer vorstellen wollen, wird sich die sagenhafte Lilith irgendwo an der Küste der Arabischen Halbinsel aufgehalten haben. Die ultimative Aufforderung, heim ins Paradies zu wandern, lehnt die selbstbewusste Frau ab. »Wie kann ich wie eine ehrbare Hausfrau leben?« Die Engel drohen damit, sie im Meer zu ertränken. Doch wieder zeigt sich der selbstbestimmte Charakter von Adams erster Frau. Sie denkt gar nicht daran, den Befehlen nachzukommen.
Es wird zwar noch eine Weile verhandelt, aber Gott straft Lilith, indem er täglich 100 ihrer »Dämonenkinder« tötet. Ganz logisch geht die Geschichte also nicht weiter. Wir lassen das aus. Adam, dessen Rolle allen später geborenen Männergenerationen nicht zur Ehre gereicht, ruft wieder einmal Gott an und beklagt sich bitterlich. Die Frau sei ihm davongelaufen.
Gott ist in diesem offenbar hauptsächlich von männlichen Priestern am Lagerfeuer weitererzählten Urmythos gegenüber Adam sehr verständnisvoll. Er rügt seine erste Schöpfung nicht, weil er sich wenig partnerschaftlich benommen hat. Nein, Gott geht neuerlich ans Werk und formt eine weitere Partnerin für Adam. Dieser ist allerdings sehr anspruchsvoll und lehnt Gottes zweiten Versuch empört ab. Wiederum ist der oberste Weltenlenker nachsichtig und macht sich ein drittes Mal ans Werk. Diesmal transplantiert Gott eine Rippe des tief schlafenden Adam und baut um diese Rippe ein schönes Wesen, dem er auch einiges von der Sinnlichkeit und Verführungskraft Liliths mitgibt. Gott nennt sein Geschöpf Eva. Da unsere Geschichte aber unzweifelhaft im heutigen Südirak zu lokalisieren ist, wird Eva wohl einen sumerischen Namen getragen haben.
Das Erste Buch Mose lässt eine geografische Eingrenzung des Paradieses zu. Gesucht wurde es über Jahrhunderte, gefunden bis heute nicht. 80, 100 und mehr Theorien gibt es, wo sich der biblische Garten Eden befunden haben könnte. Er war Ziel von Gelehrten und schwer bewaffneten Kreuzrittern. Sie glaubten tatsächlich, das Paradies mit dem Schwert erobern und besetzen zu können. Seit Jahrhunderten suchen Altertumsforscher das Paradies und finden es immer wieder an anderen Orten.
Für den deutschen Mönch Martin Luther waren die Versuche, das himmlische Paradies geografisch zu verorten, ohnehin lächerlich. »Möglich ist’s, dass es zu der Zeit also gewesen ist, dass Gott einen Garten gemacht oder ein Land beschränkt hat, aber nach meinem Dünken wollt ich gern, dass es so verstanden möchte werden, dass es der ganze Erdboden wäre.«
Jeder Mythos dürfte irgendwo eine historische Wurzel haben. So wird in der mesopotamischen Vorlage zur Genesis-Erzählung der Garten Eden als Widerspiegelung des Tempelgartens in Eridu gedeutet. Die kargen Reste der sumerischen Stadt Nun liegen heute unter einem Ruinenhügel im Süden des Irak. Vor gut 8000 Jahren beherbergte Eridu das wichtigste Heiligtum des Gottes Enki. Er galt als Herr der Welt, des Süßwassers, des Todes und des schöpferischen Geistes. Es ist die Stätte und die Stadt, in der Geschichte begann. Hier kann der Garten Eden gewesen sein.
Das Paradies der Sumerer war ein friedlicher Tierpark, eine Kulturlandschaft, wie sie Jean-Jacques Rousseau gemalt haben könnte. »Rein, sauber, hell« soll der Garten Eden sein, seine Bewohner, auch die gewalttätigsten, sind friedlich. Der Löwe tötet nicht, und der Wolf raubt kein Schaf. Es grünt und blüht im Paradies, weil der Sonnengott das Land mit süßem Grundwasser befeuchtet. Im sumerischen Epos Enki und Nammu wird die Erschaffung des Menschen so geschildert: Die Göttinnen Nammu und Ninmach formen den Menschen aus der Verbindung von Lehm und dem heiligen Wasser des Urozeans. Immer ist es Staub mit Wasser vermischt, aus dem der Mensch geknetet wird. Die Grundrezeptur bleibt also gleich: in der Bibel, in den sumerischen Epen, in der hebräischen Überlieferung, in der erst später entstandenen Kabbala und auch im Koran.
Die Beschreibung dieser paradiesischen Zustände ist älter als die Schöpfungsgeschichte der Bibel, viel älter. Das Alte Testament ist also abgeschrieben? Nein, vielmehr belegt das heilige Buch der Juden und der Christen die ungebrochene mündliche Tradition uralter Mythen. Die biblische Erzählung gehört zum abendländischen Grundwissen. Selbst wer die Geschichte von Adam, Eva, dem Apfel und der Schlange nicht im Buch Genesis gelesen hat, kennt sie, und sei es nur aus der Kunstgeschichte, in der das Bild von Mann, Frau, Apfelbaum und böser Schlange zu den Stereotypen der Malerei und Bildhauerei zählt.
Adam und Eva – so weit folgt die Genesis den älteren sumerischen Dichtungen – leben im Garten Eden. Es geht ihnen gut, keine Rede von Streit. Lilith, die Vorgängerin Evas, kommt im Alten Testament nur ein Mal als Randbemerkung vor. Im verwüsteten Land Edom treiben dunkle und böse Geister ihr Unwesen. Wilde Katzen und Wüstenhunde streunen durch die zerstörte Landschaft, und eben dort »rastet Lilith und findet einen stillen Ort für sich«. Viel mehr lässt uns die Bibel über Adams erste Frau nicht wissen. Erst sehr viel später, im Mittelalter, wird aus der alttestamentarischen Randfigur ein böser weiblicher Dämon, der sich in so manch feuchten Traum der Männer einschleicht und dort für unsaubere Gedanken verantwortlich gemacht wird.
Vor Evas Verführung beim Apfelbaum scheint das paradiesische Leben eher langweilig gewesen zu sein. Im Gegensatz zum sumerischen Mythos erzählt die Bibel nichts vom Geschlechtsleben. Adam, der aus Erde Gemachte, und seine Eva sind – bis zum »Sündenfall« – kinderlos. Sie kennen keine Lust, keine Scham, sie vermehren sich nicht, sie sind nach Gottes Ebenbild geformt. Sie sind eigentlich noch keine Menschen in unserem heutigen Sinn. Um sich von Gott zu unterscheiden, bedarf es des Fehlers, des Widerspruchs, des Ungehorsams, vor allem der Sterblichkeit.
Der Mensch wird zum Menschen, indem er eigenständigen Willen zeigt. Und es ist die Frau, die den ersten Schritt weg vom Gottähnlichen zum Menschen macht. Sie will vom Baum der Erkenntnis naschen. Die Schlange als Symbol für das Böse, den Teufel, braucht es dazu gar nicht. Sie wird als Ausrede ins Bild gerückt. Michelangelo malt Lilith als Wesen aus Frau und Schlange, die ihrer Nachfolgerin Eva den Apfel reicht. Eva will das Verbotene tun. Sie beißt in eine Feige, denn um einen Feigenbaum wird es sich wohl gehandelt haben. »Malus« – das Böse – steht nur im Lateinischen für »Apfel«. Es ist der Baum des Bösen, an dem die verbotenen Früchte wachsen und es ist – welche Gleichsetzung – auch der Baum der Erkenntnis. Wissen kann zur Auflehnung gegen Gott führen. Wird der Mensch zu klug, zu besserwisserisch, lehnt er sich gegen Gott auf, folgt die Strafe auf den Fuß. Adam und Eva werden aus dem Paradies vertrieben, sie beginnen als Menschen zu leben. Sie lernen Angst und Leiden, Lust und Freude kennen. Sie beginnen sich zu lieben und zu vermehren. Es gibt paradiesische Momente, aber auch teuflisches Leid. Und es gibt den Tod.
Schuld an dem Schlamassel ist die Frau. Adam, der wiederum nicht souverän reagiert, schiebt alles auf Eva – diese bezichtigt die Schlange. Gott reagiert empört und vertreibt die zwei aus dem Garten Eden. Adam muss fortan als Bauer den kargen Boden bearbeiten und Feldfrüchte fürs Überleben der Menschheit anbauen. Eva erlebt in der Sünde Lust, muss aber unter Schmerzen Kinder auf die Welt bringen. Das erste Paar zeugt drei Söhne, Kain, Abel und Set, außerdem eine nicht genau bezifferte Zahl an Töchtern und einige unbekannte Söhne. Da Adam das fürwahr »biblische« Alter von 930 Jahren erreicht, kann er die Weltbevölkerung schon in erster Generation deutlich steigern.
Lilith erlebt – geschätzte 6000 Jahre nach ihrer Schöpfung – eine Wiedergeburt. Die sumerische Figur der ersten Frau, die von Adam gleichberechtigt und selbstbewusst ihre Rechte einfordert, wird in den 1960er-Jahren zu einer Ikone des Feminismus. Während die biblische Eva in einer patriarchalischen Tradition steht, symbolisiert Lilith die Selbstständigkeit der Frau und ihren Widerstand gegen männliche Unterdrückung. Sie verweigert den Druck, sich im Namen einer höheren Autorität zu fügen, und wird dafür bestraft. Gleichzeitig beflügelt sie Männerfantasien über Jahrhunderte. Johann Wolfgang von Goethe lässt sie in der Walpurgisnacht tanzen. Mephisto weiß, wer die Schöne ist: »Lilith ist das. Adams erste Frau. Nimm dich in Acht vor ihren schönen Haaren, vor diesem Schmuck, mit dem sie einzig prangt. Wenn sie damit den jungen Mann erlangt, so lässt sie ihn so bald nicht wieder fahren.« Goethe greift für seinen Faust alte Quellen aus dem Talmud auf, in dem Lilith schon im 5. Jahrhundert nach Christus als nächtlicher Dämon herumfliegt. Zu Adams erster Frau wird sie in den Überlieferungen erst ein paar Jahrhunderte später. Die Frauen, die in diesem Buche porträtiert werden, stammen alle irgendwie von der sagenumwobenen Lilith ab oder entsprechen jedenfalls dem Frauenbild, das rund um die Figur der Lilith in den Jahrhunderten gezeichnet wurde.
So ist auch diese Frau irgendwie ein Geschöpf der Männer, aber sie ist ihnen entflogen.