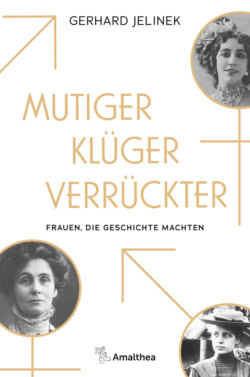Читать книгу Mutiger, klüger, verrückter - Gerhard Jelinek - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Artemisia Gentileschi
Оглавление»Bevor er noch einmal in mich eindrang, riss ich ihm ein Stück Fleisch aus«
Artemisia Gentileschi kennt Caravaggio und seine Bilder gut. Wer in Rom am Beginn des 17. Jahrhunderts kennt Michelangelo Merisi da Caravaggio nicht? Das Maler-Genie ist das Stadtgespräch einer Metropole im Bau- und Kunstrausch. Das päpstliche Rom hat sich aus der schweren Krise der Reformation in einen barocken Taumel geflüchtet. Päpste, Kardinäle, die reichen römischen Adelsfamilien wetteifern mit Pracht, Glanz und Gloria.
Die Ideen dieses deutschen Mönchs aus Wittenberg scheinen überwunden, zumindest in Rom sind sie nicht angekommen. Der Katholizismus feiert seinen Triumph in neuen Palästen für jenen Gott, der seinen Sohn in Armut, jedenfalls aber in Bescheidenheit, auf die Welt geschickt hat, um ebendiese zu retten.
Rom zelebriert den Prunk, den Hochmut, die Lust, die Leidenschaft, das Gold, das Laster. Diese Stadt, in der die Trümmer der antiken Größe überall herumstehen, fiebert, taumelt im Rausch künstlerischer Schaffenskraft. Und die kirchlichen Würdenträger wetteifern mit den adeligen Familien in Prunksucht, aber auch Intrige, Wollust, Niedertracht, Gewalt, Korruption und Mord. Die sieben Todsünden. Rom lebt sie alle.
In fanatischen Familienfehden wird mit blankem Säbel oder heimtückisch gezogenem Dolch gekämpft, Giftmischer lösen Eheprobleme. Gedungene Mörder (»bravi« genannt) töten für vergleichsweise wenige »scudi«. Das Leben außerhalb der Paläste ist dreckig, gewalttätig und frömmlerisch. Der Papst ist weltliches und geistliches Oberhaupt dieser Stadt, die aus und auf und mit den Trümmern des römischen Roms Paläste und Kirchen baut.
Hunderte Maler und Kunsthandwerker sind aus vielen Städten des italienischen Stiefels nach Rom gezogen. Sie balgen sich um die Aufträge der Kirchen, der Klöster, der Adelsfamilien. Maler, Bildhauer, Dekorateure haben Hochkonjunktur. Es entwickelt sich eine Hierarchie der Maler, die einander kopieren, hochloben oder geringschätzen. Verleumdungen sind ein Mittel des Wettbewerbs, Pamphlete sind die Social Media der Barockzeit, Spottgedichte erheitern und können ihre Schöpfer oder ihre Opfer in den Kerker bringen. Übeltäter werden enthauptet, wenn sie Glück haben, erschlagen und gevierteilt, wenn sie niederen Standes sind. Gewalt und Blut sind allgegenwärtig. Die Maler wissen, wie ein abgeschlagenes Haupt aussieht, sie hören die Schreie der Gefolterten, sie schwelgen förmlich in den barocken Formen der nackten Körperlichkeit. Das Alte Testament bietet unzählige Vorlagen und Vorwände für dramatische Geschichten: Sex, Gewalt und Tod. Judith, die Holofernes das Haupt abschneidet, der gewalttätige Raub der Sabinerinnen, Susanna und die lüsternen Alten, der Mord an den unschuldigen Kindern, David, der Goliath erschlägt. Michelangelo Merisi da Caravaggio überstrahlt die Menge der Künstler, die als Handwerker wahrgenommen und so besoldet werden.
Mit seinem Genie hat er die Malerei auf eine neue Ebene gehoben. Wie er mit dem Licht umgeht, wie er Heilige und andere biblische Figuren zu Menschen mit allen ihren Leidenschaften, Qualen, Ängsten erhöht oder in den Augen der Frömmler herabzieht, das ist neu. Das ist gut, das ist eine Sensation. Das sichert dem Künstler eine Ausnahmestellung in diesem römischen Tollhaus. Caravaggios brutaler Realismus schockiert und wird abgelehnt, seine sexuellen Bezüge in großformatigen Bildern lassen sich durch die dargestellten Heiligengeschichten kaum überdecken. Da werden Knaben, fast Kinder noch, zu Lustobjekten.
Er selbst lebt ein exzentrisches Leben, geht in Rom mit einem schwarzen Hund spazieren, trägt einen Degen und unterm Wams einen Dolch. Später wird er bei einem Raufhandel zustechen, seinen Rivalen töten. Er wird aus Rom fliehen müssen, aber mächtige Gönner halten die schützende Hand über den Mörder. Das Genie Caravaggio bleibt ungestraft. Seine Kunst überstrahlt das wilde Leben.
Die junge Römerin Artemisia Gentileschi studiert die Werke Caravaggios. In der Cerasi-Kapelle der Kirche Santa Maria del Popolo hängen zwei neue Bilder des Meisters. Petrus bei seiner Kreuzigung und Paulus, der vom Pferd gefallene Saulus. Der grelle Lichtstrahl der Erleuchtung hat den Römer vom hohen Ross geworfen. Sehr eindrucksvoll. Artemisia muss ihre Nachbarin Tuzia Medaglia fast täglich in die Kirche Santa Maria del Popolo begleiten, in der Kapelle beten, warten, bis der Beichtvater Tuzia die Absolution erteilt hat. Der Kirchgang der hübschen Artemisia in Begleitung, eigentlich Bewachung, durch die weibliche Gouvernante, ist so ziemlich das einzige Vergnügen, das einem geschlechtsreifen Mädchen gewährt wird.
Sie nützt die Zeit zum Studium der Caravaggios. Der Schatzmeister des Papstes, also kein armer Mann, hat den wichtigsten Künstler der Zeit für die Ausgestaltung seiner Kapelle engagiert. Das steigert das Prestige des Malers. Aber: Caravaggios moderne Darstellung entspricht nicht dem Geschmack des päpstlichen Finanzministers. Um das ausbedungene Honorar zu bekommen, muss das Genie nachbessern.
Auch der Vater von Artemisia, Orazio Gentileschi, ist Maler. Auch er ist nach Rom zugewandert. Auch er eifert Caravaggio nach, gehört zur Gruppe um den »jungen Wilden«. Er reicht aber nicht an sein Vorbild heran. Immerhin kann Orazio gut und bald immer besser von seiner Kunst leben. Er kann sich die Miete in einem Haus jenseits des Tibers leisten. Die Via della Croce führt durch kein vornehmes Viertel, aber viele Künstler und Handwerker wohnen hier. Orazios Frau ist früh im Kindbett verstorben. Die junge Artemisia übernimmt die Aufgaben der Mutter, mit zwölf oder gar 14 Jahren sind Mädchen im 17. Jahrhundert keine Kinder mehr. Artemisia lebt in diesem Künstlerhaushalt, sie ist hübsch und nicht eben schüchtern. Ihr Vater lässt sie für sich und andere Kollegen nackt posieren. Das spart Geld für Prostituierte, die sonst als Modelle infrage kämen und teuer sind.
Orazio Gentileschi sorgt sich um die Keuschheit seiner Tochter. Die Jungfernschaft eines Mädchens ist ein hohes Gut, keineswegs nur ein moralischer Anspruch. Eine hübsche und körperlich »reine« Heiratskandidatin bedeutet für den Vater Mitgift und damit Wohlstand. Die Tochter ist Eigentum des Vaters. Frauen sind in jenen Tagen des frühen Barocks nicht geschäftsfähig. Sie sollen möglichst einträglich unter die Haube gebracht werden, sich künftig um das Wohl des Ehemanns kümmern und seine Affären erdulden. Artemisia wächst im Atelier ihres Vaters auf und beginnt mit Kohlestiften zu zeichnen. Sehr zum Ärger Orazios, aber auf Dauer bleibt ihr Talent nicht verborgen. Lesen und Schreiben lernt sie nicht. Im Atelier und auf den Baustellen wird Meister Gentileschi von seinem Freund und Malerkollegen Agostino Tassi unterstützt. Maler leiten damals kleine Kunst-Manufakturen. Agostino ist Spezialist für Landschaften, und er wird Artemisia auf Geheiß ihres Vaters in die Kunst der Perspektive einweisen. Dabei bleibt es nicht.
Agostino Tassi bedrängt die 17-Jährige und tut ihr Gewalt an. Artemisia schildert Monate später unter Eid und mit Folter bedroht die Geschehnisse vor einem Gerichtsnotar so: »Nachdem er das Zimmer abgeschlossen hatte, warf er mich auf die Bettkante. Die eine Hand auf meiner Brust, schob er mir ein Knie zwischen die Schenkel, sodass ich sie nicht schließen konnte, und zog meine Wäsche hoch, womit er große Mühe hatte; er griff nach meinem Hals und stopfte mir ein Taschentuch in den Mund, damit ich nicht schrie, meine Hände, die er zuvor mit seiner anderen Hand festhielt, ließ er frei, nachdem er seine beiden Knie zwischen meine Beine geschoben hatte; richtete sein Glied auf meinen Schoß und begann in mich hineinzustoßen, was fürchterlich brannte. Aber ich zerkratzte ihm das Gesicht und riss ihm die Haare aus, und bevor er noch einmal in mich eindrang, riss ich ihm ein Stück Fleisch aus.«
Nachdem er von Artemisia ablassen musste, stürzt sich das Mädchen mit einem Messer auf Tassi. »Ich will dich töten, denn du hast mich geschändet.« Agostino bleibt offenbar unbeeindruckt. Bei einem Gerangel ritzt das Mädchen bloß ihren Peiniger, ein paar Tropfen Blut fließen. Immerhin verspricht Tassi der 17-Jährigen, er werde sie heiraten und so die Schande wieder ungeschehen machen. Dieses vage Versprechen besänftigt das Opfer. Artemisia und Tassi werden in den nächsten Monaten ein Liebespaar. Der Treulose fordert Treue ein. Eine Vergewaltigung mit einem nachfolgenden Eheversprechen gilt gleichsam schon als Eheschließung mit vorgezogener Erfüllung. Es geht ja nicht um die Gefühle der Frau, sondern um die Wiederherstellung eines von der kirchlichen Moral postulierten Zustandes. Gewalt an Frauen ist dann rechtens, wenn es im Rahmen einer Ehe passiert.
Artemisia akzeptiert dieses scheinbar eherne Gesetz. Sie rebelliert erst, als sie Monate nach der Tat erfährt, dass ihr Liebhaber verheiratet ist und demnach sein Eheversprechen keineswegs wahr machen kann. Dann erst klagt der Vater den Missbrauch seiner Tochter an. Agostino Tassi versucht, während der Beziehung zur Tochter seines Meisters seine Ehe zu beenden. Er hat seine Ehefrau Maria nicht ungern in der Toskana zurückgelassen, als er nach Rom gezogen ist.
Warum Vater Gentileschi ausgerechnet Agostino Tassi in die Nähe seiner Tochter lässt, wo er doch sonst so auf ihren Ruf bedacht ist, bleibt rätselhaft. Immerhin ist Tassi schon einschlägig gerichtsbekannt. Im Jahr vor der Vergewaltigung der Artemisia – für ihn gilt keine Unschuldsvermutung – wird er wegen Blutschande mit seiner Schwägerin Constanza vor Gericht gezerrt.
Die Prozessakten aus dem Jahr 1612 sind in der römischen Kurie erhalten geblieben und konnten in den 1980er-Jahren veröffentlicht werden.
Die päpstliche Justiz arbeitet langsam, aber gründlich und befragt mit großem Interesse an Details gut ein Dutzend Zeugen. Zwei Hebammen führen im Gerichtssaal gynäkologische Untersuchungen durch und bezeugen, dass Artemisia keine Jungfrau mehr sei. Die junge Frau willigt sogar ein, unter der »sibyllinischen« Folter ihre Aussagen zu wiederholen. Ihre Hände werden vor der Brust gefesselt und an den Fingergelenken Daumenschrauben angesetzt. Auch unter Schmerzen bleibt die 17-Jährige bei ihrer Darstellung der Vergewaltigung.
Der nicht als Angeklagter, sondern nur als Zeuge befragte Agostino Tassi wird aus dem Gefängnis Corte Savella vorgeführt. Er leugnet die Tat und beschuldigt Artemisia eines unziemlichen Umgangs mit anderen Männern. Nicht er, sondern der für die Versorgung des päpstlichen Hofstaats zuständige Furier Cosimo Quorli habe die Jungfrau entehrt. Aussage steht gegen Aussage. Die Tatsache, dass Cosimo Quorli praktischerweise kurz vor dem Prozess stirbt, macht die Wahrheitsfindung nicht einfacher. Das Mädchen wird im Prozess bald vom Opfer zur unsittlichen Angeklagten. Zahlreiche andere Liebhaber werden ihr vorgehalten. Rom hat einen pikanten Skandal.
Artemisia bestreitet gar nicht, mit ihrem Perspektivenlehrer Agostino auch nach der von ihr beschriebenen Vergewaltigung über mehrere Monate im Hause ihres Vaters fleischlichen Verkehr gehabt zu haben. Tassi ist in Rom kein Unbekannter. Er pflegt einen exzessiven Lebensstil, kleidet sich geckenhaft und maßt sich das Tragen eines Degens an. Die goldene Kette um den Hals soll den Eindruck eines Edelmanns erwecken, dabei ist Tassi doch nur ein Maler, ein Raufbold, ein Aufschneider, ein Galan, der sich für unwiderstehlich hält, Caravaggio nacheifert und den ein Künstlerbiograf und Zeitgenosse als »Prahlhans« beschreibt. So ein Mannsbild verkehrt im Hause Orazio Gentileschi.
Artemisia malt während des lang andauernden Prozesses. Ihr bekanntestes Werk entsteht: Judith enthauptet Holofernes. Ein Bild als Racheakt an den gewalttätigen Männern? Zwei Frauen töten einen Feldherrn. Der Mord wird von Fräulein Gentileschi in aller Grausamkeit sehr drastisch dargestellt. Das Blut des Holofernes spritzt auf das Bettlaken. Judiths Magd Abra beobachtet die Gewalttat in einem roten Mantel nicht aus der Ferne, sie greift ein – und wie mit starken Armen hält sie den betrunkenen Holofernes fest, als Judith das Schwert ansetzt. Magd und Herrin, beide töten den Mann. In der Gewalt am Manne verschwinden, natürlich nur bildlich, die sonst unüberwindlichen Klassenschranken. Die enorme Anstrengung, mit einem Schwert den Kopf vom Rumpf zu trennen, sogar das Keuchen der Frauen drängen sich den Betrachtern auf. Feministinnen deuten dieses Werk als Beleg für Gentileschis Trauma und ihre Rachegelüste. In der Kunstgeschichte ist diese vordergründige Bildbetrachtung akzeptiert.
Vater Gentileschi betrachtet seine junge Tochter jedenfalls als künstlerisch gleichwertig. Er fördert die ungewöhnliche Karriere und preist ihr Können in Briefen an die Großherzogin der Toskana an. Über den Apennin wird Artemisia auch nach dem Prozess »auswandern«. In Rom kann sie nicht bleiben. Wenige Wochen nach dem Gerichtsverfahren wird die junge Frau mit dem Florentiner Maler Pierantonio Stiattesi verheiratet. Damit ist der Makel der fehlenden Jungfräulichkeit bereinigt. Stiattesi ist ein Freund ihres Vaters und steht bei ihm tief in der Schuld und zwar im eigentlichen Sinn. Vermutlich verzichtet Orazio Gentileschi auf die Eintreibung der Schulden, dafür bekommt er die Tochter. Beide ziehen nach Florenz. Dort malt Artemisia, bringt sechs Kinder zur Welt, die alle früh sterben. Sie lernt schreiben und lesen und wird schon vier Jahre nach dem Prozess in Rom als erste Frau überhaupt in die Florentiner Kunstakademie aufgenommen. Als Mitglied der zunftartigen Akademie kann Artemisa im eigenen Namen Honorarnoten ausstellen und damit wie ein Mann selbstbestimmt Geschäfte machen. Sie ist quasi mit Brief und Siegel Malerin. Die Medicis werden zu ihren Auftraggebern. Das Motiv des Mordes von Judith an Holofernes malt Artemisia noch mehrfach, nicht mehr ganz so brutal wie im Jahr 1612. Sie passt ihren Stil an die unterschiedlichen Geschmäcker der Nobilitäten in Rom, Florenz und später Neapel an. Artemisia Gentileschi macht als Frau und als Malerin Karriere und kann gut von ihrer Kunst leben. 1638 wird sie sogar vom englischen König Charles I. nach London geladen, wo sie ihrem Vater bei der Bemalung der Decke im Queen’s House von Greenwich zur Hand geht. England ist ihr allerdings zu grau und zu kalt. Und die Krone zahlt zu schlecht. Nach zwei Jahren kehrt sie nach Italien zurück, arbeitet in Venedig, flieht vor der Pest und kommt wieder nach Neapel.
In der damals reichen Hafenstadt malt sie ein Bildnis der Maria Magdalena. Die Jüngerin von Jesus sonnt sich in göttlicher Ekstase. Der Titel des Bildes täuscht. Die durchaus dralle Frau, der die Bluse von der rechten Schulter rutscht und den Blick auf den weichen Busenansatz freigibt, träumt von erlebter Ekstase. Das Lächeln verrät alles. Es ist eine echte Frau, die Artemisia lustvoll porträtiert. Warum nicht sie selbst? Als Sünderin, der verziehen wird? Und die sich doch selbstbewusst daran erinnert, wie sich körperliche Liebe anfühlt.
Artemisias künstlerische Leistungen werden von der Exzentrik ihrer malenden Zeitgenossen in den Schatten gestellt. Erst in den vergangenen Jahrzehnten taucht sie und ihre große Kunst wieder aus dem Schatten der Geschichte auf. Die malenden Männer ihres Lebens verblassen neben ihrem Nachruhm. Ihr Vergewaltiger (und Liebhaber) Agostino Tassi wird zwar schuldig gesprochen, aber eine Gefängnisstrafe tritt er nicht an. Er verlässt Rom und arbeitet weiter als gefragter Landschaftspinsler. Gelegentlich erhält er auch Aufträge von Artemisias Vater Orazio.
Artemisia wird nach ihrem Tod im Jahre 1654 in Neapel auf dem Friedhof San Giovanni di Fiorentini beigesetzt. Überliefert ist nur die Inschrift auf ihrer Grabplatte: »Heic artimisia«.