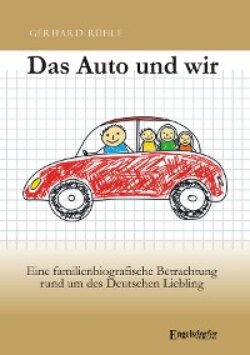Читать книгу Das Auto und wir - Gerhard Rühle - Страница 5
»Damals«
ОглавлениеAllmählich verdämmerte der Tag. Ein Hauch Abendluft zog durch den Fensterspalt herein, knapp an meinem Bett vorbei, jedoch ohne die erhoffte Kühlung zu bringen. Vielmehr trug dieses sachte Wehen das breite Gequake der Frösche vom Ententeich zu uns herüber.
Überhaupt – es musste ja fast ein Kilometer bis dorthin sein – wieso kam dieses Naturkonzert so volltönend daher und was hatten die Frösche auf diese Weise zu quaken? Warum konnten sie so übermütig sein, wo bei uns im Jahre 1945, in der Speisekammer der Küche, die einstige Fülle, längst der »Nachkriegsmagerkeit« Platz gemacht hatte? Es klang richtig hohl, wenn man die schmale Holztür unseres Vorratsraumes wieder zuklappte.
Darum musste ich auch nach der Schule, nach dem Essen, nach den Schularbeiten – hinaus in den 750 Quadratmeter großen Garten. Das betraf natürlich hauptsächlich die regenfreien Tage, aber schon seit anderthalb Wochen hatte sich nicht eine Wolke am weiten Firmament sehen lassen. Der Lenz herrschte ungehindert, die Sonne strahlte vom Himmel herab – es flimmerte richtig wenn man über das flache Land blinzelte.
Genauer gesagt war das was wir »Garten« nannten, zu dieser Zeit in Wirklichkeit noch ein Feld, denn die eingrenzenden Zaunlatten und selbst die Nägel dafür, konnte mein Vater erst ein Jahr später heranorganisieren. Dafür baute er für einen Neubauern im Nachbardorf einen PKW-Anhänger mit zwei Vollgummirädern.
Dieser wiederum hatte im Zuge der Bodenreform »Junkerland in Bauernhand« einen Streifen Wald zugewiesen bekommen, in dem als Gegenleistung fünf mittlere Fichten gefällt und dann mit einem Pferdewagen in das nahe gelegene Sägewerk transportiert wurden. Wobei eine davon »hängen blieb«, das bedeutete, in Zahlung gegeben werden mussten. Jedenfalls kamen wir auf diese Weise zu Brettern und auch zu den Zaunlatten. Irgendwann im nächsten Frühjahr brachte Papa aus einem Lager des ehemaligen Flugplatzes auf dem Fahrrad eine Rolle Draht mit, welche halb ausgerollt zwischen Flugzeugschrott gelegen und bisher noch keiner gebraucht hatte. Dieser Draht wurde dann in der Nagelschmiede der Stadt, trotz der Warnung des Werkstattmeisters, der uns auf die mangelnde Festigkeit des Materials hinwies, zu Nägeln verarbeitet. Bald kamen diese mit dem Spediteur zurück, ordentlich in zwei Pappkartons verpackt. Sie machten einen faszinierenden Eindruck, da es sich um verzinkten Draht gehandelt hatte und nun auch die Nägel in diesem Grau schimmerten. Aber was ihr Problem blieb, offenbarte sich schnell bei der Verarbeitung im Garten. Die Nägel sahen zwar äußerlich wie Nägel aus, waren aber in Wirklichkeit zu weich. Jeder Schlag, der den Nagelkopf nicht genau in der Mitte traf, verbog den schönen schlanken Schaft. Aber ich hatte keine Wahl, die Einzäunung musste fertig werden und mit der Zeit lernte ich es auch, genauer zu arbeiten. Zudem halfen mir Kneifzange und Eisenklotz, welche den Weg der Nagelung mitmachten, um die »Verunglückten« wieder heraus- und gerade zu bekommen.
Den krönenden Abschluss des Zaunprojektes bildete das Einsetzen des Gartentores, mit den vom Tischler oben abgerundeten und gehobelten Latten. Mein Vater lötete dem Meister als Ausgleich seine gebrochenen Bandsägeblätter wieder zusammen. Das gehörte zum ungeschriebenen Gesetz jener Zeit. »Einander die Hände zu waschen« und wurde oft angewendet – musste angewendet werden.
Allerdings baute Vaters Mitarbeiter das schöne Tor verkehrt rum an, wobei das besonders gestaltete Oben nun unten hing und schwerlich wieder geändert werden konnte, da er alle Löcher schon reingebohrt hatte. Anfangs musste ich wegen dieses kuriosen Kopfstandes, bei jedem Gartenbesuch am Eingang grienend stehenbleiben. Erst als später am Tor ein Schild mit der Grundstücksnummer angebracht wurde, bekam unser Eingang wieder ein einigermaßen normales Aussehen.
War das ein Gefühl, wie sich allmählich die vielen angenagelten Latten zu einer Umzäunung fügten und so das Stück Feld zu unserer Parzelle wurde, sogar zu einer Wehr gegen die Feldhasen, die alles junge Grün sehr mochten.
Unser Familienoberhaupt, hatte auch nach der Arbeit oft Wege zu erledigen, um alles Lebensnotwendige zusammen zu bringen. Von besonderem Nutzen war dabei der »Gummiwagen«, eine etwas größere, recht stabile Holzkiste, mit zwei an den Seiten befestigten Autorädern.
Zum Führen des Gefährtes wurden nach hinten zwei hölzerne Arme angebracht. Zusätzlich hatte mein Vater die Enden dieser Holme mit einem dicken Strick verbunden, damit man sich bei einer Steigung richtig hineinstemmen konnte. Dieses vorzügliche Transportmittel hatte er seinem Freund, dem Richter Kurt abgeschwatzt, natürlich gegen eine entsprechende Vergütung. Diese Karre fuhr nahezu unhörbar, selbst auf rauen Wegen. Auch in der Nachbarschaft war sie begehrt, weil sie bei deren nächtlichen Besorgungen so leise »rollte und rollte.« Oft klingelte es an unserer Tür und nach dem Öffnen kam die Frage: »Können wir am Donnerstag den Gummiwagen bekommen – so nach sieben?«
Auch ich musste hin und wieder in der Dunkelheit mit diesem »Schleichgefährt« losziehen, etwa in das Nachbardorf, zu dem Neubauern, nahe am Ortsrand. Mein Vater kam später mit dem Fahrrad nach. Obwohl ich nicht direkt Angst bekam, wenn ich ganz allein durch den dunklen Wald schob, schließlich wusste ich ja, dass diese späten Wege notwendig waren. Vater hatte eben ewig zu tun und doch atmete ich auf, wenn ich kurz vor dem Ziel, hinter mir das Rollen seines Rades hörte. Heimwärts schoben wir dann gemeinsam die gewichtige Beute. Wieder einmal schafften es drei Eggen, die mein Vater für den Neubauern zusammengeschmiedet und geschraubt hatte, dass wir dafür mit einer ganzen Fuhre Zuckerrüben von dessen Hof loszogen.
Und auf dem Rückweg dann, als es bergab ging, brachte uns die nahrhafte Fuhre mit dem Fahrrad obenauf, mächtig auf Touren. Wir mussten bei diesem unbändigen Gerenne so lachen und empfanden es als einen richtigen Jungenspaß, ein Erlebnis das auch meinen Papa noch deutlich an seine Kindheit erinnerte.
In unserer Wohnung, im Schlafgemach der Eltern mussten ebenfalls ungewöhnliche Veränderungen stattfinden. Zwischen Mamas dunkelpolierten, geliebten Möbeln stand völlig unpassend eine ziemlich große, sogar gefederte, Ersatzteilkiste vom Flugplatz. Die Beschriftung wies noch darauf hin, dass darin ehemals empfindliche Instrumente der Firma Heinkel transportiert wurden.
Jetzt hatten darin anderthalb Zentner wunderbarer Roggenkörner ihren Platz gefunden. Allerdings war der Pegelstand dieses lebenswichtigen Gutes, je nach Jahreszeit recht unterschiedlich hoch. Schon im Frühjahr mahnte der allmählich sichtbar werdende Holzboden zur Sparsamkeit. Aus dieser Lebenskiste versorgten wir uns freilich zu oft mit einer körnergeschroteten, dunklen Suppe, die ab und an sogar mit Süßstoff, vom Schwarzmarkt aus der Stadt, schmackhaft gemacht wurde.
Häufig wenn ich ins Schlafzimmer musste, blieb ich bei der Kiste stehen, klappte den Deckel an die Wand, grub meine Hand in die Körnermenge und ließ diese Flut allmählich wieder zurückrieseln; ein seltsames Empfinden der Sicherheit ging von diesem Geriesel aus. Ein Korn hing noch innen zwischen Zeige- und Mittelfinger. Ich holte es auf die flache Hand hervor und betrachtete es genauer; so klein und wiederum so bedeutsam! Für ein Brot – wie viele Körner mussten da zermahlen werden? Lieber Gott, hättest DU sie nicht ein bisschen größer machen können? Und doch, es funktionierte mit dem täglichen Brot, wenn auch zu dieser Zeit recht dürftig.
Gleich neben der Kiste, also hinter dem dunkel glänzenden Kleiderschrank, der Stolz meiner Mutter, hockte gleichfalls fehl am Platze ein abgeschabter runder Essenbehälter mit Deckel. Er war kürzlich von den Amis stehen gelassen worden. An manchen Stellen ließ sich, an den Resten der grünen Farbe, noch seine Armeeherkunft ausmachen. Aber jetzt wurde in ihm unser wunderbarer Zuckerrübensirup aufbewahrt.
Vorigen Herbst hatten wir deswegen abwechselnd, aber die ganze Nacht, unten im Waschhauskessel rühren müssen, damit das kochende Wallen des Saftes bei seinem »Dicker-Werden« nicht anbrannte. Und nun schaute er mich in seinem dunklen Schimmer verlockend an. Freilich ging es ihm ähnlich wie den Körnern in der nachbarlichen Kiste; langsam sackte der Pegelstand nach unten, woran ich mich oft heimlich beteiligte.
Denn manchmal brachte ich es fertig, das tägliche Brötchen der Schulspeisung, nur mit dem Hintergedanken an diese dunkle Süßigkeit, mit nach Hause zu bringen. Dann hockte ich vor den Ami-Pott, nahm langsam den Deckel herunter und tunkte genüsslich das Brötchen hinein. War das ein Fest nach der schweren Schularbeit!
Als unser Lehrer Geburtstag hatte, berieten wir in der Klasse was zu tun sei; denn wir mochten ihn. Nach einigem Hin und Her über Basteleien und Blumen, die uns als Jungs nicht so lagen, tauchte unvermittelt der Vorschlag mit den Brötchen aus unserem täglichen Kontingent auf. Einige schauten etwas unschlüssig drein, als sie an die ihnen so wichtige Pausennahrung dachten. Bis einer das Zögern beendete: »Es wird doch einmal gehen und damit keiner benachteiligt ist, geben wir alle unser Brötchen«. »Alle?«, kam es verstohlen aus einer Ecke. »Ja, alle – das wird ein Spaß werden!«
Seltsam, mit dem Hinweis auf das angesagte Vergnügen, wurden die Zögernden schließlich überzeugt und der Hunger musste diesem frohen Erlebnis weichen, – so wurde es wirklich ein Fest.
Natürlich wollte unser Lehrer dieses Opfer zunächst nicht annehmen, aber dann gab er uns doch seine Tasche heraus. Wir schichteten diese 32 kleinen, dunklen Brötchen hinein und malten uns aus, was wohl daheim seine Frau sagen würde, wenn ihr Mann, aus dem Schuldienst kommend, so unvermittelt diese wundersame Flut von Brötchen auspackte.
Auf dem Felde also hatte ich alle trockenen Pflanzen zu begießen, vor allem die durstigen Tomaten, deren Blätter oft erbarmungswürdig herunterhingen. Dabei ging es mir noch gut, da ich mir die Arbeit selbst einteilen durfte und ich dem schlappen Grün auf unserer Plantage, dem ehemaligen Feld des Rittergutes, das Wasser äußerst gerecht, das hieß für meine Begriffe, sparsam zuteilte. Wir konnten uns auch nicht immer sattessen. Die anderen Siedler hatten durch die Bodenreform 1.000 Quadratmeter Land bekommen. Uns hingegen war nur ein Restgrundstück, das 750 Quadratmeter große Eckareal, zugeteilt worden. Dafür brauchte ich nur noch über die Straße zum nahen Bach zu gehen. Der wies allerdings eine leicht schillernde Oberfläche auf – vermutlich von der Einleitung geheimer Abwässer.
Die übrigen Leute kamen mit ihren Handwagen, Schubkarren, Tonnen und Eimern, um das seit Tagen ausgebliebene köstliche Nass auf diese Weise heran zu schaffen. Oft bildete sich durch diese regenlose Trockenheit an der tieferen Schöpfstelle eine Schlange.
Indessen ich weiter unten, zwischen den beginnenden Feldern, durch die Brennnesseln (Indianerprobe) des Ufers, barfuß in das Wasser stieg und mit dem verbeulten Wehrmachtskochgeschirr, meinen Eimer vollschwabbelte. Trotzdem, so eine Hitze und gestern muss es noch ärger gewesen sein, denn der Durst trieb mich dazu, eine von den halbreifen Tomaten zu essen, die sich aber infolge meines sparsamen Gießens, noch ziemlich hart anfühlte und deren weniger Saft mich trotzdem dazu verführte, sie kauend hinunter zu schlucken. Darauf wurde mir schlecht und ich kniete schließlich zwischen den Tomatenstöcken, wobei mir die Spucke von selbst aus dem Mund lief. Es war ein richtiges Elend.
Nicht mal das Fahrrad hatte ich an diesem Tag mitgenommen und so ging oder vielmehr schlich ich bald nach Hause. Dort angekommen fand ich nur Stille, – niemand da. Mit dem Gefühl von der Welt verlassen zu sein, schleppte ich mich in die Stube zur Couch – wo dann allmählich die Lebensgeister zurückkehrten.
Am nächsten Tag hatte ich vor dem Weggehen genügend Wasser getrunken und konnte am Schluss der täglichen Pflichtarbeit mit dem Fahrrad noch durch die Felder gondeln. Das geschah nicht ohne Absicht, denn am Rande eines Kleefeldes hielt ich an. Rupfte und stopfte dann schnell die alte, große Tasche meiner Mutter mit Kaninchenfutter voll – immer auf der Hut – damit mich dabei niemand erwischte. Der damals eingerichtete, sicher auch nötige »Flurschutz«, hatte nämlich überall seine Augen, – es wurde leider auch überall geklaut. Selbst ich als Kind hatte Teil an diesem Gebot; immerzu Lebensnotwendiges zu organisieren. Wieder andere hatten dieses Lebensmotto gar noch stärker verinnerlicht und eines Tages den alten DKW F5 des Bürgermeisters hochgebockt und die schon abgefahrenen Räder demontiert. Noch dazu passierte das Husarenstück gleich neben dem Rathaus!
Das erschien uns allen nun doch unglaublich. Als der Bürgermeister auf die Straße trat, um loszufahren, hing sein Gefährt recht hilflos auf ein paar Ziegelsteinen, er schwebte sozusagen in der Luft. Über diesen Vorfall mussten wir in der Schulpause schon lachen, jedoch nur beim ersten Hören der Geschichte, denn er wies ja auf einen tiefen Verfall der Achtung vor dem Eigentum Anderer hin, sogar vor dem Amtlichen. Nein, war das wirklich direkt vor dem Rathaus passiert, hat das denn keiner mitbekommen?
Selbst unser Kaninchenstall hinten im Garten sah aus wie ein Banktresor. Mein Vater hatte wegen der Unsicherheiten der Nacht zwei Millimeter starke Blechtüren über der Vorderfront angebaut, die mit einer Eisenstange, die bis in den angrenzenden Schuppen ging, zugesperrt werden konnten. Dort hinein musste ich jeden Abend, um zum einen das dazugehörige Vorhängeschloss einzuschnappen und zum anderen auch noch die Alarmanlage scharf zu machen. Papa hatte da drinnen eine Pressluftflasche mit einer alten Diesellokhupe stationiert. Die Karnickel hatten zum Glück keine Ahnung, dass dort im Ernstfall, bei einem gewaltsamen Öffnen der Blechtüren, ein Riesenradau losgehen würde. Die gemütlichen Tiere saßen wie immer in ihrer Ecke und mümmelten, allerdings diesmal am Klee herum.
Im Garten direkt vor unserem Kaninchenstall stand ein Sauerkirschbaum. Die Hausbesitzerin hatte mich immerhin noch freundlich und auch vorausschauend darauf aufmerksam gemacht, dass sie auch gern etwas von den Kirschen ernten würde, wohl wissend, dass fast alle, wie man damals sagte, »Kohlendampf« hatten.
Freilich kostete es mich viel Mühe, anständig zu bleiben, wenn ich täglich die Tiere fütterte und hinter mir alles voller dunkelroter, schwelgender Kirschen hing. Eigentlich sollte ich für das Karnickelvolk Hundeblumen holen, was sich aber als ziemlich mühsam herausstellte, weil jeder irgendwelches Viehzeug hielt und somit alle auf Futter aus gingen und deshalb gerade die Hundeblumen auf unseren Fluren nahezu ausgerottet hatten.
Wenn ich meiner Mutter auf ihre täglichen »Hast-du-schon-Fragen« endlich mit meinem täglichen »Ja-Mutti« antworten konnte, hockte ich mich ans Küchenfenster, um die Ankunft des kleinen LKW, eines umgebauten Wehrmachts-Phänos nicht zu verpassen, den Herr Ludwig fuhr, der Hausbewohner unter uns.
Das war eines der beiden Glücksmomente, die unsere inzwischen größere Wohnung, mit Toilette auf halber Treppe und nicht mehr auf dem Hof, aus meiner Sicht zu bieten hatte. Zu ihr gehörte sogar ein Gemeinschaftsbad, das sich die sechs Parteien des Hauses teilten. Es war ein ungewohntes Vergnügen, wenn ich am Wochenende in die große, bis oben gefüllte Badewanne völlig bis zur Nasenspitze eintauchte und von dieser sanften Flut umgeben, die Gedanken überall hin- und davon spazierten, bis mich das kühler werdende Wasser an den eigentlichen Zweck, die nötige Reinigung, erinnerte.
Das zweite große Glück dieser neuen Wohnung hing mit dem Blick nach hinten hinaus zusammen, wo ich mich augenblicklich im Bett herumwälzte und wegen des Gequakes nicht einschlafen konnte. Von diesem Fensterplatz aus war es möglich, das kleine Haus drüben – auf der anderen Straßenseite zu beobachten. Dort kam manchmal, wenn ich eben Glück hatte, »Bruni« aus dem Haus und ging den Gartenweg entlang, machte vorn das Tor auf und wieder zu. Danach sah ich sie, mehr von der Seite, noch zwanzig Meter auf dem Fußweg gehen, bevor mir das Vorderhaus die Sicht versperrte. Brunhilde ging in die Klasse meiner jüngeren Cousine. Ihr braun gebranntes Gesicht mit den zwei festen Zöpfen konnte ich, natürlich heimlich, immerzu und noch länger anschauen.
Sie gehörte zu der privilegierten Schicht unserer kleinen Stadt, denn ihre Großeltern betrieben die Mühle jenseits der Bahnschienen, die neben der Bäckerei und dem Fleischer, zu den wichtigsten Betrieben in unserem Ort zählte. So kam es, dass sie öfters das Haus verließ, um in die Mühle hinüber zu gehen, was für mich von Vorteil war und zu dieser »Fenstersitzaktion« anhielt. Dieses kleine Glück dauerte ja nicht einmal fünf Minuten. Trotzdem saß ich deswegen manchmal zwei Stunden auf meinem Posten und blinzelte hinüber, wobei ich meinen Blick immer auch mal ein Stück die dahinter liegenden Bahngeleise entlang schweifen ließ, um durch diesen Wechsel meine Augen wach zu halten. Meistens hatte ich dabei ein Buch zur Hand, wegen der möglichen Anfrage meiner Mutter, diese ausdauernde Fensterposition betreffend, – ganz schön raffiniert, – was?
Zu guter Letzt, eilte der Blick das zwanzigste Mal zur Hausecke und erhöhte die Spannung: »Jetzt kommt sie!«
Und wenn sie dann wirklich um die Ecke herum schritt und gar herüberschaute, was freilich nur versteckt geschah, damit ich es nicht merken sollte und ich dabei ihr winziges Lächeln erspähte, – da hatte die lange Wartezeit überhaupt keine Bedeutung mehr. Ich fühlte einfach ein warmes Glück, so irgendwo »da Drinnen« wie ein wundersames Geheimnis, mehr noch, als von dem belebenden Sonnenschein am Morgen.
Zugegeben; ich wunderte mich selbst über diesen Sinneswandel, der auch bei mir einiges auf den Kopf stellte. Noch bis vor kurzem war den Mädchen von uns Jungs – nur ein minderwertiger Status in der menschlichen Gemeinschaft zugegeben worden. Sie erschienen uns zu brav, zu bieder, dazu immer dieses Gerede und Gekicher; nein, – das war nicht unsere Welt.
Und dann, mit einem Mal, schaute ich anders und auch länger hin und war von ihrem Gruß beglückt. Was passierte da eigentlich?
Es brach ganz von selbst über mich herein, so wie der Frühling mit seinem lauen Wehen oder wie die Stille der Nacht und dem unendlichen Sternenzelt, – wer weiß es, – jedenfalls kam es zu mir ohne dass ich etwas dazu tat.
Ganz anders empfanden wir Kinder nach diesen sechs unheilvollen Jahren das Ende des Krieges – da löste sich eine unsägliche Anspannung auf. Nicht nur, dass die Verdunklungen endlich herunter genommen werden konnten, rief Erleichterung hervor – sondern auch, dass wir von diesen täglichen Unsicherheiten befreit waren: »Werden sie heute Nacht wieder kommen? Wieso fliegen sie jetzt schon am Tag über unser Land – wenn auch ziemlich hoch?« Der Rhythmus der nächtlichen Luftschutzkeller-Wanderung hatte sich schon in unseren täglichen Ablauf eingenistet. Die vollständige Hausgemeinschaft traf sich halb Zwölf oder um Drei, nochmals da unten.
Darum hörten wir nahezu ungläubig, die eigentlich lang erwartete Nachricht: »Der Krieg ist aus, die Schlacht hat aufgehört!« Doch hinter dieses Aufatmen drängte sich gleich die bange Frage: »Was wird nun werden?«
Natürlich sah man allerorts die Trümmer der Bombardierungen, den unheimlichen Zusammenbruch. Dazu kamen die offenen Fragen nach unseren Onkels und Cousins in der Gefangenschaft und den vielen Vermissten, – wer von ihnen lebte noch?
Doch der Sommer erwärmte trotzdem das Land. Die großen Ferien kündeten sich in der wieder begonnenen Schule mit etlichen Abschlussarbeiten an, die allerdings jedes Mal meine Erkenntnislücken offenbarten. Immer wenn der Lehrer, mit dem Stoß der unheimlichen Prüfungshefte unter dem Arm in das Klassenzimmer kam, machte sich in meinen Inneren ein unruhiges Flattern breit.
Aber mit jeder dieser Zitterpartien, bei denen man nur dieses Heft und die blöden Fragen an der Wandtafel vor sich hatte, rückte das verheißungsvolle Wort »Ferien« näher. Oh, – wie würden wir dann die Treppe hinunter stürmen, wo wir doch eigentlich ordentlich gehen sollten. Endlich frei, zwei Monate keine Schule, das erschien uns wie eine traumhafte Zeit, die bald anbrach.