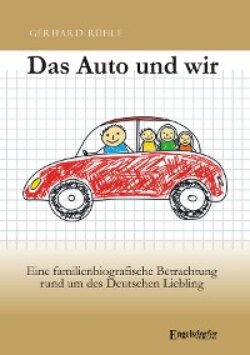Читать книгу Das Auto und wir - Gerhard Rühle - Страница 8
Die Gründergeneration
ОглавлениеDa wäre zum Beispiel Rudolf Diesel zu nennen, der deutsche Ingenieur (noch vor 1900 geboren), welcher mit seinem Assistenten, sieben Jahre, Tag für Tag sieben lange Jahre, in einer Augsburger Maschinenfabrik, baute und probierte, bis dieses erste Monstrum eines Motors richtige Arbeit leistete.
Für mich wäre mit dem Dasein des Ottomotors die Entwicklung derartiger Kraftmaschinen längst abgeschlossen gewesen. Doch im Endergebnis dieser zweiten Motorvariante, des »Diesels«, kam doch ein Antriebsaggregat zustande, welches einen größeren Kraftbedarf, wie er bei Schiffsmotoren nötig war, schaffen konnte und im unteren Drehzahlbereich fast ein Drittel mehr Energie aus dem Kraftstoff heraus holte, – ein nicht zu übersehendes Argument.
Praktischerweise hatten die beiden Männer, er und sein Monteur, den Motor in einem Raum der Augsburger Maschinen-Fabrik aufgebaut und zugleich mit einen Riemen, an der dort befindlichen Transmission angekoppelt.
Diese Transmission mit ihren vielen Laufrädern an der Decke der Halle wurde von einer einzigen Dampfmaschine angetrieben, eine damals übliche Art einen ganzen Betrieb mit seinen vielen Maschinen in Bewegung zu bringen.
Wenn die zwei Männer den Motor starten wollten, brauchten sie nur den auch bei ihnen angeschlossenen, rollenden Riemen, mit einem Hebel von der Leerlaufrolle, auf die feste zu schieben und schon kam die Drehbewegung auch dort an. Dieser erste Dieselmotor hatte anfangs auch mehr die Gestalt einer stehenden Dampfmaschine und ragte, wie eine riesige Standuhr auf. Unten in einen breiten, wie auch hohen Gussständer hatten sie das Schwungrad mit dem Kurbeltrieb eingelagert, von dem die Kolbenstange in den offenen Zylinder nach oben führte und ebenso gaben lange Achsen das Drehen von unten nach oben an die Ventile weiter. Der Raum wurde von diesem sperrigen Maschinenturm deutlich beherrscht, obwohl er sich zuerst nicht so recht in den Willen seines Erfinders fügen wollte. Immer wieder ging etwas zu Bruch und hielt der hohen Verdichtung des Kraftstoffes von 1:18 nicht stand, bei der sich Drücke bis zu 50 bar entwickelten und die Temperatur auf 800 Grad Celsius kletterte. Indessen der 1877 beim Patentamt angemeldete Benzinmotor von Nicolaus August Otto seine Arbeit bei einer Verdichtung von 1:7 verrichtete und mit der Temperatur etwa bei 500 Grad Celsius blieb – was sich als beherrschbarer herausstellte.
Zurück zu Diesels denkwürdigen Tag, aber eben nach sechs Jahren des Grübelns, des Bauens und wiederum des Trümmer-Rausschaffens und des neuen Anfangs – geschah es!
Der neu zusammengebaute, riesige Selbstzünder-Motor sprang an, aber dieses Mal tuckerte er in einem unentwegten Lauf weiter, wobei alles zusammen hielt; die Zylinderwände, der Kolben und auch die Lager.
Das Besondere dabei, worauf der Assistent in dem Krach aufmerksam wurde; – der Antriebsriemen hatte sich nach der anderen Seite gestrafft, das bedeutete, der Motor zog jetzt mit an der Transmission, – er brachte Leistung zustande. Man berichtete, der Mann, der neben Rudolf Diesel das »Auf und Ab« über so lange Zeit geduldig mitgemacht hatte, nahm in diesem Augenblick ehrfurchtsvoll seine Mütze vom Kopf.
So ein besonderer Augenblick, – der Anfang des Wirkens von Tausenden solcher Kraftmaschinen.
Wieder zu uns. Mein Vater hatte die unliebsame Eigenschaft mich auch in den Schulferien noch mit Schule zu beschäftigen. Alle meine Argumente, dass ein Schüler, in dem Fall sogar sein Sohn, doch Zeiten des Ausspannens benötigte, ließ er nicht gelten und fügte unangefochten hinzu, dass er mich erstens mag und gleichzeitig einschätzen könne und darum nicht überlaste. Zum Zweiten ist wochenlanger Müßiggang für einen kräftigen jungen Burschen, wie es sein Sohn sei, nicht gut. Da stand mit einem Mal dieses Wort Müßiggang vor mir. Woher er das nur hatte, es tauchte noch nie bei ihm auf und machte wahrhaftig auf mich einen zähen und unangenehmen Eindruck.
So hatte, schon vor einem Jahr, diese Sonderbeschäftigungen wie das Lernen von Schillers Glocke begonnen. Freilich musste ich mir andererseits auch eingestehen, dass sich seitdem die Schillersche Weisheiten, in verschiedenen Situationen meines Lebens, deutlich spürbar markierten. Dabei wurden gewissermaßen die Vorstellungen seiner Dichterei in meiner Praxis bestätigt, was mich nicht unerheblich beeindruckte. In dem Fall stellte es mein Vater recht diplomatisch an; er diktierte mir nur die zu lernenden Verse der »Glocke«, somit konnte ich die Monumentalität dieses Kunstwerkes im Voraus nicht erkennen – welches auch wirklich ewig nicht zum Ende kam. Doch einmal hatte er das Buch liegengelassen. Schnell nahm ich es zur Hand, um den letzten Vers zu suchen, wobei ich Seite um Seite zu blättern hatte, um bis zu diesem Punkt zu gelangen. Wie erschlagen blätterte ich die vielen Seiten noch einmal zurück; – wie konnte man ein kleines Schülerleben mit so umfangreichen »Verselernen« verderben? Oh Papa, ich wollte es nicht einsehen, trotz der hier und da auftauchenden Erkenntnisse, es dauerte schon bei mir, – mit der Einsicht.
Jedoch als ich mir nochmals die »Rudolf-Diesel-Situation« vorzustellen versuchte, wie die zwei Männer in ihrer Werkstatt Tage, Wochen, ja, Jahre gebaut, neu geplant und gerechnet, gemessen, überlegt und wieder gebaut hatten. Wie ihnen dabei auch die Brocken um die Ohren flogen und Außenstehende abrieten weiter zu machen, weil solche Drücke einfach nicht in den Griff zu bekommen sind.
Wie müssen sie am Schluss vor dem herumwirbelnden Ungetüm gestanden haben, was dann doch, seine Arbeit verrichtete?
Bis zuletzt Anspannung und nun ein unübersehbares Lächeln in der ganzen Werkstatt, bis hin zum respektvollen »Mütze-Abnehmen«. Wieder tauchte jenes literarische Leuchten aus Schillers Glocke auf:
Das ist´s ja was den Menschen zieret
und dazu ward ihm der Verstand
dass er im innern Herzen spüret,
was er erschafft mit seiner Hand.
Großartig! Wie auch das Innere unsres Wesens beteiligt ist, – ein der menschlichen Würde entsprechender »Werdegang.« Dabei dürfte sich auch das härtere »t« einfügen lassen; – demzufolge ein ersichtlicher »Wertegang.« Die Arbeit soll nicht nur mechanische Funktion sein, sondern uns kommt es zu auch Anteilnahme zu empfinden, was unter unseren Händen geschieht. Meine Güte das klingt ja fast philosophisch.
Onkel Karl aus Leipzig, ein gebildeter Mann unserer Familie, sagte einmal beim Schachspiel zu mir: »Man kann erlebte Zusammenhänge, besondere Abschnitte unseres praktischen Lebens eben so gut geistig beschreiben.« Vermutlich erschienen hier diese Zusammenhänge recht greifbar?
Natürlich ist so ein »Schaffenserlebnis« bei heutiger Arbeitsteilung und dem emsigen Wirken der Arbeiter am Fließband recht schwierig geworden. Andererseits haben sonderlich die Amerikaner, mit dieser funktionellen Wirksamkeit, erhebliche Vorteile der billigeren Produktion in Szene gesetzt.
Als die ersten Autos von Henry Ford, dem Schrittmacher der Wirtschaftlichkeit, über das große Wasser zu uns kamen, klappten die Deutschen natürlich die Motorhaube auf und ihre Enttäuschung muss augenscheinlich gewesen sein, als sie da vorn keine geputzte Antriebsmaschine vorfanden, sondern einen grauen Gussblock, – einfach so.
Wie sollte es nun weitergehen; Technik mit funktionellen Arbeitsabläufen, die dem Menschen in seinem Bemühen beisteht, in dem sie Last abnimmt und Zeit einspart, aber ihn auch spezialisiert und damit vom Ganzen wegdrängt.
Oder weiterhin das ganze Produkt einzeln herstellen, wie im Beispiel des Schmiedes, welcher den Pflug aus seiner Vorstellung, über das Hochheizen des Feuers, dem Ausziehen und Formen des glühenden Stahles, bis zum Anschrauben an das Gestänge, mit seinem Lehrling selbst machte? Wobei der Zusammenhang; vom Auftrag bis zum fertigen Ackerpflug, erhalten blieb.
Hier erscheint natürlich bei dem von Ford eingesetzten Fließband, die maßgebliche Frage: »Geben wir etwa mit so einer Spezialisierung, ein Stück unserer Seele hin?«
Natürlich hat das Argument des Fortschrittes sein Gewicht: Wenn wir weiterhin so ursprünglich, wie der Schmied verfahren würden, wer könnte sich dann noch eine Waschmaschine leisten, wenn dieser Mann mit seinem Lehrling, sich allein der Aufgabe zu stellen hätte. Wann würde diese Maschine endlich Wäsche waschen?
Wo ist der Weg, zwischen dem zu teuer und dem Verlust des Zusammenhanges? Das ist schon eine Frage, welche leider die meisten unserer Mitmenschen, nicht mehr stellen. Wenigstens müsste man sie im Hintergrund um der richtigen Einschätzung willen, in unserem Bewusstsein erhalten.
Ein Bild der DDR Kunstausstellung von 1982 in Dresden, brachte es auf den Punkt. Dort hatte der Künstler ein solches Fließband dargestellt: klein nur, aber mit allen charakteristischen Elementen. Zwei Frauen sortierten Zwiebeln aus, die auf einem Fließband an ihnen vorüber glitten. Der Prozess schien schon in einer fortgeschrittenen Phase zu sein. Sie hatten sich eingearbeitet, ihre Leistung erhöht, ihr Arbeitsergebnis wurde besser, preiswerter. Aber man sah auch die innere Veränderung, den Verfall ihrer Persönlichkeit, – indem die Züge ihres Gesichtes allmählich denen einer Zwiebel ähnelten.
Die Perfektion ihrer Arbeit machte aus ihnen das Produkt ihres Produktes. Zwiebeln, – nur noch Zwiebeln!
Der Gedankengang geht noch weiter. Bestimmt hat unser höchster HERR im Himmel, damals am Anfang unserer Welt, dort im Garten Eden uns nicht nur aus Fleisch und Blut gemacht, – damit sind viele Lebewesen ausgestattet, mit all den dazu gehörenden Abläufen, – sondern das Besondere ist diese göttliche Ähnlichkeit:
So steht es im Urtext.
»GOTT schuf den Menschen als Sein Ebenbild, – als Mann und als Frau.«
Wunderbar dieser Satz, wie ein gewaltiges Portal, steht er am Eingang unserer nun bewohnten Erde.
Also der Mensch, soll immer er selbst zu bleiben. Dieses Prinzip nie aus der Hand geben, das ist wohl gemeint. Nach Seinem Wort übertragen: Mensch mit eigener Seele, jeder!
Wieder so ein hohes Wort, aber es ist nicht die Absicht, große Worte wie von oben herab zu deklamieren, nur einfach daran zu erinnern.
Unsere liebe Englischlehrerin zitierte es einmal in ihrer Mentalität: »That is the question.« Muss man somit Fragen auch richtig stellen und sich dann auch ihnen stellen? Nein, besser noch die richtige Frage stellen und sich dann von ihr anreden lassen.
Dort im Schulzimmer verstanden wir noch nicht ganz die zwingende Konsequenz solcher Argumente.
In dem Bild der Kunstausstellung wurde leider das Außen zum Innen. Eine Schwarz-weiß-Alternative; Fortschritt oder die Selbstständigkeit, so fragte es zunächst bei uns an.
Und damit erhebt sich die weitere Frage: Könnte es einen gemäßigten, einen behutsamen Fortschritt geben? Schwierig, ich mochte ja auch die Ergebnisse des Fortschrittes, wenn ich zum Beispiel das Geknatter von Onkel Arnos Motorrad auf dem Hof hörte.
Zurück zu meinen Vorfahren, wo es vor dem II. Weltkrieg, in der kurzen wirtschaftlichen Erholungsphase, gerade mal zu zwei Motorrädern in unserer Familie reichte. Onkel Kurts D-Rad, ein hochbeiniges Ungetüm mit einem 500. Einzylinder, der mit seinen acht PS über einen Keilriemen das Hinterrad antrieb. Nur vorn half eine Blattfeder über eine Trapezgabel die Unebenheiten der Straße zu mildern. In dem kräftigen Rohrrahmen hing ein dreieckiger Tank und an seiner Seite war der Handschalthebel mit richtigen Einkerbungen angebracht. Statt der heutigen Fußrasten übernahmen zwei umfangreiche Blechbretter mit Gummi überzogen an den Außenseiten die bequeme Auflage jeder Schuhgröße und oben über den halbrunden Lenker thronte unangefochten ein beachtlicher Scheinwerfer.
Er und sein Zwillingsbruder Hans hatten dazu nur einen Führerschein, weil sie kein Polizist auseinander halten konnte. Es ging da noch recht gelassen zu.
Onkel Gerds blaugraue Victoria, KR 35, machte mit ihrem rundlichen Tank über den Rahmen schon eine gefälligere Figur, wobei der Motor mit seinen zwölf PS, markanter loszog. Alle Wege der Kraftübertragung konnte man gut von Außen erkennen. Die Stößelrohre die hoch zu den Ventilen führten, die Kettenverkleidung zur Lichtmaschine hinter dem Zylinder und das kräftige Schaltgestänge hinunter zum Getriebe. Dazu gehörte ein zeppelinförmiger Seitenwagen mit rotem Polster, was dem Gespann eine gewisse Eleganz verlieh. Nicht zu vergessen den herzhaften Klang des »Eintopfes« mit dem das Gespann lospolterte.
Beide Männer blieben irgendwo in den Weiten Russlands, nur die Maschine mit dem Seitenwagen stand dann noch in der Garage.