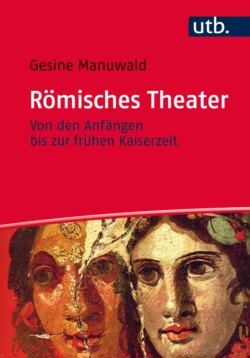Читать книгу Römisches Theater - Gesine Manuwald - Страница 11
3.2. Organisation
ОглавлениеDass an den Festspielen 240 v. Chr. ein Drama bzw. mehrere Dramen mit einem Handlungszusammenhang, entsprechend griechischen Bühnenstücken, in Rom auf die Bühne gebracht wurden, war eine politische Entscheidung. Von Anfang an waren also die dramatische Dichtung und vor allem deren Aufführungskontext nicht unabhängig von den politischen Entscheidungsträgern.
In Rom waren Magistrate für alle öffentlichen Spiele zuständig. Nach der Restrukturierung der öffentlichen Ämter in der Mitte des vierten Jahrhunderts v. Chr. wurden die Spiele zumeist von Aedilen organisiert, während die Konsuln das praesidium ludorum innehatten. Die meisten Spiele wurden von den kurulischen Aedilen (Ludi Romani, Ludi Megalenses) oder den plebeischen Aedilen (Ludi plebeii, Ludi Ceriales, Ludi Florales) veranstaltet; der praetor urbanus war verantwortlich für die Ludi Apollinares. Wegen der Begrenzung aller Ämter im republikanischen Rom auf ein Jahr übernahmen jedes Jahr andere Beamte die Organisation der Spiele.
Diese Amtsträger gaben die Produktion und Aufführung von Dramen in Auftrag und waren für die Zuweisung von Schauplätzen zuständig, was insbesondere in der Zeit von Bedeutung war, als in Rom noch keine festen Theaterbauten vorhanden waren (▶ Kap. 3.3). In der mittleren bis späten Republik standen für die Festspiele öffentliche Mittel zur Verfügung (lucar; Plut. qu. R. 88 [285D]). Zumindest in der späten Republik wurden diese in der Regel aus eigenen Mitteln der Beamten und denen ihrer Unterstützer und der von ihnen Abhängigen ergänzt. Daher sind etliche Forscher der Meinung, dass ehrgeizige junge Politiker die Massenunterhaltung bei den Festspielen sponserten, um durch die Ausgaben für Spiele Wählerstimmen zu gewinnen und so ihre zukünftigen Karrieren zu sichern. Diese Auffassung ist jedoch aus verschiedenen Gründen in Zweifel gezogen worden. Während die Sicht, dass die Beamten an den von ihnen veranstalteten Spielen weitgehend uninteressiert waren, sicherlich zu weit geht, war wahrscheinlich der Aufwand für Spiele in der mittleren Republik noch kein so entscheidender Faktor für die Stellung öffentlicher Personen, wie oft angenommen wird. In der späten Republik wurde ein solcher Einsatz jedoch wichtig, wie sich an immer pompöseren Theaterbauten zeigt und Äußerungen Ciceros zu entnehmen ist. Auch wenn aufwendige Spiele immer noch nicht direkt für eine politische Karriere relevant waren, hatten sie offenbar für die Sicherung der Stellung eines Adligen eine Bedeutung und wurden von Magistraten erwartet (Cic. ad Q. fr. 1,1,26; 3,6,6; off. 2,55–60; dom. 111–112; Asc. zu Cic. Scaur. [p. 18 Clark]; Liv. 25,2,8; Suet. Iul. 10; Plut. Sull. 5,2; Cass. Dio 37,8). Diese Entwicklung erreichte ihren Höhepunkt im ersten Jahrhundert v. Chr.
Da die Magistrate mit ihren Geldbeiträgen öffentliche Veranstaltungen zu Ehren der Götter unterstützten, wurde die Finanzierung der Abhaltung von Spielen nicht notwendigerweise als eine negative Form von Ehrgeiz und Einflussnahme betrachtet. Diese Sichtweise mag ein Grund gewesen sein, warum das System potenziell außer Kontrolle geraten und nicht einfach abgeschafft werden konnte. Als die Spiele immer extravaganter wurden, übten Beamte für deren Finanzierung auch Druck auf die von ihnen Abhängigen aus und verlangten zusätzliche Unterstützung vom Senat. Dieser beschloss jedoch Grenzen für die insgesamt auszugebenden Geldmittel, vor allem für einmalige, von Einzelpersonen veranstaltete Spiele (Liv. 39,5,7–10; 40,44,9–12). Außerdem wurden Regeln eingeführt, die Kandidaten für politische Ämter daran hindern sollten, Spiele im Wahlkampf einzusetzen.
Als Ausrichter der Spiele kauften die zuständigen Magistrate Dramen von Dichtern (vielleicht auf Empfehlung eines ‚Impresario‘) oder von ‚Impresarios‘ (‚Schauspieler-Managern‘), die die Texte von Dichtern erhalten hatten (▶ Kap. 3.6). Ob es feste Sätze pro Drama gab, ist unklar, aber offenbar waren Beamte nicht an bestimmte Summen gebunden. Sonst hätte Terenz’ Eunuchus dem Dichter nicht einen angeblich beispiellos hohen Betrag einbringen können (Suet./Don. vita Ter. 3; Don. zu Ter. Eun., praef. 1,6*; ▶ Kap. 3.5). An den Spielen konnten Beamte einen Palmzweig als Siegespreis an erfolgreiche Schauspieler oder andere Künstler verleihen, wobei nach Plautus Korruption möglich war (▶ Kap. 3.6).
Da Politiker auf Aufführungen aus gewesen sein müssen, die versprachen, beim Publikum gut anzukommen, dürften sie Dramen mit dramatischem Effekt und nicht-kontroversem Inhalt oder Stücke bereits erfolgreicher Dichter bevorzugt haben. Es ist jedoch unsicher, ob und in welchem Rahmen sie vor dem Kauf Informationen über die Dramen erhielten oder welcher Art die Auswahlkriterien waren. Der Text des Prologs zu Terenz’ Eunuchus (Ter. Eun. 19–22) impliziert, dass in diesem Fall die Beamten eine ‚Vorschau‘ bekamen. Diese scheint jedoch stattgefunden zu haben, nachdem die Aedilen das Stück gekauft hatten, und man weiß nicht, wie sie reagierten und ob diese Reaktion einen Einfluss auf die endgültige Form des Stücks hatte (abgesehen von der Erwähnung der ‚Vorschau‘ im Prolog).
Unabhängig von den Details des Auswahlprozesses hat es vermutlich eine gewisse Korrelation zwischen der Thematik der Stücke und den verantwortlichen Magistraten gegeben. Beispielsweise wurden Terenz’ Komödien Hecyra (zweite Aufführung) und Adelphoe an den Ludi funebres für L. Aemilius Paul(l)us 160 v. Chr. aufgeführt, die seine leiblichen Söhne veranstalteten; die Themen der Erziehung und des Verhältnisses zwischen Generationen, um die es in den Dramen geht, wurden vielleicht als passend für eine solche Gelegenheit betrachtet. Ennius’ Thyestes enthält Überlegungen zu Naturphänomenen und wurde zum ersten Mal an Spielen gezeigt, die der Praetor C. Sulpicius Gallus, der an Astronomie interessiert war, ausrichtete (▶ Kap. 3.1).
Da die meisten Spiele aus religiös motivierten Gründen eingeführt und zu Ehren von Gottheiten veranstaltet wurden (z.B. Cic. Cat. 3,20; Liv. 6,42,12; Lact. inst. 6,20,34–6), waren die ludi scaenici in einen religiösen Kontext integriert. Der zeitliche Zusammenhang mit religiösen Zeremonien und die jeweilige lokale Nähe der Aufführungsorte dazu machten diese Verbindung sinnfällig (▶ Kap. 3.3).
Die Festspiele begannen mit einem ‚feierlichen Aufzug bei den circensischen Spielen‘ (pompa circensis). Nach Dionysios von Halikarnass war das eine Prozession ausgewählter Beteiligter vom Kapitol über das Forum Romanum zum Circus Maximus. An der Spitze gingen römische Jünglinge, gruppenweise zu Pferd und zu Fuß, dann folgten Wagenlenker und Athleten, darauf Gruppen von Tänzern mit Musikbegleitung und von Silenen und Satyrn, die die Tänzer karikierten, sowie Musiker. Daran schloss sich der eigentliche Opferzug an, also Ministranten mit Weihrauch und Priester sowie Götterbilder, die dann von einem erhöhten Platz aus den Spielen ‚zusehen‘ konnten (Dion. Hal. ant. 7,72; vgl. auch Tert. spect. 7,2).
Die architektonische Struktur von ‚Theatertempeln‘, wie Pompeius’ Steintheater (▶ Kap. 3.3), verstärkte diese Verbindung zwischen den Spielen und dem Opferkult: Priester und Offizielle konnten am Tempel oberhalb des Zuschauerraums Opfer vollziehen und dann über die Treppe des Zuschauerraums hinuntergehen zu den Ehrensitzen gegenüber der Bühne (Suet. Claud. 21,1). Auch vor der Errichtung steinerner Theaterbauten in Rom waren Aufführungen von Dramen oft mit dem Tempel der jeweiligen Schutzgottheit verbunden, wenn der Aufführungsort in dessen Nähe war. So fanden, wie Cicero angibt, bei den Ludi Megalenses Aufführungen vor dem Tempel der Magna Mater auf dem Palatin statt (Cic. har. resp. 24), wo man eine einfache Konstruktion von Stufen um den Altar herum ausgegraben hat; Plautus’ Pseudolus wurde aus Anlass der Weihung dieses Tempels 191 v. Chr. aufgeführt (Did. zu Plaut. Pseud.; vgl. auch Cic. Cato 50).