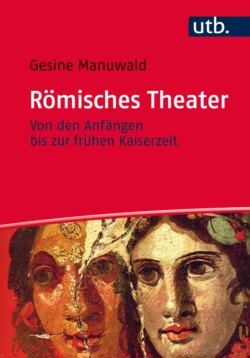Читать книгу Römisches Theater - Gesine Manuwald - Страница 12
3.3. Theaterbauten
ОглавлениеWährend der Circus Maximus, der Austragungsort der Spiele im Circus, vermutlich bereits seit der Königszeit bestand und im Laufe der Zeit ausgebaut wurde, fand für die Veranstaltungsorte von Dramenaufführungen keine vergleichbare Bautätigkeit statt. Im Gegenteil gab es lange sogar Widerstand gegen die Errichtung dauerhafter Theaterbauten in Rom. Theater blieben daher temporäre Anlagen bis fast an das Ende der republikanischen Zeit, auch wenn die Römer mit Steintheatern in Griechenland, Sizilien und anderen Teilen Italiens vertraut gewesen sein müssen.
Das führt zu der paradoxen Situation, dass mit der Errichtung spezieller und dauerhafter Theaterbauten in Rom zu einer Zeit begonnen wurde, als vorwiegend vorhandene Dramen wiederaufgeführt und neue Stücke dramatischer Genres, die viele spektakuläre Effekte beinhalten, auf die Bühne gebracht wurden, während in der literarisch kreativsten Periode des republikanischen Bühnendramas Rom kein Steintheater hatte; stattdessen wurden Dramen auf temporären Holzbühnen gezeigt. ‚Temporär‘ in diesem Zusammenhang bedeutet ‚erbaut für eine begrenzte Zeit‘ und ist nicht mit ‚schlicht‘ gleichzusetzen. Denn die Konstruktionen wurden über die Jahrhunderte hin immer mehr ausgestaltet, und in der späten Republik waren die Theaterbauten recht elaboriert. Das Fehlen eines dauerhaften Theaterbaus in Rom während fast der gesamten republikanischen Epoche beruht daher nicht auf der Unfähigkeit der Römer, solche Konstruktionen zu errichten, sondern ist das Ergebnis einer bewussten Entscheidung dagegen.
Ursprünglich wurden verschiedene Aufführungsorte in Rom für die einzelnen Spiele genutzt; diese wurden jeweils für eine begrenzte Zeit zu Theaterplätzen umgeformt (Vitr. 5,5,7). Der temporäre und sich verändernde Charakter der Theaterräume muss die Wirkung der dramatischen Aufführungen beeinflusst haben. Außerdem waren die Orte nicht allein für dramatische Aufführungen reserviert, sondern an demselben Aufführungsort konnten offenbar auch andere Arten von Unterhaltung geboten werden (Ter. Hec. 39–42).
Die frühesten Orte für dramatische Aufführungen scheinen der Circus, das Forum oder der Platz vor dem Tempel der jeweiligen Festgottheit gewesen zu sein. Die zum Tempel führenden Treppenstufen oder die Ränge im Circus konnten als Zuschauerraum mit Sitzreihen genutzt werden, während der Bühnenkomplex jedes Mal neu errichtet wurde (Cic. har. resp. 24; vgl. auch Gell. 10,1,7). Bühne und Zuschauerraum scheinen als separate Teile betrachtet worden zu sein, und die Errichtung eines eigentlichen Zuschauerraums war offenbar nicht nötig, um einen anerkannten Theaterbereich zu schaffen.
Abb. 4
temporäre Theateranlage auf dem Palatin
Rekonstruktion des Aufführungsorts für die Uraufführung von Plautus’ Pseudolus (191 v. Chr.) vor dem Tempel der Magna Mater auf dem Palatin
Mehrere Versuche im Verlauf des zweiten Jahrhunderts v. Chr., ein dauerhaftes Theater in Rom zu errichten, waren erfolglos (Tert. spect. 10,4). 179 v. Chr. gab der Zensor M. Aemilius Lepidus einen Zuschauerbereich und eine Bühne (theatrum et proscaenium) in der Nähe des Tempels des Apollo in Auftrag (Liv. 40,51,3), vermutlich intendiert als ein bleibender Bau für die Ludi Apollinares. Gleichzeitig fügte der andere Zensor M. Fulvius Nobilior eine Porticus zum Tempel hinzu (Liv. 40,51,6). Vielleicht sollte der gesamte Komplex zu einem Theatertempel umgestaltet werden; dann hätte der erste Plan für ein festes Theatergebäude in Rom bereits die Grundstruktur gehabt, die durch das erste tatsächlich erbaute steinerne Theater mehr als 100 Jahre später realisiert wurde.
Es gibt keine Informationen dazu, was mit diesem Vorstoß zur Errichtung eines Theatergebäudes 179 v. Chr. geschah. Wenn ein als dauerhaft intendiertes Theater begonnen oder gar gebaut wurde, existierte es offensichtlich fünf Jahre später nicht mehr, als ein weiterer Versuch unternommen wurde. 174 v. Chr. verfolgten die Zensoren Q. Fulvius Flaccus und A. Postumius Albinus ein ambitionierteres Projekt: Als Teil eines weitreichenden Bauprogramms, das auch Ergänzungen im Circus einschloss (Liv. 41,27,6), gaben sie eine Bühne in Auftrag, die Aedilen und Praetoren zur Verfügung gestellt werden sollte (Liv. 41,27,6). Da bald weitere Pläne erwogen wurden, wurde dieses Projekt entweder nicht realisiert oder der Bau bereits während der Aufbauarbeiten oder kurz danach abgerissen. Eine derartige Bühne war offenbar als Angebot für alle Beamten, die Spiele veranstalten, gedacht, wobei allerdings keine enge Beziehung mehr zwischen dem Ort der dramatischen Aufführung und dem jeweils geehrten Gott bestanden hätte.
Die Zensoren von 154 v. Chr., M. Valerius Messalla and C. Cassius Longinus, machten einen weiteren Versuch zur Errichtung eines Theaters, wahrscheinlich entlang des südwestlichen Abhangs des Palatin (Vell. 1,15,3: a Lupercali in Palatium versus theatrum). Doch auf Initiative des Ex-Konsuls und Ex-Zensors P. Cornelius Scipio Nasica (Corculum) beschloss der Senat kurz darauf, das Theater oder den Zuschauerbereich (theatrum), die bereits im Bau waren, abzureißen.
Es mag einen vierten Versuch der Errichtung eines dauerhaften Theaters in Rom gegeben haben, 107 v. Chr. durch den Konsul L. Cassius Longinus. Die bereits weit fortgeschrittene Konstruktion wurde im folgenden Jahr durch seinen Nachfolger Q. Servilius Caepio zerstört (App. civ. 1,28,125; vgl. auch Vell. 1,15,3).
Gründe für die ablehnende Haltung von Mitgliedern der römischen Senatsnobilität hinsichtlich eines bleibenden Theaters kann man nur erschließen. Jedenfalls richtet sich der Widerstand nicht gegen die Theateraufführungen, sondern gegen die Dauerhaftigkeit der Bauten. Bei einigen der erfolglosen Versuche ging es um die Errichtung einer Bühne, bei anderen um Konstruktionen für Zuschauer. Man hat daher vermutet, dass die Nobilität fürchtete, auf Dauer angelegte Theaterbauten könnten potenziell gefährliche Versammlungen ermöglichen, oder dass die jährliche Errichtung von Theatern den Veranstaltern die Möglichkeit gab, sich spendabel zu zeigen, während die Erinnerung daran nicht dauerhaft festgeschrieben wurde, oder dass ein bestehendes Theater dem Prinzip der jährlich sich erneuernden Verantwortlichkeit für Dramenaufführungen durch wechselnde Magistrate widersprochen hätte. Abgesehen von möglichen politischen Ursachen ist eine plausible Erklärung vielleicht auch die Hypothese, dass ein fester Theaterbau den religiösen Riten zuwidergelaufen wäre. Ein solcher Bau hätte es unmöglich gemacht, Aufführungen vor den Tempeln der Götter der verschiedenen Feste oder im Forum stattfinden zu lassen.
Obwohl also Theaterbauten in Rom bis fast an das Ende der Republik temporär blieben, betraf die fortschreitende Entwicklung der Dramenaufführungen zu etwas immer Eindrucksvollerem hin auch die Struktur von Theaterbauten. So gab es im ersten Jahrhundert v. Chr. aufwendige temporäre Theaterbauten: Beispielsweise hatten sie unter anderem Säulen aus Marmor, bewegliche Bühnen, mit Statuen geschmückte oder mit Elfenbein, Silber und Gold ausgestattete Bühnenanlagen oder einen mit Planen gegen die Sonne ausgestatteten Zuschauerbereich (z.B. Val. Max. 2,4,6). Der Höhepunkt dieser Entwicklung zur Extravaganz bei vorübergehend errichteten Theatern wurde 58 v. Chr. mit dem gigantischen und luxuriösen Bau des kurulischen Aedilen M. Aemilius Scaurus erreicht (z.B. Plin. nat. 34,36; 36,5–6; 36,113–115). In der späten Republik und der frühen Kaiserzeit konnten Einzelpersönlichkeiten im Streben nach beeindruckenden Aufführungen sogar Veranstaltungen in allen Vierteln der Stadt anbieten (Suet. Iul. 39,1; Aug. 43,1). Besonderer Prunk ließ sich erreichen, wenn Spiele an Orten veranstaltet wurden, die vorher nicht zu diesem Zweck benutzt worden waren (Suet. Claud. 21,1).
55 v. Chr. weihte Pompeius das erste auf Dauer angelegte Steintheater in Rom, das nach seinem Triumph 61 v. Chr. erbaut worden war (Cic. fam. 7,1–4; off. 2,57; Pis. 65; Asc. zu Cic. Pis.; Pis. 65 [pp. 1; 15–16 Clark]; Tac. ann. 3,72,2; 14,20,2; Plin. nat. 7,158; 8,20; Suet. Claud. 21,1; Gell. 10,1,7; Tert. spect. 10,5; Cass. Dio 39,38,1–3; Plut. Pomp. 52,5). Auf das Theater des Pompeius folgten das Theater des Balbus (13 v. Chr.) und das Theater des Marcellus, begonnen von Caesar und vollendet und eingeweiht von Augustus (13/11 v. Chr.; vgl. auch Suet. Vesp. 19). Pompeius’ Gebäude war ein riesiger Komplex; er bestand aus einem kompletten Theater und einem Tempel für Venus (Victrix) über den Sitzreihen für die Zuschauer, deren zentraler keilförmiger Abschnitt eine monumentale Treppe zum Tempel bildete. Auf diese Weise wurde die traditionelle Struktur in Stein übertragen; eine sichtbare Verbindung zwischen Theaterbau und religiösem Kult wurde beibehalten. Das Theater des Pompeius wurde in der Antike als riesig betrachtet (Plin. nat. 34,17,39–40; Amm. 16,10,14) und hatte angeblich 40000 Sitzplätze (Plin. nat. 36,115); hingegen gehen moderne Schätzungen von 11000 bis 12000 aus.
Abb. 5
Modell des Pompeius-Theaters
Rekonstruktionsmodell des Gebäudekomplexes des Pompeius-Theaters, des ersten steinernen Theaters in Rom (eingeweiht 55 v. Chr.), bestehend aus Tempel über dem Zuschauerbereich (cavea), Orchestra-Anlage, Bühne mit Bühnengebäude und dahinter anschließender Säulenhalle (porticus)
Während der Einweihungszeremonien soll Pompeius betont haben, dass er kein Theater, sondern eher einen Tempel für Venus gebaut habe, dessen Stufen als Sitzplätze bei Aufführungen benutzt werden könnten (Tert. spect. 10,5; vgl. auch Gell. 10,1,7). Dadurch machte Pompeius deutlich, dass er religiöse Pflichten erfüllte und die Tradition bewahrte, auch wenn er nicht ein Theater in der Nähe eines Tempels einer Festgottheit, sondern einen neuen Tempel zusammen mit einem neuen Theater errichtet hatte. Sogar in der Mitte des ersten Jahrhunderts v. Chr. scheint die Errichtung eines dauerhaft bestehenden Theaters in Rom also nicht vollkommen problemlos gewesen zu sein, da Pompeius auf Kritik stieß (Tac. ann. 14,20,2). Doch wurde in dieser Zeit ein derartiges Theater offenbar eher toleriert als noch im zweiten Jahrhundert v. Chr. bzw. hatten sich die politischen Machtverhältnisse entsprechend verändert.
Auch nach 55 v. Chr. gab es weiterhin temporäre Bühnen in Rom, wahrscheinlich wiederum, um eine Nähe zwischen dramatischen Aufführungen und dem jeweils relevanten Tempel zu erreichen. Feste Steinstrukturen wurden offenbar nicht schlagartig Standard, wobei die Unterschiede fließend sind: Das ‚temporäre‘ Theater des C. Scribonius Curio, 53 v. Chr. erbaut (Plin. nat. 36,116–120), existierte noch zwei Jahre nach seiner Erbauung (Cic. fam. 8,2,1 [Anfang Juni 51 v. Chr.]).
Abb. 6
Beispiel für republikanische Theaterarchitektur
Basis (polychrome Terrakotta) einer Aedicula, aus der Grabkammer des P. Numitorius Hilarus an der Via Salaria in Rom, 1. Jh. v. Chr. (Rom, Palazzo Massimo alle Terme, Inv.-Nr. 34355 bis)
Dargestellt ist eine Tragödienszene (erkennbar an den Masken und der auf einen gehobenen Status hindeutenden Bekleidung der Figuren) vor der reich dekorierten Bühnenfassade eines Steintheaters spätrepublikanischer Zeit mit den üblichen drei Türen.
Im gesamten römischen Reich sind später über 340 Orte mit Theatern und Odeen (überdachte Theater im modernen Sprachgebrauch) bekannt. Das erste Odeum (griechisch: Oideion) in Rom wurde im Campus Martius während der Regierungszeit Domitians errichtet (81–96 n. Chr.); in anderen Teilen Italiens gab es solche Bauten seit dem ersten Jahrhundert v. Chr. Derartige Theater eignen sich besonders für Aufführungen in kleinerem Rahmen, Vorführungen einzelner Szenen und Rezitationen. Insgesamt weisen die Theaterbauten im römischen Reich strukturell große Ähnlichkeiten auf. Die Ausdehnung der Theaterkultur über alle Provinzen hinweg trug zur Schaffung und Stabilisierung einer einheitlichen dominierenden Kultur bei. Die meisten Theaterbauten in den Provinzen, die ganz oder teilweise erhalten sind, stammen aus dem Anfang der Kaiserzeit, als Theater nicht mehr nur für Aufführungen von Dramen genutzt wurden.
Abb. 7
Beispiel eines römischen Theaters in den Provinzen
Römisches Theater von Bosra (Syrien)
Das römische Theater in Bosra (ca. 2. Jh. n. Chr.), das heute zum UNESCO Weltkulturerbe zählt, ist eines der größten (ca. 15.000 Zuschauer) und am besten erhaltenen Theater des römischen Reichs (Bühne, Bühnenrückwand, Orchestra-Anlage, Zuschauerbereich [cavea]); gut erhalten blieb es, weil es im Mittelalter zu einer Festung ausgebaut wurde. Deutlich erkennbar sind die leicht erhöhte Bühne, die seitlichen Zugänge und die dekorierte Bühnenrückwand mit zurückgesetzten Eingängen.
Abb. 8
Beispiel von Theaterarchitektur in den Provinzen
Kleines Relieffragment mit der Abbildung einer Theaterarchitektur aus Köln (Köln, Römisch-Germanisches Museum, Inv.-Nr. Lü 764a)
Dargestellt ist eine zweigeschossige Aedikula-Architektur mit Segment- und Dreieckgiebeln, möglicherweise eine Wiedergabe des Kölner Theaters.
Von Anfang an war die Bühne der essenzielle Bestandteil eines römischen Theaters. Sie heißt bei Plautus scaena oder proscaenium (Plaut. Amph. 91; Capt. 60; Poen. 17; 20; 57; Pseud. 568; Truc. 10), und die dramatischen Spiele, die ludi scaenici, sind danach benannt (Ter. Hec. 16; 45). Dieses Vokabular legt nahe, dass das römische Theater sich von der Bühne als zentralem Bestandteil her entwickelte, während der griechische Begriff theatron (von den Römern übernommen) die Betrachterperspektive (griechisch: ‚théa‘ = ‚Anschauen, Anblick, Schauspiel‘) betont. Diese Wertschätzung zeigt sich an den frühen Theaterkonstruktionen in Rom, wenn eine Bühne für jedes Fest errichtet wurde, während der Zuschauerbereich provisorisch sein konnte.
Das genaue Erscheinungsbild früher Bühnen ist schwer festzustellen, da es keine archäologischen Überreste von Theatern in Rom aus der Zeit vor der Mitte des ersten Jahrhunderts v. Chr. gibt. Daher müssen Details über frühe Bühnenbauten aus Hinweisen in erhaltenen Dramentexten, Erwähnungen von Theatern in anderen Quellen, Rückschlüssen auf der Basis architektonischer Strukturen aus späterer Zeit, von Orten außerhalb Roms oder von Vasen- und Wandbildern erschlossen werden. Daraus ergibt sich, dass sich schlichte Bühnenanlagen, unter dem Einfluss hauptsächlich von griechischen Theaterbauten (in Griechenland und Magna Graecia) und von lokalen Bühnen in Italien und Sizilien, zu den aufwendig ausgestatteten Bauten der späteren Republik und der frühen Kaiserzeit entwickelten.
Weitere Informationen über frühe Bühnen in Italien hat man aus süditalischen Vasenbildern zu gewinnen versucht, vor allem den sogenannten Phlyakenvasen. Auch wenn die Bilder auf diesen Vasen heute mit der griechischen Mittleren oder Alten Komödie in Verbindung gebracht werden (▶ Kap. 2.3), müssen diese Bühnen einen bekannten Typ im Italien des vierten Jahrhunderts v. Chr. repräsentiert haben, der sich von zeitgenössischen Theaterstrukturen auf dem griechischen Festland unterscheidet. Die Bühnen auf diesen Vasenbildern sind niedrige Holzkonstruktionen, wobei der Abstand zwischen den tragenden Balken und den darauf liegenden Brettern manchmal mit einem Tuch verhängt ist; gelegentlich sind Stufen dargestellt, die auf die Plattform hinaufführen. Die Rückseite der Bühne besteht in der Regel aus einer Wand mit oder ohne Öffnungen für Türen und Fenster, die mit einem Dach bedeckt sein kann.
Abb. 9
Beispiel von Theaterarchitektur auf Phlyakenvasen
Kampanischer, rotfiguriger Krater, 350–325 v. Chr., vielleicht dem ‚Libation-Maler‘ zuzuschreiben (Melbourne, National Gallery of Victoria; Felton Bequest, 1973 [D14–1973])
Zwei Schauspieler, ein Sklave und ein älterer Mann (mit Masken und typischer Kostümierung) auf der Bühne, davor der Spieler einer tibia (tibicen mit phorbeia [um Wangen und Mund gelegte Binde]) für die Begleitmusik. Die Bühne besteht aus einer niedrigen Holzfläche mit kurzer Treppe und vorgehängten Tüchern; auf der Bühne ist eine Gebäudearchitektur angedeutet, verschiedene Requisiten markieren den Hintergrund.
Steintheater des dritten und zweiten Jahrhunderts v. Chr. in Süd- und Mittelitalien weisen zumeist eine niedrige Bühne mit großer Tiefendimension vor einer mehrstöckigen, dekorierten Bühnenwand auf. Auf beiden Seiten ist die Bühne von hohen Mauern eingeschlossen, die mit den ansteigenden Sitzreihen für die Zuschauer verbunden sind, sodass der Zuschauer- und der Bühnenbereich sich einander gegenüber befinden und einen zusammenhängenden Baukomplex bilden. Diese Struktur kann verbunden sein mit einem Tempel oberhalb der Sitzreihen; dann ergibt sich ein Theatertempel, eine Variante, die in Kampanien, Samnium und Latium im zweiten Jahrhundert v. Chr. auftaucht.
Charakteristische Merkmale voll entwickelter römischer Theater zeigen sich besonders bei einem Vergleich typischer römischer Theater mit typischen klassischen griechischen (Vitr. 5,6–7; vgl. auch 5,3; 5,5).
Abb. 10
Darstellung eines römischen Theaters nach Vitruv
Schemazeichnung eines idealen römischen Theaters nach den Angaben des augusteischen Architekten Vitruv
Während griechische Theatergebäude in der Regel einen natürlichen Abhang für den ansteigenden Zuschauerraum nutzten und für die Sitzreihen daher auf Substruktionen weitgehend verzichten konnten, waren römische Theater zumeist kompakte, freistehende Einheiten auf flachem Boden mit den entsprechenden Substruktionen.
In einem römischen Theater bildete der Zuschauerraum (cavea) – im Unterschied zu dem über einen Halbkreis hinausgehenden des griechischen Theaters – ungefähr einen Halbkreis, die Bühne war niedrig, hatte eine gewisse Tiefendimension und wurde hinten abgeschlossen durch die mächtige Fassade (scaenae frons) des Bühnenhauses. Diese Wand war ursprünglich ungeschmückt und später bemalt und dekoriert (z.B. Plin. nat. 35,23; Val. Max. 2,4,6). Die Fassade hatte normalerweise drei Türen, die in runde oder rechteckige Nischen (exedrae) zurückgesetzt sein konnten, wodurch sich kleine Vorräume (vestibula) ergaben. Die hervorragenden Flügel des Bühnenhauses schlossen die Bühne auf beiden Seiten ein. Dieses Gebäude war ursprünglich von bescheidener Höhe und hatte ein begehbares flaches Dach (Plaut. Amph. 1008). Später erreichte die Wand dieselbe Höhe wie der Zuschauerraum.
Entsprechend der andersartigen Konzeption des griechischen Theaters war dort die Bühne weiter zurückgenommen, und die Fläche zwischen der Bühne und der ersten Reihe der Sitze (‚Orchestra‘) entsprach in klassischer Zeit eher einem ganzen Kreis, während sie im römischen Theater (in der Kaiserzeit orchestra genannt) eher einen Halbkreis bildete. Sie wurde üblicherweise nicht von den Schauspielern genutzt und diente nicht als Tanzraum für einen Chor (wie in Griechenland), sondern dort waren Sitze (in spätrepublikanischer Zeit) für Honoratioren aufgestellt (z.B. Vitr. 5,6,2; Suet. Claud. 21,1). Logen (tribunalia) für die Veranstalter befanden sich über den gewölbten Seiteneingängen (zu beiden Seiten des Zuschauerraums), während diese Seiteneingänge im griechischen Theater offen waren.
Da der Halbkreis des Zuschauerbereichs im römischen Theater durch den breit angelegten Bühnenteil sozusagen abgeschlossen wurde, ermöglichten die Seiteneingänge zwischen Bühne und Zuschauerbereich einen direkten Zugang zur Bühne, etwa für große Gruppen von Akteuren. Diese Anordnung kommt der Tendenz des römischen Dramas entgegen, eine größere Zahl von (sekundären) Charakteren auf der Bühne zu haben (Ter. Haut. II 3–4; Cic. fam. 7,1,2 [▶ T 3]; Hor. epist. 2,1,187–207 [▶ T 13]).