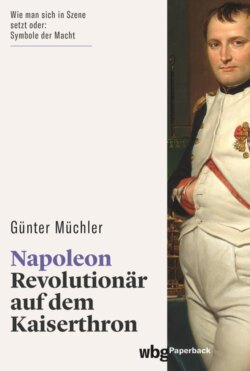Читать книгу Napoleon - Günter Müchler - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Revolutionskrieg
ОглавлениеDer Revolutionskrieg befindet sich mittlerweile in seinem vierten Jahr. Erst 19 Jahre später wird er ausgekämpft sein, mit dem Finale von Waterloo. Wie im Dreißigjährigen Krieg geht es zugleich um Machtpolitik und um Metaphysik, wobei die unterschiedlichen Antriebe nicht immer leicht auseinanderzuhalten sind. Die Propaganda bemäntelt gern nacktes Vormachtstreben mit höheren Zwecken. Dennoch ist der Revolutionskrieg bis zuletzt auch ein Religionskrieg. Die Regierungen des alten Europa wollen verhindern, dass das französische Beispiel Schule macht. Deshalb muss die neue Irrlehre der Volkssouveränität mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden. Verwickelt ist die revolutionäre Kriegsphilosophie. „Die französische Nation verzichtet auf jeden Krieg, durch den Eroberungen gemacht werden sollen, und wird ihre Kräfte niemals gegen die Freiheit irgendeines Volkes verwenden“, heißt es hochgemut in der Verfassung von 1791. Eine Friedensmacht ist Frankreich damit noch lange nicht. Die Verfassungsnorm erteilt nur dem Krieg alter Art eine Absage, das heißt, der Aneignung fremder Territorien aus dynastischem Ehrgeiz. Dagegen sind Eroberungen für die Sache des Fortschritts nicht ausgeschlossen, sie können sogar geboten sein. Wäre es nicht geradezu verwerflich, den Anspruch auf Glück, auf Freiheit und Gleichheit an den Staatsgrenzen enden zu lassen? Das Menschenexperiment kann nur als Menschheitsexperiment gelingen. Mit dieser Dialektik ist der Kreuzzug gerechtfertigt. Bezeichnenderweise sind es nicht die alten Mächte, die den Militärkonflikt eröffnen. Es ist das französische Parlament, das mit der Kriegserklärung an Österreich (20. April 1792) den ersten Stein im 23-jährigen Revolutionskrieg zieht.
Als Theorieverächter ist Napoleon frei vom Kreuzzugsgeist. Das „Recht“ der Revolution, mit dem Alten nach Belieben zu verfahren, praktiziert er dennoch ohne Reserve. Gleich in seinem ersten Feldzug verblüfft er durch die Ungeniertheit, mit welcher er beispielsweise die 1000-jährige venezianische Adelsrepublik ausradiert und Retortenstaaten formt. Bei aller Skepsis teilt Napoleon die Gewissheit des Revolutionärs, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen. Was die blauweiß-roten Armeen auf ihren Streifzügen durch Europa vorfinden, ist Mittelalter und verdient keine Rücksicht. Alles ist veränderbar, alles ist möglich. Bevor sich die Marseillaise als nationaler Hymnus durchsetzt, ist das Ça ira! („Wir schaffen das!“) der beliebteste Pariser Gassenhauer.* Es ist der Sound des neuen Glaubens an die eigene Allmacht, der Berge versetzt. Eigentlich müsste den Abgeordneten, die 1792 für den Krieg stimmen, das Herz in die Hose rutschen. Die Koalitionsarmeen sind furchterregend, sie haben so viel mehr Erfahrung. Aber was zählt das, wenn man sich von den Schwingen der neuen Zeit getragen weiß? „Der Sieg wird der Freiheit treu sein“, deklamiert der Abgeordnete Pastoret in der Debatte vom 20. April und hat damit das Notwendige gesagt.136 Als ein Jahr später Spanien in den Krieg eintritt, tönt Barère, Mitglied des Wohlfahrtsausschusses: „Ein Feind mehr für Frankreich ist ein Triumph mehr für die Freiheit.“137
Das Freiheitspathos ist keine bloße Maskerade. Erst nach und nach mischt sich das Gift der Eigensucht in den Schaumwein aufrichtiger Begeisterung. Die umstürzlerischen Ideen sind ansteckend. An vielen Orten im Piemont, in Belgien und Deutschland werden Freiheitsbäume gepflanzt. Intellektuelle pilgern nach Paris wie zum Heiligen Gral. Die Republik Mainz, die der Naturforscher und Idealist Georg Forster mitbaut, möchte Teil des revolutionären Mutterlandes sein. Noch 1797 agitiert der Publizist Joseph Görres im Roten Blatt für die Cisrhenanische Republik. Auf der anderen Seite ist es dem Konvent durchaus ernst mit dem Universalismus. Schiller und Pestalozzi werden zu französischen Ehrenbürgern ernannt. Der Engländer Thomas Paine wird in das Revolutions-Parlament gewählt, genauso wie der in Gnadenthal bei Cleve geborene Baron Johann Baptist Hermann Maria Clootz, ein pittoresker Adliger, der sich den Vornamen Anacharsis zulegt und für die Ausdehnung Frankreichs bis zum Rhein plädiert. Dass Clootz unter dem Fallbeil endet und Paine diesem Schicksal nur knapp entgeht, desavouiert nicht den Gestus der ausgebreiteten Arme; es beweist nur, dass der Terror genauso universell ist wie die Menschenrechte.
Die ersten militärischen Erfolge bestärken den Optimismus in Paris. Die Preußen ziehen sich nach der Kanonade von Valmy zurück, Mainz wird genommen, die Österreicher werden bei Jemappes geschlagen. Am 19. November 1792 reklamiert der Konvent das Recht, überall dort militärisch eingreifen zu dürfen, wo die Völker „ihre Freiheit wiederherstellen wollen“, wie es in einer Entschließung heißt.138 In einem Dekret vom 15. Dezember wird aus dem Interventionsrecht die Pflicht zur Einmischung. Frankreich, liest man da, müsse sich überall „freimütig als revolutionäre Macht bekennen, soll nichts verbergen, soll die Sturmglocke läuten. (…) Wenn es das nicht tut, wenn es Worte gibt und keine Taten, werden die Völker nicht die Kraft besitzen, ihre Ketten zu sprengen.“ Wehe aber den Völkern, die sich nicht befreien lassen wollen! Artikel 11 des Dekrets hält fest: „Die französische Nation erklärt, dass sie ein Volk als Feind behandeln wird, das, indem es Freiheit und Gleichheit zurückweist oder auf sie verzichtet, mit dem Fürsten und den privilegierten Kasten gemeinsame Sache machen will.“139
Die Kriegsziele werden in keinem Dokument ausformuliert. Doch Danton ist nicht der Einzige, der behauptet, die Grenzen Frankreichs seien „von der Natur markiert. Wir finden sie vor an den vier Ecken des Horizonts, am Rhein, am Ozean, an den Alpen.“ Ähnlich äußert sich Carnot: „Die alten und die natürlichen Grenzen Frankreichs sind der Rhein, die Alpen und die Pyrenäen.“140 Schon Richelieu hatte ein Vordringen bis zum Rhein befürwortet, ohne eine einleuchtende Rechtfertigung dafür zu liefern. Für die Revolutionäre ist der Kampf gegen die Tyrannen Rechtfertigung genug. Er erlaubt es sogar, den befreiten Völkern die Kunstschätze abzunehmen. „Mehr als die Römer sind wir berechtigt zu sagen, dass wir, indem wir die Tyrannen schädigen, die Künste schützen“, legitimiert der Robespierre-Freund Henri Grégoire den systematischen Kunstraub, der seit 1793 betrieben wird.141 1794 ruft der Wohlfahrtsausschuss eine eigene Behörde ins Leben, die Commission de commerce et des approvisionnements („Kommission für Handel und Bevorratung“), die die Beutezüge in geordnete Bahnen lenken soll. Im Tross der vorrückenden Armeen durchsuchen die Agenten des Büros Kirchen, Klöster und Schlösser und lassen mitgehen, was sie zuerst in Belgien, dann in den Rheinprovinzen an Bildern und wertvollen Büchern einsammeln können. In Aachen gehen sie besonders gründlich vor. Es wandern die Bronzefigur Karls vom Marktbrunnen vor dem Rathaus ebenso nach Paris wie der Proserpina-Sarg aus der Marienkirche. Denselben Weg nehmen an die 40 Porphyr- und Marmorsäulen, die man aus dem Umgang des karolingischen Oktogons herausgehauen hat. Verschont bleibt der Münsterschatz, aber auch nur deshalb, weil die Stadtväter ihn rechtzeitig nach Paderborn in Sicherheit gebracht haben.141 Jeder Fischzug wird bürokratisch erfasst, wie der Bericht des Agenten Tinet an den Wohlfahrtsausschuss belegt: „Ich, P. Tinet, Mitglied der Agence de Commerce et approvisionnement, (…) habe mich in die Kirche Sankt Peter in Köln begeben, um dort ein Gemälde von Rubens entfernen zu lassen, welches die Kreuzigung Petri darstellt. Es misst zehneinhalb Fuß in der Höhe sowie sieben Fuß und zwei Zollbreit in der Länge.“143 Die Behauptung, der organisierte Kunstraub sei von Napoleon erfunden worden,144 ist falsch. Napoleon raubt – Jahre später – in Italien als gelehriger Schüler der Revolution.
1790 besteht Frankreich aus 83 Departements. Neun Jahre später beträgt die Zahl 101. Hinzugekommen sind durch Annexion die Departements Vaucluse (Avignon und das Comtat), Mont-Blanc (Chambéry), Alpes-Maritimes (Nizza), Mont-Terrible (Basel), neun belgische und vier linksrheinische Departements sowie Léman (Genf). Die républiques sœurs, die „Schwesterrepubliken“ Batavische Republik (Niederlande), Cisalpinische Republik (Lombardei), Ligurische Republik (Genua und Umgebung) und Helvetische Republik (auf dem Boden der alten Eidgenossenschaft) sind auf dem Papier unabhängig; in der Praxis stehen sie unter Vormundschaft.
Die Dynamik des neuen Frankreich trifft die übrigen europäischen Mächte unvorbereitet. Dem seltsamen Staatswesen, das glaubt, ohne einen König auskommen zu können, werden anfangs nur geringe Überlebenschancen eingeräumt. Selbst Edmund Burke, scharfblickender Autor des anti-revolutionären Bestsellers Reflections on the Revolution in France, vertritt die Ansicht, Frankreich werde nun für eine Weile aus dem Kreis der Großen ausscheiden. Nur wenige begreifen, dass die Revolution eine neue Wirklichkeit schafft. „Alles regt sich, als wollte die Welt, die gestaltete, rückwärts / lösen in Chaos und Nacht sich auf, und neu sich gestalten“, heißt es in einfühlsam in Hermann und Dorothea. In die „gestaltete Welt“ ist der Blitz eingeschlagen, eine Gegenwelt ist entstanden, die das Ancien Régime mit unerhörter Kühnheit herausfordert. Ein Bild aus dem Leben des jungen Metternich illustriert die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen: Am 5. Juli 1792 erlebt der Spross aus altem Reichsgrafengeschlecht in Frankfurt die Inthronisierung Franz’ II. als Kaiser des Heiligen Römischen Reiches mitsamt der Entfaltung des umständlichen Zeremoniells, welches das altehrwürdige Reich für diesen Anlass vorsieht. Er darf den Krönungsball mit der reizenden Prinzessin von Mecklenburg-Strelitz eröffnen, die einmal als „Königin Luise“ die Ikone Preußens sein wird. Zur selben Zeit entmachtet, 600 Kilometer weiter westlich, der Mob von Paris das Parlament und rüstet sich für den Sturm auf das Königsschloss.
Ein Jahr vorher haben Österreich und Preußen dem Land der Revolution einen ersten Schuss vor den Bug gesetzt. Die Erklärung von Pillnitz (10. Juli 1791) wird in Paris als „gewaltige Verschwörung nicht nur gegen die Freiheit Frankreichs, sondern des ganzen Menschengeschlechts“ gebrandmarkt, ist aber ein schwaches Signal. Es kommt zwar einer Sensation nahe, dass sich die eingeschworenen Rivalen Habsburg und Hohenzollern überhaupt an einen Tisch setzen. Das heißt aber nicht, dass sie an einem Strang ziehen. Österreich hat den Siebenjährigen Krieg noch nicht vergessen und sinnt darauf, den Verlust Schlesiens durch Gebietsgewinne in Italien (Venetien) und in Deutschland (Bayern im Tausch gegen die niederländischen Besitzungen) wettzumachen. Was die preußische Diplomatie angeht, so weiß sie nicht recht, welchem Ziel sie Vorrang geben soll: der Bestrafung Frankreichs oder der Plünderung Polens. In Pillnitz beschränken sich die beiden Monarchen deshalb auf die Feststellung, die missliche Lage, in welcher sich der König von Frankreich befinde, gehe alle Souveräne Europas an. Als Frankreich dann ein Jahr später den Krieg vom Zaun bricht, tun die Verbündeten nur das Nötigste und erleben bei Valmy, dass die ungehobelten, noch nicht einmal ordentlich uniformierten Truppen der Republik militärisch durchaus muskulös sind. 1795 – inzwischen sind in Paris König und Königin hingerichtet – schert Preußen aus der Koalition aus. Es will die dritte Teilung Polens nicht verpassen. In einem Geheimartikel des Sonderfriedens von Basel gibt es die linksrheinischen Territorien des Reiches preis. Frankreich sagt im Gegenzug zu, den Norden Deutschlands vom Revolutionsexport zu verschonen.
Beim ersten Auftritt des Generals Bonaparte sind die Rollen im europäischen Kriegstheater prima vista höchst ungleich verteilt. 1796 führt Frankreich gegen England, Österreich, das Königreich Sardinien-Piemont sowie gegen die süddeutschen Staaten Krieg. Aber die Phalanx der Revolutionsfeinde ist brüchig. Die süddeutschen Staaten würden gern den preußischen Weg gehen und sind nur halbherzig bei der Sache. Sogar in Wien hält sich die gegenrevolutionäre Entschlossenheit in Grenzen, obwohl Kaiser Franz als Neffe der „Märtyrerkönigin“ Marie-Antoinette doch stark in der Pflicht wäre zu vergelten, was man der französischen Königsfamilie angetan hat. Motor der Allianz gegen Frankreich ist eindeutig England, auch wenn das nach außen nicht so hervorsticht. Als Seemacht ist England mit eigenen Truppen auf dem Kontinent kaum präsent. Bis 1815 betragen die britischen Verluste ganze 50 000 Mann. Dafür finanziert England den Krieg. Über kurz oder lang kommen alle, die Front gegen Frankreich machen, in den Genuss britischer Subsidien. Die ersten Zahlungen gehen 1793 an Hannover, das 452 000 Pfund Sterling erhält, und an den Markgrafen von Baden.146 „In den nächsten 20 Jahren folgten über 100 Finanztransfers dieser Art. Sie waren im eigenen Land nie populär, aber notwendig, um die Staaten des Kontinents im Feld zu halten“, fasst der britische Historiker Roger Knight zusammen.147
Premierminister William Pitt ist ursprünglich auf Nicht-Interventionskurs. Erst der Einfall der Revolutionstruppen in die Generalstaaten (Vorläufer der Niederlande) veranlasst ihn zum Umdenken. Niemals dürfe die Gegenküste Englands unter französische Kontrolle geraten, lautet ein Axiom der britischen Politik. Im Falle der österreichischen Niederlande, das heißt Belgiens, ist die Empfindlichkeit besonders groß. Ein französisch beherrschtes Antwerpen, sagt man in London, sei wie eine auf England gerichtete Pistole. All dies ist dem Konvent bewusst, als er per Beschluss vom 1. Oktober 1795 Belgien zusammen mit Lüttich, Limburg und Luxemburg der einen und unteilbaren Nation einverleibt.
England hat Frankreich in den letzten Jahrzehnten machtpolitisch abgehängt. Es regiert auf den Meeren und dominiert den Handel mit den Kolonien. Nadelstiche gegen Albion sind deshalb in Frankreich volkstümlich. Aber das allein erklärt nicht die überaus riskante Aneignung Belgiens. Die Gründe liegen in der französischen Innenpolitik. Die Thermidorianer sind davon überzeugt, dass die Republik handfeste außenpolitische Erfolge braucht, um sich gegen ihre inneren Widersacher zu behaupten. Die Segnungen der Freiheit reichten dafür auf die Dauer nicht aus, meint Lazare Carnot. In den Augen des Volkes seien sie keine harte Währung, sondern bloß ein bien imaginaire, ein scheinbares Gut. Belgien französisch zu machen, ist etwas anderes. Noch nicht einmal Ludwig XIV. hat das vermocht. Es schmeichelt der französischen Schwäche für grandeur und rechtfertigt die Anstrengungen, die das Volk seit der Revolution auf sich genommen hat. Jean-François Reubell, der im Direktorium für die Außenpolitik zuständig ist, bringt einen interessanten Gesichtspunkt ins Spiel. Es wäre selbstmörderisch, erklärt er, Belgien und die übrigen Annexionen preiszugeben. Die eigenen Armeen würden dann in ein Land zurückkehren, das sie nicht ernähren könne; sie würden Frankreich destabilisieren und den Bürgerkrieg befeuern. Belgien sei reich, allein die belgischen Nationalgüter – also der Grund- und Immobilienbesitz, den man der Kirche weggenommen hat – seien drei Milliarden wert.148 Reubells Gedankengang ist unbestreitbar konsequent. Wenn man Krieg führt, ist es allemal besser, die Armee verzehrt das Brot der befreiten Völker, als dem eigenen Budget zur Last zu fallen. Anders ausgedrückt: Der Krieg ernährt den Krieg. Die Risiken und Nebenwirkungen dieser Politik unterschlägt Reubell: Erstens nimmt die Freiheitsbotschaft Schaden, wenn die befreiten Völker das Gefühl bekommen müssen, ständig gemolken zu werden. Zweitens – und auf Belgien bezogen – macht man sich England zum Todfeind. Pitt erklärt ohne Wenn und Aber, niemals werde England die Annexion anerkennen. Dabei bleibt es. England wird zu keinem Frieden bereit sein, solange Frankreich die Hand auf Belgien hat. Umgekehrt wird Frankreich Belgien nur dann langfristig behaupten, wenn es England besiegt. Für den französischen Historiker Jacques Bainville markiert die Annexion Belgiens den Wendepunkt im Revolutionskrieg. „Am 1. Oktober 1795 diktierte der Konvent sein Testament.“149 Napoleon, der Konsul, der Kaiser, erbt mit diesem Testament eine schwere Hypothek.