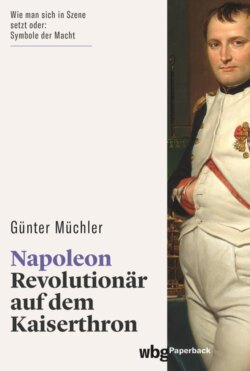Читать книгу Napoleon - Günter Müchler - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Jugend eilt zum Sieg
ОглавлениеDer neue Oberbefehlshaber der armée d’Italie trifft am 26. März 1796 im Hauptquartier Nizza ein. Scherer verhält sich beim Antrittsbesuch nobel. Schwieriger gestaltet sich für Napoleon die erste Begegnung mit den fünf Divisionsgenerälen. Masséna, Augereau, Sérurier, Laharpe und Meynier sind älter und voller Vorbehalte gegenüber dem 26-Jährigen, den man ihnen vor die Nase gesetzt hat. Militärisch ist dieser Bonaparte ein unbeschriebenes Blatt. Er soll ein Günstling Barras’ sein, erzählt man sich, man hat es demnach wohl mit einer dieser nichtsnutzigen Pariser Kreaturen zu tun, von denen es schon zu viele gibt. Napoleon bleibt die Ablehnung nicht verborgen. Trotzdem schreibt er Carnot: „Ich bin von der Armee sehr gut empfangen worden.“150 Er möchte unbedingt zeigen, dass er allein zurechtkommt. Deshalb beschönigt er auch seine ersten Berichte über den Zustand der Armee, ohne die Probleme zu verschweigen: Es fehlt an Geld und an Brot. Die Verwaltungen der neuen Departements liefern weder die vorgegebenen Proviantmengen, noch erfüllen sie die Verpflichtung, jedes dreißigste Pferd aus ihrem Bereich an die Armee abzugeben. Doch versieht Napoleon jede Mängelrüge mit der Versicherung, er habe die Lage im Griff.
Dabei entspricht der Zustand der 40 000-Mann-Armee genau dem Bild, das man sich in Paris und auch bei den besser beleumundeten Schwesterarmeen (Moreaus Rhein-und-Mosel-Armee und Jourdans Sambre-Maas-Armee) von der armée d’Italie macht. Sie ist von einem dezidiert jakobinischen Geist geprägt, was bedeutet, dass die Soldaten ihre Vorgesetzten duzen und es um die Disziplin schlecht bestellt ist. Die lange Untätigkeit hat ihr nicht gutgetan. Kaum dass Napoleon angekommen ist, meutert ein ganzes Bataillon. Es weigert sich, Nizza zu verlassen. Die Widerspenstigkeit kommt nicht von ungefähr. Seit drei Monaten ist kein Sold ausbezahlt worden, ebenso lange hat die Truppe kein Fleisch mehr gesehen. Mulis ziehen die Kanonen, weil Zugpferde an Unterernährung gestorben sind. Längst nicht jeder Soldat hat Schuhe, Gewehren fehlen die Bajonette. Scherer wusste schon, weshalb er mit dieser Armee keine Offensive starten wollte. Der neue Chef treibt an, beschafft Brot, organisiert Geld. In den ersten 20 Tagen schreibt er nicht weniger als 123 Befehle, die die Verbesserung der Versorgung zum Gegenstand haben. Am 8. April meldet er dem Direktorium: „Die Armee, die ich vorgefunden habe, entbehrte nicht nur alles, sie war auch disziplinlos und andauernd ungehorsam. Übelwollende machten sich die Unzufriedenheit zunutze. Eine Kompanie aus dem Dauphiné sang konterrevolutionäre Lieder der Chouans.* Ich habe zwei Offiziere vor ein Militärtribunal gestellt, weil sie ‚vive le roi‘ gerufen hatten.“ Die Litanei endet, typisch für Napoleon, mit einem Kontrapunkt: „Aber wir schlagen los, trotz alledem.“151
Es ist Frühling, als der Feldzug beginnt, und es ist wieder Frühling, als er mit der Unterzeichnung des Präliminarfriedens von Leoben (18. April 1797) endet. Die Frühlings-Metapher steht so aufdringlich über dieser Phase im Leben Napoleons, dass man leicht übersehen könnte: Es wird auch massenhaft gestorben in diesem Jahr, es wird verstümmelt, vergewaltigt und gebrandschatzt. Und dennoch ist der Eindruck des Aufkeimenden, des Unverbrauchten nicht falsch. Die Angreifer, die da mit schlechtem Schuhwerk über die Berge steigen, um sich dann freudetrunken in die Ebene zu ergießen, sind so unwiderstehlich und mitreißend wie das Freiheitspanier, als es noch unbefleckt war. Den Siegen, die sie erringen und über die sie ebenso staunen wie die Besiegten, haftet eine Leichtigkeit an, die nur der Jugend zu eigen ist.
Für Napoleon ist der Italienfeldzug die Jugend schlechthin. Vor seinem Tod erzählt er dem Arzt Antommarchi: „Ich war jung wie Sie. Ich hatte Ihre Lebendigkeit, Ihre Glut, das Bewusstsein meiner Kraft. Ich brannte darauf, auf den Plan zu treten.“152 Künstlerisch bringt der Maler Antoine-Jean Gros das schäumende Lebensgefühl im Bonaparte an der Brücke von Arcole perfekt zum Ausdruck. Das Bild zeigt Napoleon, wie er mit der Fahne in der Linken, dem Degen in der Rechten seine zaudernden Truppen zum Angriff treibt. Zweifellos steckt in dem Bild eine Menge Propaganda. Trotzdem könnte es sein, dass die Soldaten ihren Chef genauso gesehen haben. Dieser James-Dean-hafte Napoleon mit den „Hundeohren“, dem entschlossenen und zugleich träumerischen Blick ist der Anführer einer kraftstrotzenden Generation, die keine Hindernisse achtet und die über ihre Feinde hinwegmarschiert wie über totes Laub.
Die älteren Generäle lernen ihren neuen Vorgesetzten rasch respektieren. „Zuerst hatten sie keine hohe Meinung von ihm“, berichtet Masséna. „Sein kleiner Wuchs und sein schwächliches Aussehen waren nicht sehr vorteilhaft. Seine extreme Jugend und die Tatsache, dass er ständig das Porträt seiner Frau in der Hand hielt und herumzeigte, ließen sie glauben, dass diese Ernennung das Werk einer Intrige sei, aber einen Augenblick später setzte er den Generalshut auf und schien zwei Fuß zu wachsen. Er fragte uns nach der Position unserer Divisionen, der Ausrüstung, dem Geist und der Effektivzahl eines jeden Korps, gab uns die Linie vor, der wir zu folgen hatten und kündigte uns für den nächsten Tag seine Inspektion an. Am übernächsten würden wir gegen den Feind losmarschieren.“153 An die Stelle des Misstrauens tritt die Erkenntnis, dass dieser Mann, den man für ein Protektionskind gehalten hat, Eigenschaften vereinigt, die den großen Feldherrn ankündigen. Er klopft keine Sprüche, nie ist er schlecht vorbereitet, seine Befehle sind präzise wie seine Geländekenntnis, er jagt die Zeit wie ein fliehendes Wild. Noch muss er beweisen, dass seine ehrgeizigen Pläne praxistauglich sind. Aber er entfacht die Zuversicht, die das Gelingen eines großen Werks braucht. Sein Medium ist die Sprache. Er redet die Soldaten in einer Weise an, die sie nicht kennen:
„Soldaten! Ihr seid ohne Kleider und schlecht ernährt, ihr habt Forderungen an die Regierung, aber die hat nichts. Eure Geduld und euer Mut inmitten dieser Felsenöde sind bewundernswert, aber sie bringen euch weder Ruhm noch Brot. Ich will euch in die fruchtbarsten Ebenen der Welt führen. Blühende Provinzen, reiche Länder erwarten euch. Ehre, Genuss und Reichtum sollt ihr dort finden. Soldaten der italienischen Armee: kann es euch da noch an Mut und Ausdauer fehlen?“154
Vielleicht ist die oft zitierte Rede im Nachhinein redigiert worden. Aber die Klangprobe stimmt. Sie hat denselben unverwechselbaren Ton, der 1815 den hartgesottenen Marschall Michel Ney aufheulen lässt, als er, der soeben noch Napoleon wie ein wildes Tier im Käfig den Bourbonen ausliefern wollte, einen Brief seines früheren Chefs erhält: „Wer schreibt heute noch so? So muss man zu den Soldaten sprechen!“
Von alledem bekommt die Regierung im fernen Paris nichts mit. Sie traut der Italienarmee wenig zu, und glaubt nicht, dass man von dem jungen Bonaparte gleich Großtaten erwarten kann, bloß weil er in Toulon Kanonen richtig positioniert und im Vendémaire einen Haufen aufmüpfiger Monarchisten auseinandergejagt hat. Dementsprechend soll der Hauptschlag gegen Österreich in Deutschland geführt werden, wo man mit Moreau und Jourdan über erfahrene Generäle verfügt. Von der armée d’Italie verlangt man nur, dass sie den Feind beschäftigt und Teile seine Kräfte bindet.
Österreich hat sich Anfang des 18. Jahrhunderts im Norden Italiens festgesetzt, eine Folge des Spanischen und des Polnischen Erbfolgekrieges. Zu Österreich gehört die Lombardei mit der Hauptstadt Mailand. Weiter im Süden werden das Großherzogtum Toskana und das Herzogtum Modena von Zweigen der Habsburgerfamilie regiert. Vervollständigt wird die zersplitterte norditalienische Staatenlandschaft von den Republiken Venedig und Genua, vom Herzogtum Parma, das einer Nebenlinie der spanischen Bourbonen gehört, sowie Piemont. Der König von Sardinien-Piemont, Victor Amadeus III., ist im Krieg Österreichs Juniorpartner.
Bei Menschen und Material sind Österreicher und Piemontesen klar im Vorteil. Zusammengenommen bringen sie es auf 50 000 Mann, Napoleon auf 30 000.155 Die französische Kavallerie ist ärmlich; noch eklatanter ist die Unterlegenheit der Artillerie: Auf 200 feindliche Geschütze kommen 30 französische. Auffällig ist der Altersunterschied der Feldherren: Jean-Pierre Beaulieu, der österreichische Kommandeur, und Michelangelo-Alessandro Colli, der die piemontesischen Einheiten befehligt, haben mit ihren jeweils über 70 Jahren im Feld schon alles erlebt, und es ist sehr die Frage, ob der jugendliche Elan des erst 26-jährigen französischen Armeechefs diesen Vorsprung wettmachen kann. In einem anderen Punkt spricht der Vergleich Alt gegen Jung eindeutig für die Franzosen. Das österreichische Militärsystem ist antiquiert. Während in Frankreich, wenn auch vorerst provisorisch, die allgemeine Wehrpflicht gilt und die égalité den Militärstand für vielversprechende Talente geöffnet hat, rekrutiert Habsburg seine Soldaten noch immer durch Werbung, die Offiziere sind fast alle adlig und viele Offizierschargen gekauft.
Am 2. April verlegt Napoleon das Hauptquartier von Nizza nach Albenga am Golf von Genua. Vorher hat er eine wichtige Personalentscheidung getroffen. Zum Chef des Generalstabs ernennt er den 43-jährigen Alexandre Berthier. Der gelernte Ingenieur wird ihm bald unentbehrlich sein. Die Offensive startet am 9. April. Das primäre Ziel ist, die Verbindungslinie von Österreichern und Piemontesen zwischen Coni und Novi zu durchtrennen. In der Nacht des 11. April überqueren die französischen Truppen im Dauerregen den Apennin. Am folgenden Tag schlagen sie die Österreicher bei Montenotte. Es ist Napoleons erster Sieg als Feldherr. Seine Soldaten sind schneller und weiter marschiert als der Feind. Napoleon hat die Armee so dirigiert, dass sie im entscheidenden Moment in der Überzahl ist. Am 13. April werden bei Dego die Piemontesen bezwungen, tags darauf erleiden die Österreicher bei Millesimo ihre zweite Schlappe. Die Verbündeten sind nun durch einen 40 Kilometer breiten Keil voneinander getrennt. Am 21. April stehen sich Franzosen und Piemontesen bei Mondovi gegenüber. Waren Montenotte, Dego und Millesimo bessere Scharmützel, wird bei Mondovi eine veritable Schlacht geschlagen. Wieder ist Napoleon der Sieger. „Ich habe in zehn Tagen 12 000 Gefangene gemacht, 6000 Feinde getötet, 21 Fahnen genommen und 40 Geschütze erobert. Du siehst, ich habe meine Zeit nicht verbummelt“, schreibt er am 23. April Barras und fügt hinzu: „Noch eine Schlacht, und es ist um den König von Sardinien geschehen.“156
In Wirklichkeit geht alles noch schneller. Die Regierung in Turin ist entnervt, die piemontesische Armee eingeschüchtert. Colli wird autorisiert, über einen Waffenstillstand zu verhandeln. Am 27. April, kurz vor Mitternacht, treffen die piemontesischen Unterhändler in Cherasco ein, wo Napoleon Quartier bezogen hat. Als Berthier die späten Gäste meldet, ist Napoleon überrascht. Er hat nicht damit gerechnet, dass der Feind so schnell die weiße Fahne hisst. Zunächst lässt er die Unterhändler warten. Einer von ihnen, Costa de Beauregard, schildert die Szene: „Endlich erschien Bonaparte. Er trug die Uniform des kommandierenden Generals und Stiefel, war aber ohne Säbel, Hut und Schärpe. Sein Auftreten war ernst und kalt.“157 Die Unterhändler versuchen zu feilschen, aber der junge Mann, der ihnen gegenübersitzt, lässt sich auf nichts ein. Um ein Uhr wirft Napoleon einen Blick auf die Uhr und erklärt: „Meine Herren, ich möchte Ihnen mitteilen, dass der Generalangriff auf zwei Uhr festgelegt ist.“ Der Bluff wirkt, die Unterhändler akzeptieren, was Napoleon von ihnen verlangt – die Übergabe aller Festungen und den ungehinderten Übergang über den Po. Als sie nach einem bescheidenen Nachtessen das Hauptquartier verlassen, dämmert ihnen, dass sie übertölpelt worden sind. Von einem unmittelbar bevorstehenden Generalangriff ist keine Spur. Costa: „Im Morgenlicht erblickte man die biwakierende französische Vorhut. Alles machte einen denkbar abgerissenen Eindruck. Man sah keine einzige Kanone, und die wenigen Pferde wirkten mager und müde.“ Collis Männer müssen sich eingestehen, dass sie eine Kapitulation unterschrieben zu haben, die nicht zwingend erforderlich war. Deprimiert schreibt Costa seiner Frau: „Es gibt Grund zu sterben vor Ärger und Scham.“158
Nach der Neutralisierung Sardinien-Piemonts durch den Waffenstillstand von Cherasco kann sich Napoleon der feindlichen Hauptmacht zuwenden. Die Österreicher haben sich hinter dem Po verschanzt und hoffen, von dieser Position aus den Vormarsch der Franzosen auf Mailand zu unterbinden. Die Operationen beginnen mit einem Täuschungsmanöver. Sérurier macht sich so auffällig in der Gegend um Valenza zu schaffen, dass der österreichische Feldherr Beaulieu hier den Hauptstoß der Franzosen vermutet. Stattdessen führt Napoleon das Gros seiner Truppen, das inzwischen durch 9000 Mann der Alpenarmee verstärkt ist, in Eilmärschen am Südufer des Po Richtung Osten. Die Marschzahl ist atemberaubend. In 36 Stunden werden 60 Kilometer zurückgelegt. Bei Piacenza setzt die Vorhut am Nachmittag des 5. Mai über den Po und wendet sich entlang der Adda nach Norden. Es gelingt Beaulieu, der die Gefahr, im Rücken gepackt zu werden, im letzten Augenblick erkannt hat, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Er rettet sich auf das Ostufer der Adda und versperrt den Übergang bei Lodi. Für Fußtruppen gibt es kaum eine größere Herausforderung, als einen durch starke Verbände und Artillerie gesicherten Engpass zu nehmen. Trotzdem befiehlt Napoleon am Morgen des 10. Mai den Sturm auf die 180 Meter lange Holzbrücke. Dreimal bricht der Angriff im Feuerhagel der sich unter General Karl Sebottendorf tapfer wehrenden Österreicher zusammen. Der vierte gelingt, nachdem ein Kavalleriedetachement die Adda flussaufwärts überquert hat und die Österreicher von hinten bedroht.
Mit dem Sieg von Lodi ist die erste Etappe des Feldzugs abgeschlossen. Die Koalition ist gesprengt, Österreich ist angeschlagen. Beaulieu kann sich in Richtung des stark befestigten Mantua absetzen. Napoleon sieht von der Verfolgung ab, seine Soldaten haben eine Ruhepause nötig. In einer Depesche an das Direktorium beziffert er die eigenen Verluste mit 150 Toten und Verwundeten. In Wahrheit sind es wohl an die 1000, während die Österreicher 2000 Mann verloren haben. Opferzahlen haben in Schlachtenrapports die Funktion, den Erfolg in noch hellerem Licht erstrahlen zu lassen. Napoleon macht hier keine Ausnahme. Am Ergebnis ändert das nichts. Er ist jetzt Herr der Lombardei. „Ich hoffe, dass ich Ihnen bald die Schlüssel von Mailand und Padua schicken kann“, schreibt er selbstbewusst das Direktorium an.159
In Lodi liest man heute auf einer Gedenktafel, hier habe Napoleon seine „unbesiegbaren Kolonnen“ in Stellung gebracht und „das Joch von zweihundert Jahren“ abgeworfen. Er habe auf der Brücke eine Fahne ergriffen und seine Soldaten zum letzten und entscheidenden Angriff geführt. Das ist eine Mär. In Wirklichkeit lenkte er die Operationen vom Turm der Dorfkirche der Heiligen Magdalena, die nahe der Brücke steht. Aber das stört die Legende nicht. Menschen wollen Bilder und Orte, damit sie ihrem Staunen einen Namen geben können. Die Brücke von Lodi ist so ein Ort, und natürlich muss es der Feldherr höchstpersönlich sein, der das Staunenswerte vollbringt. Übrigens fehlt in den Rapports, die Napoleon dem Direktorium erstattet, jedes Selbstlob. Er weiß, dass es besser ankommt, wenn er die Bravour seiner Offiziere hervorhebt. Über Berthier schreibt er: „Er war an diesem Tag Kanonier, Kavallerist und Fußsoldat in einem.“160
Mit Lodi beginnt die Verehrung der Soldaten für ihren Anführer. Sie nennen ihn von nun an ihren petit caporal. 20 Jahre später, in der Restaurationszeit, als es in Frankreich bei Strafe verboten ist, den Namen Napoleon auszusprechen, werden die Veteranen le petit caporal raunen, wenn sie ihren alten Chef meinen. „Das ist einer von uns“, soll der Spitzname besagen. Der General als caporal, als Unteroffizier: Eine höhere Auszeichnung gibt es nicht. Mit Lodi entsteht ein Band zwischen dem jungen Armeechef und seinen Soldaten, ein Band, das trotz vieler Prüfungen bis zuletzt nicht reißt. Napoleon hat der verlachten, schlampigen Truppe das Siegen beigebracht. Er hat den Zweifelnden versprochen, er werde sie in das Land führen, wo Milch und Honig fließt. Et voilà! Er hat sein Versprechen gehalten.
Vor den Geschundenen liegt die sanfte Lombardei, ein reiches Land. Die Versuchung ist groß, sich zu nehmen, was man so lange entbehrt hat. Vorbeugend hat Napoleon die Armee gewarnt: „Ich verspreche euch die Eroberung Italiens, aber nur unter einer Bedingung: Ihr müsst schwören, dass ihr die Völker, die ihr befreit, respektiert.“161 Als es trotzdem zu Plünderungen kommt, reklamiert er mildernde Umstände: „Die Unglücklichen sind entschuldbar. Nachdem sie drei Jahre auf den Höhen der Alpen geseufzt haben, kommen sie in das gelobte Land und wollen es genießen“, gibt er dem Direktorium zu bedenken. Exzesse will er durch drakonische Strafen unterbinden. „Drei Mann habe ich füsilieren lassen und sechs in Steinbrüche oben im Var geschickt.“162
Marodierende Soldaten sind für Napoleon Mob. Sie erinnern ihn an die von Blutgier berauschten Pariser in den Tuilerien, die ihn am 10. August 1792 so entsetzt haben. Etwas anderes ist die kontrollierte Ausplünderung der Besiegten. Da hat er wenig Skrupel. Die Besiegten zahlen zunächst in Form von Lebensmitteln. Er habe inzwischen mehrere Magazine mit Getreide und Mehl gefüllt, meldet Napoleon Carnot am 9. Mai und bittet ihn um weitere 4000 Kavalleristen: „Je mehr Männer Sie mir schicken, desto besser kann ich sie ernähren.“163 Die Seigneurs müssen natürlich am meisten bluten. „Sie erheben Kontributionen von den reichen Bezirken“, befiehlt er General Pelletier am 4. Mai und listet auf, was der General binnen 48 Stunden einzutreiben hat: „Erstens: 250 000 Franken an Kontributionen, die der Adel aufbringen muss, zweitens: 200 Stück Hornvieh, drittens: 200 Maultiere mit Packsätteln. (…) Sie erlegen dem Seigneur d’Arquata 50 000 Livres auf. Wenn er nicht zahlt, reißen Sie sein Haus ab und verwüsten sein Eigentum. Er ist ein wutschnaubender Oligarch, ein Feind Frankreichs und der Armee.“164
Napoleon gibt sich nicht damit zufrieden, den Seigneurs Soldi abzuknöpfen. Italiens Reichtum besteht auch aus Kunstschätzen. Wie alles, was er in die Hand nimmt, perfektioniert Napoleon die von den frühen Revolutionsarmeen übernommene Raubpraxis. Zunächst werden die Bestände aufgenommen. Die Vorarbeit leistet der französische Botschafter in Genua, Fairpoult de Maisoncelles, den Napoleon am 1. Mai auffordert, eine Liste aller „Gemälde, Statuen, Sammlungen und Kuriositäten [zusammenzustellen], die in Mailand, Parma Piacenza, Modena und Bologna anzutreffen sind“.165 Der zweite Schritt ist die fachmännische Auswahl. Die Kunstsachverständigen, die er dazu heranzieht, haben auch dafür zu sorgen, dass die fragile Konterbande für den Transport ordentlich verpackt wird. Einer der Selektionisten ist jener weiter oben erwähnte Pierre Tinet, der 1794 die „Versendung“ von Rubens’ Kreuzigung Petri von Köln nach Paris bewerkstelligt hatte. Anfang Mai werden 20 Gemälde auf den beschwerlichen Weg in die französische Hauptstadt gebracht, darunter ein heiliger Hieronymus von Correggio. „Ich gebe zu“, schreibt Napoleon der Regierung, „dass dieser Heilige einen schlechten Zeitpunkt erwischt, nach Paris zu reisen. Ich hoffe, dass man ihm die Ehren des Museums erweisen wird.“166 Der Spott kommt im religionsfeindlichen Paris so gut an wie die Ware selbst. Das Direktorium sieht keinen Widerspruch darin, einerseits die Kirchen als Stätten des Aberglaubens zu schließen, andererseits Monstranzen und Messkelche zu horten. Heiligenbilder und klösterliche Handschriften stapeln sich in den Hallen des neuen Zentralmuseums an der Seine, das 1804 in Musée Napoléon umgetauft wird und 1815 seinen endgültigen Namen erhält: Louvre-Museum.
Unterdessen stellen sich erste Konflikte mit dem Direktorium ein. Die Regierung betrachtet den Waffenstillstand von Cherasco als Eigenmächtigkeit des kommandierenden Generals. Napoleon sieht das anders. Um den Feldzug gegen Österreich ohne Verzug fortsetzen zu können, muss er den Rücken freihaben. Warten die Direktoren noch lange mit der Unterschrift unter den Vertrag, könnte es sein, dass die Piemontesen es sich anders überlegen. Ihre Armee ist teilweise noch intakt. Widerwillig lenkt die Regierung ein. Dabei kann sie sich nicht beklagen: Im Frieden von Turin, der am 18. Mai geschlossen wird, tritt König Victor Amadeus III. Savoyen und Nizza an Frankreich ab. Die Republik verbucht einen schönen Gebietszuwachs. Aber das Misstrauen ist einmal da. Der junge General ist erfolgreicher als erwartet. Vielleicht ist er zu erfolgreich. Man muss ihm Zügel anlegen. Also beschließen die Direktoren, seine Kompetenzen zu beschneiden. Sie teilen Napoleon mit, die Armee werde in Zukunft eine Doppelspitze haben. General Kellermann soll mit einem Observationskorps Beaulieu in Schach halten; von Napoleon wird erwartet, dass er im Süden der Lombardei Geld eintreibt und sich künftig aus der Diplomatie heraushält. Der 61-jährige François-Étienne-Christoph Kellermann ist der Held von Valmy. Gegen ihn lässt sich nicht viel einwenden, nur dass Napoleon Italien inzwischen als sein Terrain ansieht und das Kommando weder mit Kellermann noch mit einem anderen zu teilen gedenkt. Carnot, im Direktorium für das Kriegswesen zuständig, bekommt seinen Unwillen zu spüren. „Ich kann nicht mit einem Mann zusammenarbeiten, der sich für den ersten General Europas hält. Außerdem bin ich der Meinung, dass es besser ist, einen schlechten General zu haben als zwei gute.“167 Diplomatischer, aber forte in re äußert er sich wenig später: „In der augenblicklichen Situation in Italien ist es unerlässlich, dass der kommandiere General Ihr Vertrauen hat. Wenn ich diese Person nicht bin, werde ich mich nicht beklagen. Vielmehr werde ich auf dem Posten, den Sie mir zuteilen, meinen Pflichteifer verdoppeln, um Ihre Wertschätzung zu verdienen. Jeder hat seine Art, Krieg zu führen. Der General Kellermann ist erfahrener und wird es besser machen als ich. Aber wir zwei zusammen werden der Sache bloß schaden. Ich kann dem Vaterland nur dann die notwendigen Dienste leisten, wenn ich allein handle. Sicher kann man mir Ehrgeiz und Stolz vorhalten. Aber Sie haben das Recht, alle meine Gefühle zu erfahren, denn Sie haben mir stets Zeichen Ihrer Wertschätzung gegeben, was ich nie vergessen werde.“168
Die freundlich verpackte Rücktrittsdrohung tut in Paris ihre Wirkung. Die Regierung traut sich nicht, Napoleon beim Wort zu nehmen. Seine Siege haben Eindruck hinterlassen. Man will nicht riskieren, dass dieser offenbar talentierte General von der Fahne geht. In einer gequälten Entgegnung heißt es, nach reiflicher Überlegung und weil man „Ihren Fähigkeiten und Ihrem republikanischen Eifer“ vertraue, habe man beschlossen, alles solle beim Alten bleiben.169 Napoleon hat die Kraftprobe gewonnen. Er kennt jetzt seinen Marktwert und nutzt dieses Wissen, um seinen Handlungsspielraum zu weiten. Dabei hütet er sich, zu überreizen. In keinem seiner Rapporte fehlt die rhetorische Verbeugung vor der Autorität der Zentrale. Außerdem kennt er die Stelle, wo die Regierung augenblicklich schwach wird. Sie braucht Geld. Die Millionen, die das reiche Italien verheißt, sind ihr fast noch wichtiger als die Siege. „Lassen Sie nichts in Italien, was sich in Übereinstimmung mit unserer politischen Situation wegschaffen lässt und was uns nützlich sein könnte“, fordert das Direktorium in einer Weisung vom 18. Mai.170 Und der Chef der armée d’Italie liefert kistenweise: 20 Millionen von der Lombardei, zehn Millionen vom Herzog von Modena, eine Million vom Herzog von Parma. Die Höhe der Kontributionen legt der Feldherr fest, nicht die Regierung. Eine Extrabuße wird dem Papst auferlegt. Pius VI. hat die Revolution in Sendschreiben immer wieder scharf verurteilt, was angesichts der Priesterverfolgung kein Wunder ist. Dafür, dass man ihm seine Staaten lässt – am Ende muss er dann doch die Legationen* abtreten –, sind hohe Geldzahlungen noch zu gnädig. Er muss sich zusätzlich durch die Abgabe von 100 Kunstwerken und 500 wertvollen Manuskripten freikaufen. Übrigens behält Napoleon einen Teil der Schutzgelder für sich. Damit ist er in der Lage, der Armee den Sold zur Hälfte in Silber auszuzahlen statt zu 100 Prozent in Papiergeld, wozu er eigentlich angehalten ist. Bei den Soldaten kommt das gut an.
Nach Lodi ist Napoleon General und Staatsmann, eine Kompetenzerweiterung, die Jahre später im Konstrukt des Soldatenkaisers ihren Ausdruck findet. Auch er selbst betrachtet Lodi als Zäsur. „Ich verstand mich nicht länger nur als simpler General, sondern als ein Mann, der aufgerufen war, über das Schicksal von Völkern zu befinden. Es schien mir, als könnte ich tatsächlich ein entscheidender Faktor auf der nationalen politischen Bühne sein.“171 Das soll nach einem Erweckungserlebnis klingen. Dabei ist es doch wohl einfach so, dass ihm die Aktion des Politikers genauso gefällt wie die Aktion des Feldherrn. Beides ist Gestaltung. Die Vermischung wird dadurch begünstigt, dass die Regierung schwach ist, Paris weit und der rasante, in einem engen und territorial zerklüfteten Raum ablaufende Krieg ordnende Eingriffe verlangt, die nicht auf die schleppende Regierungskommunikation warten können. Für den Ehrgeizigen tun sich ganz neue Horizonte auf. Viele Jahre später schildert er dem General Montholon, einem der Gefährten von Sankt Helena, das Hochgefühl der Tage, die auf Lodi folgen: „Ich sah unter mir die Erde entschwinden, als ob ich plötzlich in die Lüfte getragen worden wäre.“172
Den krönenden Abschluss der ersten Feldzugsetappe bildet der Einzug in Mailand, Hauptstadt der eroberten Lombardei. „An der Spitze seiner jungen Armee, die eben die Brücke von Lodi überschritten und der Welt bewiesen hatte, dass nach so vielen Jahrhunderten Cäsar und Alexander ein Nachfolger entstanden sei, zog der General Bonaparte am 15. Mai 1796 in Mailand ein.“ Mit diesem Satz eröffnet Stendhal seine Kartause von Parma.173 Als Napoleon auf den Balkon des Palazzo Reale tritt, jubelt ihm die Menge zu. Sogar die Honoratioren machen gute Miene, trotz der 20 Millionen, um die der Sieger die Lombardei gerade erleichtert hat. Was sehen die Menschen in Napoleon? Sehen sie in ihm den Befreier, oder jubeln sie nur deshalb, weil das allemal klüger ist, als dem starken Mann trotzig zu begegnen? Fest steht, dass kaum jemand den Österreichern eine Träne nachweint. Die Franzosen sind, wenn auch nicht überall, Hoffnungsträger. In fast allen norditalienischen Städten existieren Zellen von Giacobini, Jakobinern. Ihr Gewicht ist schwer einzuschätzen, doch zweifellos übt das Nation-Konzept Frankreichs auf ein Land wie Italien, das politisch ein Flickenteppich ist, eine besondere Faszination aus. Frankreich könnte der Einheitsbringer sein und helfen, Kleinstaaterei und Fremdherrschaft zu überwinden. Das hoffen viele, und Napoleon gibt dieser Hoffnung Nahrung. Einen Tag nach dem Einzug in Mailand installiert er die Lombardische Republik.
Er ist in Hochstimmung. Am Abend des 15. Mai fragt er Marmont: „Eh bien, was glauben Sie, dass man in Paris über uns spricht? Ist man zufrieden? Noch haben sie nichts gesehen, die Zukunft hat uns viel größere Erfolge reserviert.“ Der Plutarch-Liebhaber ist nicht zu bremsen: „In unseren Tagen versteht keiner, was Größe ist. Es ist an mir, ihnen ein Beispiel zu geben.“174 Napoleon logiert im Palazzo des Herzogs von Serbelloni. Hier verwandelt er sich für ein paar Tage in einen Zivilisten, der als Mann des Geistes wahrgenommen werden will. Er führt lange Gespräche mit François Melzi d’Evril, einem der besten Köpfe Italiens. Er empfängt Schriftsteller und Gelehrte. Aus Rom lädt er Canova ein: „Als gefeierter Künstler haben Sie ein Anrecht auf den Schutz der Italienarmee“, schreibt er und offeriert dem Maler einen bezahlten Aufenthalt.175 Es ist dieselbe Geste von Genie zu Genie, mit der er 1808 Goethe in Erfurt beeindrucken wird. Während er repräsentiert und arbeitet, können sich seine Offiziere an der eleganten Damenwelt Mailands nicht sattsehen. Gerade erst sind sie wie die Bauern aus dem Gebirge herabgestiegen und haben dann wie die Berserker gekämpft. Jetzt investieren sie ihr erstes Hartgeld beim Uniformschneider, in der Hoffnung, am Abend in der Scala bei einer begehrten Schönheit zu reüssieren. Berthier verliebt sich in Mailand unsterblich in die schöne Fürstin Visconti.176
Napoleon muss sich mit dem Miniatur-Porträt Joséphines begnügen. Er hat aufgehört, es überall stolz herumzuzeigen. Wenn er es jetzt zur Hand nimmt, beschleichen ihn Ärger und Zweifel. Was ist das überhaupt für eine Verbindung? Die Flitterwochen im März haben ganze zwei Tage gedauert. Dann ist er zur Armee abgegangen. Beim Abschied in der rue Chantereine hat er geglaubt, seine Angetraute trösten zu müssen. „Sei ganz ruhig, ma bonne amie, nach dem Sieg werden wir genug Zeit haben, uns zu lieben.“ Inzwischen ist seine größte Sorge, dass sie sich anderweitig trösten könnte. Fast täglich schreibt er ihr. Die Antworten lassen meist auf sich warten. Oft findet er ihre Sprache kalt und beklagt sich. Seine Briefe bestehen aus lauter Ausrufezeichen. Es sind Eruptionen einer tollen Verliebtheit. Nicht selten enthalten sie erotische Anspielungen. „Ein Kuss ganz tief unten, viel tiefer als das Herz!“ Dreimal ist die Zeile unterstrichen.177
Seine Eifersucht ist begründet. Joséphine hat eine Affäre mit einem Husarenleutnant namens Hippolyte Charles, der neun Jahre jünger ist als sie und blendend aussieht. Rangniedriger als ihr Ehemann, besitzt er andere Qualitäten. „Du wärest verrückt nach ihm“, schwärmt sie einer Freundin vor. „Ich glaube, vor ihm hat niemand gewusst, wie man eine Krawatte bindet.“178 Was ihre Vergnügungen stört, sind die Briefe, die sie aus Italien erhält und die sie daran erinnern, dass sie verheiratet ist. „Es ist kein Tag vergangen, ohne dass ich dir geschrieben habe, keine Nacht, ohne dass ich dich umarmt habe. Keine Tasse Tee habe ich getrunken, ohne dass ich den Ruhm und den Ehrgeiz verflucht habe, die mich vom Mittelpunkt meines Lebens entfernt halten. (…) Joséphine, Joséphine! Denke an das, was ich dir manchmal gesagt habe: Die Natur hat mir ein starkes und entschlossenes Herz gegeben, Dich hat sie aus Spitzen und Gaze gemacht.“179 Unaufhörlich drängt er sie, zu ihm zu kommen. Das zwingt sie zu immer neuen Ausreden. Sogar eine Schwangerschaft täuscht sie vor. „Es ist also wahr, dass du schwanger bist!“, frohlockt Napoleon am 13. Mai. „Murat teilt es mir mit, aber er sagt, dass Dich das krank macht und dass es unvernünftig wäre, wenn Du jetzt eine so lange Reise auf Dich nähmst. Also werde ich des Glücks beraubt sein, Dich in meinen Armen zu halten.“ Mit Neckereien versucht er sie umzustimmen. Ihr kleiner Bauch werde sie interessant machen, behauptet er.180 Umsonst. Der Leutnant, der seine Krawatte so elegant zu binden versteht, ist Joséphine im Moment lieber als der mit seinen Siegen beschäftigte General. Erst im Juli trifft die Ungetreue in Mailand ein.
Militärisch tritt nach Lodi eine Verschnaufpause ein. Die Armee belagert Mantua, die letzte Bastion Österreichs in Oberitalien. Der Vormarsch durch Tirol auf Wien muss warten, weil die in Deutschland operierenden Armeen der Republik nicht vorankommen. Also schickt das Direktorium Napoleon nach Mittelitalien. Der Auftrag enthält keine präzisen Vorgaben, außer der, den am Wege liegenden Staaten so viel Geld wie möglich abzupressen. Die ersten Sendungen, die in Paris angelangt sind, haben Appetit auf mehr geweckt. Doch zunächst muss Napoleon einen Aufstand in Padua niederschlagen. Priester haben Bauern aus der Umgebung zum Widerstand gegen die ungläubigen Franken aufgewiegelt. Die kleine französische Besatzung von Padua kapituliert. Napoleon lässt den Kommandanten, weil er nicht bis zum letzten Blutstropfen gekämpft hat, erschießen. Die Stadt büßt für ihre Unbotmäßigkeit mit Plünderung. Auch andernorts brechen Aufstände aus. Hauptursache ist die Geldgier der Befreier. Wenn es bei lokalen Unruhen bleibt, liegt das daran, dass militärisch gegen die Franzosen kein Kraut gewachsen ist. In Livorno bricht Napoleon den Vormarsch ab. Von der Eroberung Roms verspricht er sich nichts, obwohl ihn das Direktorium ermuntert hat, „die Tiara des angeblichen Oberhauptes der katholischen Kirche zum Wackeln zu bringen“.181 Er ist auch so Herr über Mittelitalien. Der Papst bietet Verhandlungen an. Seinem Beispiel folgen das neutrale Venedig und Neapel, das Österreich mit Kavallerieeinheiten unterstützt hat.
In Wien ist Kaiser Franz entschlossen, den Kampf fortzusetzen. Ende Juli dringen zwei neue Armeen in der Gesamtstärke von 70 000 Mann über Tirol in Norditalien ein, kommandiert von den Generälen Quasdanowitsch und Wurmser. Ihr Auftrag ist, das belagerte Mantua zu entsetzen. Der Angriff ist stürmisch, die ersten Gefechte entscheiden die Österreicher für sich, Brescia und Verona fallen in ihre Hand. Die Franzosen müssen fürchten, eingekesselt zu werden. Was man im Frühling gewonnen hat, droht im Sommer zu verrinnen. In dieser kritischen Situation hält Napoleon entgegen seiner Gewohnheit Kriegsrat ab. Die Generäle wollen kein Risiko eingehen und plädieren für den Rückzug auf Mailand. Sie trauen ihren Ohren nicht, als Napoleon ihnen erklärt, die Österreicher seien so gut wie verloren. Ihre Armeen operierten viel zu unverbunden, ein Fehler, den es auszunutzen gelte. Sein Angriffsplan enthält allerdings eine bittere Pille. Um alle Ressourcen zu mobilisieren, muss die Belagerung Mantuas aufgegeben werden. Verärgert vernageln die Belagerer ihre Kanonen, die Munition wird in den Mincio geworfen. Am 1. August zieht Wurmser ohne Gegenwehr in Mantua ein. Doch seine Freude währt nur kurz, denn inzwischen hat sich die Italienarmee mit voller Wucht auf Quasdanowitsch geworfen, der am 3. August bei Lonato geschlagen wird. Wurmser, der das Manöver zu spät durchschaut, kommt nicht rechtzeitig zur Unterstützung heran. Am 5. August ist er an der Reihe. Napoleon besiegt ihn bei Castiglione. In drei Tagen machen die Franzosen 20 000 Gefangene.
Mit Geschick und großer Kaltblütigkeit hat Napoleon die unmittelbare Gefahr in Norditalien gebannt. In Deutschland erleidet die Republik dagegen schwere Rückschläge. Jourdan muss sich Ende August Erzherzog Karl beugen. Moreau geht auf den Rhein zurück. Der Plan, die Österreicher in die Zange zu nehmen, ist damit Makulatur. Die Regierung muss umsteuern. Jetzt kommt es ganz auf die bisher nur für eine Nebenrolle vorgesehene Italienarmee an. „In Italien müssen wir uns für die Niederlagen in Deutschland schadlos halten, dort müssen wir den Kaiser zum Frieden nötigen“, bestimmt eine neue Direktive des Direktoriums.182 Für Napoleon bedeutet das eine Genugtuung, aber das Schadloshalten ist leichter gesagt als getan. In Mittelitalien sind abermals Unruhen ausgebrochen, der Papst nimmt wieder eine feindliche Haltung ein. Die Befreiung Mantuas hat falsche Erwartungen geweckt. Im September geht Wurmser abermals in die Offensive. Bei Roveredo und bei Bassano zieht er zweimal hintereinander den Kürzeren.
Die frischen Erfolge lassen Napoleon bei einem erneuten Konflikt mit dem Direktorium sehr selbstbewusst auftreten. Es geht um die Bestimmung der Kriegsziele. Für die Regierung ist Belgien wichtiger als Italien. Wien muss unbedingt dazu gebracht werden, die im Vorjahr vollzogene Annexion anzuerkennen, wenn nötig im Tausch gegen die Lombardei. Napoleons Vorstellungen sind andere. Belgien ja, aber nicht um den Preis, dass seine Siege zur Verhandlungsmasse degradiert werden. Er will, dass Frankreich sich langfristig in Italien festsetzt. Das geeignete Mittel sieht er in der Kreation abhängiger Schwesterrepubliken. Er stachelt die Giacobini an. In einer Botschaft, die er am 26. September an den Senat von Bologna richtet, entfaltet er das ganze Revolutionspathos: „Die Zeit ist gekommen, wo sich Italien ehrenvoll einreiht in die machtvollen Nationen. Die Lombardei, Bologna, Modena, Reggio, Ferrara, vielleicht auch die Romagna werden, wenn sie sich würdig erweisen, bald schon Europa in Erstaunen versetzen und uns die schönsten Tage Italiens vor Augen führen. Macht, dass die Feinde eurer Rechte und eurer Freiheit erzittern. Ich werde mich um euch kümmern. Die Republikaner werden euch zeigen, wie man siegt. Ihr werdet lernen, wie man gegen Tyrannen vorgeht. Ich werde eure Bataillone führen, und euer Glück wird teilweise euer Verdienst sein.“183
Das sind große Worte; sie entsprechen nicht ganz der Realität. Der Habsburgerstaat ist hartnäckiger als gedacht. Im November lanciert Österreich eine weitere Offensive, die neue Streitmacht besteht hauptsächlich aus Kroaten und wird geführt von General Alvinczy, der schon den Siebenjährigen Krieg mitgemacht hat. Schauplatz heftiger Gefechte ist die Alpone-Brücke von Arcole. Napoleon muss den Übergang erzwingen, will er den Weg nach Verona freibekommen. Die Kämpfe dauern vom 15. bis zum 17. November. Der erste Tag verläuft verheerend. Die Franzosen starten eine Angriffswelle nach der anderen. Die letzte führt Napoleon in Person an. Auch sie bricht unter dem Feuerhagel der Kroaten zusammen. Unter den Toten befindet sich Jean-Baptiste Muiron. Der 22-Jährige, Napoleons Adjutant und bei ihm seit den Tagen von Toulon, hat sich schützend vor seinen Kommandanten geworfen und dafür mit dem Leben bezahlt. Im weiteren Verlauf entgeht Napoleon nur knapp der Gefangennahme. Im Durcheinander stürzt er von der Brücke; sein Bruder Louis und Marmont müssen ihn aus dem Sumpf ziehen. Es dauert drei Tage, bis die Franzosen die 25 Meter lange Brücke unter Kontrolle haben. Kriegsentscheidend ist das Brücken-Duell nicht. Die Würfel fallen erst am 14. Januar bei Rivoli. An den Ufern der Etsch erringt Napoleon gegen einen zahlenmäßig überlegenen Gegner seinen bis dahin glänzendsten Sieg. Alvinczy verliert 14 000 Mann (gegen 5000 auf französischer Seite). Seine Niederlage ist eindeutig. Am 2. Februar kapituliert Mantua.
In Paris erinnert die magistrale rue de Rivoli an die Schlacht an der Etsch. Den Sieg bei Arcole, der mehr eine Energieleistung als ein taktisches Meisterstück war, verewigt Antoine-Jean Gros. Der Bonaparte auf der Brücke von Arcole ist unter den zahlreichen Heiligenbildern Napoleons das dramatischste.184 Nebenbei bemerkt würde es die Ikone ohne den Beistand Joséphines nicht geben. Napoleon liebt es nicht, Modell zu sitzen. Er hat eine sehr spezielle Auffassung von der Porträtmalerei. Ähnlichkeit schaffe „nicht irgendeine Platterbse auf der Nase“, behauptet er. Alexander habe nie dem Apelles Modell gesessen. „Keiner fragt danach, ob die Porträts von großen Männern diesen ähnlich sind; ihr Genie muss man malen.“185 Nur auf Bitten Joséphines lässt er sich zu zwei Kurz-Séancen herbei, hampelt aber dermaßen herum, dass Joséphine ihn auf den Schoß nimmt, damit er sich wenigstens für einen Moment ruhig verhält.186
Nach Rivoli erhält Napoleon die von ihm wiederholt angemahnte Verstärkung, ein Beweis dafür, dass die Führungsrolle der armée d’Italie nunmehr anerkannt ist. Die Verstärkung tut not, denn Österreich bietet jetzt seinen besten Feldherrn auf, um das Kriegsglück doch noch zu wenden. Erzherzog Karl, der sich in Deutschland bewährt hat, soll Napoleon den Weg nach Wien versperren. Aber die Rettungsaktion scheitert. Die Franzosen müssen nicht mehr tun, als die Österreicher durch rasche und weitausholende Bewegungen auszumanövrieren. Sie überschreiten Piave und Tagliamento, nehmen Villach und Klagenfurt und stehen am Semmering, 100 Kilometer vor der österreichischen Hauptstadt. In drei Wochen haben sie nicht weniger als 650 Kilometer zurückgelegt und vollbracht, was man noch häufiger über Napoleon sagen wird: „Er siegt mit den Beinen seiner Soldaten.“ Karl kann nicht mehr hoffen, den Feldzug zu gewinnen. 20 000 Mann, eine halbe Armee, sind in Gefangenschaft geraten. In dieser Situation erhält der Erzherzog von Napoleon einen in Form und Inhalt verblüffenden Brief: „Herr Oberbefehlshaber, tapfere Soldaten führen Krieg und wünschen Frieden.“ Auf die philosophische Einleitung folgt ein Friedensangebot: „Gibt es denn keine Hoffnung, uns zu verständigen, und müssen wir wirklich fortfahren, uns nur für die Interessen und Leidenschaften einer dem Kriegsübel selbst fernbleibenden Nation [gemeint ist England, GM] zu erwürgen? Sie, Herr Oberkommandierender, der Sie durch Ihre Geburt dem Thron so nahestehen und erhaben sind über den Kleingeist, der oft Minister und Regierungen erfüllt, sind Sie entschlossen, sich den Titel des Wohltäters der Menschheit, des wahren Erretters von Deutschland, zu verdienen? Was mich betrifft, ich würde, wenn die Eröffnung, die ich Ihnen hiermit zu machen die Ehre habe, das Leben auch nur eines einzigen Soldaten retten könnte, stolzer sein auf die damit erworbene Bürgerkrone als auf den traurigen Ruhm, der aus kriegerischen Erfolgen erwächst.“187
Napoleons Initiative überrascht Freund und Feind. Die Direktoren raufen sich die Haare angesichts der neuerlichen Eigenmächtigkeit dieses Kommandeurs, der sie immer wieder vor vollendete Tatsachen stellt oder mit Rücktrittsdrohungen konfrontiert, der aber leider schon zu weit auf der Straße der Popularität vorangeschritten ist, als dass man ihn in die Wüste schicken dürfte. Was hat er ihnen nicht schon alles zugemutet! „Ich habe Ihren Friedensvertrag mit Sardinien erhalten. Die Armee hat ihn gebilligt.“188 Das ist nicht die Sprache eines Mannes, der sich als ausführendes Organ der Regierung betrachtet. Aber solche Briefe schreibt er dauernd. Politisch schaltet und waltet er, wie er es auf dem Schlachtfeld tut. Er schließt Verträge ab ohne Auftrag und erledigt Aufträge in einer Weise, die den Intentionen der Regierung zuwiderlaufen. Sollte er nicht den Papst aus seinen Staaten vertreiben? Pius VI. ist so unvernünftig gewesen, auf die Karte Österreich zu setzen. Das kommt ihn teuer zu stehen. Im Frieden von Tolentino (19. Februar 1797) muss er auf Bologna, Ferrara und die Romagna verzichten; die ihm ursprünglich auferlegten Kontributionen von 16 Millionen Francs werden auf 30 Millionen fast verdoppelt. Aber anders als von der Regierung gewollt, sieht Napoleon davon ab, die Heilige Stadt zu besetzen. Es wäre ihm ein Leichtes gewesen, doch er weiß, wie tief die katholische Religion im Volk verwurzelt ist. Was hätte Frankreich davon, würde sich Italien in eine große Vendée verwandeln? Statt den antireligiösen Ressentiments der Direktoren Folge zu leisten, unterhält sich Napoleon höflich mit Bischöfen, sichert Religionsfreiheit zu und weigert sich, französische „Refractäre“ zu verfolgen. Viele Eidverweigerer haben in Italien Zuflucht gefunden. Er lässt sie in Ruhe.
Wie soll die Regierung den unbotmäßigen General einhegen? Für das Waffenstillstandsangebot an Erzherzog Karl hatte er keine Vollmacht. Er begnügt sich damit, eine Kopie nach Paris zu schicken. In der Sache liegen die Direktoren und Napoleon gar nicht so weit auseinander. Der Regierung könnte ein Friedensschluss innenpolitisch Luft verschaffen. Nach sechs Jahren haben die Franzosen genug vom Krieg. Die nächsten Kammerwahlen sind in Sicht; es droht ein Rechtsruck. Mit einem vorteilhaften Frieden ließe sich die Stimmung vielleicht noch rechtzeitig drehen. Napoleons Gedanken laufen in eine ähnliche Richtung, nur dass er die Rolle des Friedensbringers mit niemandem teilen möchte, auch nicht mit der Regierung. Moreau und Hoche – Hoche ist der Nachfolger Jourdans bei der Sambre-Maas-Armee –, sind nach wie vor damit beschäftigt, den Rhein zu überschreiten. Als Konkurrenten um den Lorbeer des Siegers sind sie aus dem Rennen. Käme der Frieden jetzt zustande, würde der Sieg über Habsburg – sein Sieg! – mit der Palme des Friedens gekrönt. Zu seiner Erleichterung nimmt Österreich den Versuchsballon auf. In Wien geht die Angst um. Wer soll diesen General Bonaparte stoppen, der allem Anschein nach mit dem Glück im Bunde ist? Zur Sicherheit hat man einen Teil der Kaiserfamilie aus der Hauptstadt nach Ungarn verbracht. Eine der Evakuierten ist die fünfjährige Erzherzogin Marie Louise. 14 Jahre später wird sie Napoleon einen Sohn gebären.