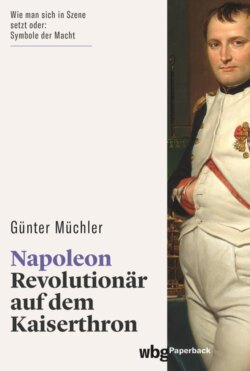Читать книгу Napoleon - Günter Müchler - Страница 25
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеWie unpopulär dagegen die Regierung geworden ist, bringen die Teilwahlen vom April an den Tag, die den Monarchisten erwartungsgemäß die Mehrheit im Parlament bescheren. Die Inflation ist hoch, sie trifft vor allem die bürgerliche Schicht. Aber hat die Regierung überhaupt noch irgendwo Rückhalt? Die „Verschwörung des Babeuf“ liegt erst etwas mehr als ein Jahr zurück. Babeuf, ein Journalist mit prä-kommunistischen Ideen, hatte mit einer Handvoll Gesinnungsgenossen das Direktorium stürzen wollen, wurde jedoch verraten. Die Affäre war eigentlich recht harmlos, weil es dem versponnenen Babeuf, der mit dem Kampfnamen „Gracchus“ an die Tradition großer Volkstribunen anzuknüpfen gedachte, nicht gelang, einen nennenswerten Teil des Pariser Volkes hinter sich zu bringen. Trotzdem nahm das Direktorium für sich in Anspruch, die Republik vor einer tödlichen Bedrohung gerettet zu haben. Sie machte dem „Gracchus“ einen Schauprozess, der mit der Hinrichtung endete.
Politische Nutznießer der „Verschwörung des Babeuf“ sind jedoch, wie die April-Wahlen zeigen, die Monarchisten. An der Spitze des Rates der Fünfhundert steht nun General Pichegru, der Sieger von Holland – und einstige Mathematiklehrer Napoleons in Brienne. Er ist ein gemäßigter Monarchist und spielt in den Überlegungen derer, die von der Wiedereinführung des Königtums träumen, die Rolle eines Monk. Der britische General Georg Monk leitete nach der Enthauptung Karls I. und dem Tod Cromwells die Restauration der Stuart-Monarchie in die Wege. Die Regierung ist gelähmt. Sie kann im von der Opposition dominierten Parlament kein Gesetz mehr durchbringen. Das Direktorium spaltet sich. Carnot und Barthélemy wollen auf die Parlamentsmehrheit zugehen. Der radikale Flügel mit Barras, Reubell und La Révellière sieht dagegen das Heil in einem Putsch.
Beim Staatsstreich des 18. Fructidor (4. September 1797) bleibt Napoleon im Hintergrund. Über die verfahrene Lage in Paris ist er gut im Bilde. Das Ansehen, das er inzwischen erworben hat, und sein Ehrgeiz lassen es nicht zu, sich aus dem Konflikt herauszuhalten. Eine Weile zögert er, dann entschließt er sich, auf die Karte Barras zu setzen, das heißt auf die Linke. Im Mai wird in Triest der monarchistische Spitzenagent d’Antraigues festgenommen. Der Graf steht mit allen Zweigen der Emigration in Verbindung, auch mit England. Napoleon lässt d’Antraigues nach Mailand bringen, wo er ihn persönlich verhört. Die Verhörprotokolle schickt er Barras. Sie scheinen zu belegen, dass eine große Verschwörung im Gange ist; Pichegru soll darin verwickelt sein. Gelingt die Verschwörung, wird es Barras an den Kragen gehen und vielleicht auch ihm, Napoleon. Im Rat der Fünfhundert hat er die rechten Abgeordneten nämlich mit seiner Venedig-Politik gegen sich aufgebracht. Zeitungen, die dem Club de Clichy, der konservativen Schaltzentrale, verbunden sind, hören nicht auf, ihn zu kritisieren. Wie beim Vendémiaire-Putsch sind seine Interessen also nahe denen von Barras. Am 14. Juli bezieht er Position. In einer Proklamation zum Jahrestag des Sturms auf die Bastille schwört er „unversöhnlichen Krieg den Feinden der Republik und denen der Verfassung des Jahres III!“ Einen Tag später fordert er die Direktoren zur Aktion auf. Sie könnten mit einem einzigen Schlag die Republik retten, depechiert er nach Paris. „Lassen Sie die Emigranten festnehmen, zerstören Sie den Einfluss der Ausländer. Wenn Sie Unterstützung brauchen, rufen Sie die Armee.“194 Daraufhin entschließt sich Barras, dem Putsch von rechts zuvorzukommen. Der Staatsstreich findet in der Nacht auf den 4. September statt. Exekutiert wird er von zuverlässigen Armeeeinheiten, die nach Paris eingeschleust worden sind, obwohl Paris für die reguläre Armee eigentlich verbotene Zone ist. Kommandiert werden die Truppen von Augereau, den Napoleon zur Unterstützung in die Hauptstadt beordert hat. Er selbst hat es vorgezogen, sich nicht allzu sehr zu exponieren – ein weiser Ratschluss. Denn die siegreiche Putschpartei räumt in unangenehm brutaler Weise auf. Die Wahlen vom April werden für null und nichtig erklärt, Dutzende Abgeordnete ohne Prozess in die Straflager von Guyana geschickt, darunter auch der Präsident der Fünfhundert, Pichegru. Gleichfalls deportiert wird das Direktoriumsmitglied Barthélemy. Carnot kann fliehen; nur deshalb bleiben ihm die Bagnes erspart.
Sieger des 18. Fructidor sind die Hardliner unter den Thermidorianern. Napoleon hat wesentlich zu ihrem Sieg beigetragen. Seine Stellung ist gefestigt. Auf die anstehende Umwandlung der Leobener Präliminarien in einen Friedensvertrag wirkt der 18. Fructidor beschleunigend. Österreich hat, solange in Paris noch nichts entschieden war, auf Zeit gespielt. Jetzt muss es Farbe bekennen. Außenminister Graf Cobenzl, der Thugut als Verhandlungsführer abgelöst hat, bezieht sein Hauptquartier in Udine, Napoleon schlägt seine Zelte im nahe gelegenen Passariano auf. Er ist nunmehr alleiniger Verhandlungsführer auf französische Seite, weil Clarke als Mann Carnots nach dem Fructidor im Abseits steht. Die Abstimmung mit Paris funktioniert trotzdem nicht. Nach wie vor hat die Regierung Bedenken, Österreich Venedig zu überlassen. Wieder und wieder fordert sie Napoleon auf, die Hierarchie der Ziele zu beachten. Zuallererst müsse Kaiser Franz dazu gebracht werden, den Rhein als Staatsgrenze anzuerkennen. Wie das geschehen soll, bleibt offen. Napoleon stellt sich gegen die ständigen Mahnungen taub. Er erklärt sich erschöpft, zwei Jahre der Ruhe würden ihm guttun. In Wahrheit ist er höchst aktiv. Nach dem Vorbild Venedigs installiert er auch in Genua eine neue, Frankreich gewogene Regierung. Genua, die Superba, ist dagegen genauso machtlos, wie es die Serenissima war. Er lässt die zu Venedig gehörenden Ionischen Inseln besetzen und führt in Venedig selbst revolutionäre Gesetze ein. Cobenzl erhebt Einspruch, schließlich soll der Kaiser demnächst die Herrschaft über Venedig antreten. Der Einspruch wird übergangen. Napoleon macht in den Verhandlungen unaufhörlich Druck. „Wie viele Meilen muss Ihre Armee marschieren, bis sie in Paris ist?“, provoziert er Cobenzl. Seine Armee brauche bis Wien nur eine Woche. Bei anderer Gelegenheit mimt er einen Wutanfall und zerschlägt Porzellan. Eine Zeit lang stehen die Verhandlungen auf der Kippe, aber letztlich will niemand den Krieg verlängern. Am 7. Oktober 1797 wird in Campo Formio, einem zwischen den beiden Hauptquartieren gelegenen Ort, Frieden geschlossen. Österreich tritt Belgien an Frankreich ab und erkennt die Cisalpinische Republik als neuen unabhängigen Staat an. Die Schöpfung Napoleons umfasst neben der Lombardei die drei päpstlichen Legationen, die Festung Mantua sowie das ehemalige Herzogtum Modena. Der Herzog von Modena wird mit dem österreichischen Breisgau entschädigt. Österreich erhält neben Dalmatien und Istrien sowie der Terra ferma bis zur Etsch nun auch die Stadt Venedig, was bis zum Schluss umstritten war. In einem geheimen Zusatzabkommen sagt Österreich Frankreich die Rheingrenze zu, und zwar von Basel bis zum Flüsschen Nette, das bei Koblenz in den Rhein mündet. Über die Entschädigung der betroffenen Fürsten sollen sich die Bevollmächtigten der Reichsstände mit Frankreich bei einem Kongress in Rastatt verständigen.
Campo Formio ist ein vergleichsweise gut abgewogener Friedensschluss. Die siegreiche Kriegspartei streicht einen fetten Gewinn ein. Die Verliererseite wird nicht an die Wand gedrückt. Österreich kann den Verlust Belgiens verschmerzen. Die ehemaligen habsburgischen Niederlande waren immer ein peripherer Besitz; früher hätte man sie gern gegen Bayern getauscht. In Italien bleibt Österreich präsent; es erfährt eine Ostverschiebung, die für den Habsburgerstaat eher vorteilhaft ist.
Was Frankreich betrifft, kann sich die Bilanz der Kriegsjahre 96/97 sehen lassen. Addiert man zu den Ergebnissen von Campo Formio den Ertrag des Friedens von Turin, steht auf der Habenseite der Erwerb von Savoyen, Nizza und Belgien. Die neue Vormacht auf der Apenninen-Halbinsel heißt Frankreich. Die Cisalpinische Republik ist ein Klientelstaat. Wie weit es mit ihrer Unabhängigkeit her ist, zeigt die Verpflichtung, Frankreich im Kriegsfall 20 000 Soldaten zu stellen. Kaum mehr als ein französisches Anhängsel ist auch die aus dem Gebiet der früheren Republik Genua geformte Ligurische Republik. Hinsichtlich der Rheingrenze bleibt Campo Formio ein Stück hinter den Maximalvorstellungen der Pariser Direktoren zurück. Die Eroberungen Frankreichs werden von Österreich (noch) nicht anerkannt. Die Besitzungen Preußens auf der linken Rheinseite (Kleve) bleiben vorerst ausgeklammert. Erst sollen die Reichsstände über die nötigen Entschädigungen befinden, und zwar im Einvernehmen mit Frankreich, wie es das Paragrafenwerk von Campo Formio vorsieht. Frankreich winkt damit doppelter Gewinn: erstens die Rheingrenze, zweitens die Ausweitung der französischen Einflusszone über den Rhein hinaus, weil die Entschädigung der Depossedierten rechts des Rheins erfolgen muss. Die fällige Flurbereinigung kann Frankreich durch kluge Regie in seinem Sinne lenken. Im Ganzen ist Campo Formio ein Vertrag des Übergangs, der nur den machtpolitischen Zwischenstand abbildet. Das gilt für die rheinische Causa, auch für Norditalien. Es liegt auf der Hand, dass das Nebeneinander der französisch beatmeten Cisalpinischen Republik und der ebenfalls abhängigen Ligurischen Republik mit dem sardischen Piemont und dem nunmehr österreichischen Venetien auf die Dauer nicht gut gehen kann. Auch über Belgien ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Solange Englands Unterschrift fehlt, kann Frankreich sich der neuen Provinz nicht sicher sein.
Hätte Napoleon ein besseres Resultat erzielen können? Akribisch rechnet er der Regierung vor, wie viele Einwohner Frankreich gewonnen hat: 4,3 Millionen durch die Abtretungen des Hauses Habsburg, 3,5 Millionen durch die neuen Grenzen Frankreichs.195 Gegenüber Talleyrand, der seit Kurzem Außenminister ist, argumentiert er so: „Ich bezweifle nicht, dass die Kritik alles daran setzen wird, den Vertrag, den ich soeben geschlossen habe, abzuwerten. Alle diejenigen, die Europa kennen und Ahnung von der Sache haben, werden davon überzeugt sein, dass es einen besseren Vertrag nicht geben konnte, ohne den Krieg neu zu beginnen und vom Haus Österreich weitere zwei oder drei Provinzen zu erobern. War das möglich? Ja. Wahrscheinlich? Nein.“ Sein Fazit: „Seit Jahrhunderten hat es keinen brillanteren Frieden gegeben als den, den wir machen.“196
Im Grunde kann Napoleon die Kritik kaltlassen. Das Volk denkt anders als die „Advokaten“ in Paris. Es leidet keinen Schmerz, weil der Republik verglichen mit dem imaginierten Gallien noch ein paar Landstriche westlich des Rheins fehlen. Frankreich ist auch ohne sie größer und mächtiger als seit Menschengedenken. Und wem hat man das zu verdanken, wenn nicht dem General Bonaparte? Er ist vainqueur et pacificateur, der Mann der Siege und des Friedens. Die Herren in Paris mögen Napoleon nicht wohlgesonnen sein; dass sie ihn fürchten, steht fest. Schmeichlerisch schreibt Talleyrand: „Die bloße Erwähnung des Namens Bonaparte ist eine Hilfe, die alle meine Schwierigkeiten aus dem Weg räumt.“197 Napoleons Stern strahlt auch deshalb so hell, weil es sonst so wenige Lichtblicke gibt. Die Direktoren im Luxembourg gelten als korrupt. In den Kammern sitzt niemand, der Funken versprüht. Und die Armee? Der junge Hoche, auf dem viele Blicken ruhten, ist plötzlich gestorben, Moreau hat auf dem deutschen Kriegsschauplatz keine Heldentaten vollbracht. Auch deshalb ist Napoleon der Mann der Stunde. Dass er in der Ferne wirkt und nur die wenigsten ein konturiertes Bild von ihm haben, macht ihn eher noch anziehender. Der große Unbekannte beschäftigt die Fantasie der Nation.