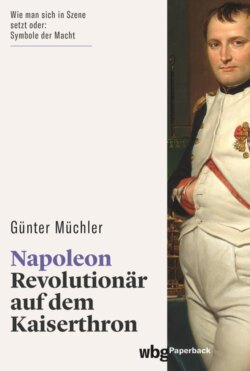Читать книгу Napoleon - Günter Müchler - Страница 24
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Campo Formio
ОглавлениеIn Mombello, nördlich von Mailand, steht auf einem Hügel die Villa Pusterla. Schaut man nach Norden, kann man die Alpen sehen, nach Süden liegt hingestreckt die lombardische Ebene. Für Napoleon ist dies der ideale Ort, um sich von den Strapazen des Feldzugs zu erholen. Vier Monate bleibt er in Mombello. Er unternimmt Ausflüge zum Lago Maggiore und zum Comer See. Im Übrigen hält er in seiner Villa Hof. Dort hat man sich bemüht, die gewohnte sansculottische Formlosigkeit durch eine rudimentäre Etikette zu mildern. 300 polnische Legionäre bilden die Garde einer quasi königlichen Betriebsstätte. Der Strom der Gäste reißt nicht ab. Alle wollen den Wundermann sehen. Fürsten und Städte schicken Abgesandte, um gutes Wetter zu machen. Der Mächtige gibt Festessen im Freien, wie es bei den Großen Sitte ist. Finanziert wird die Hofhaltung aus Napoleons privater Börse, die mit 300 000 Franken, vielleicht auch mehr, gut gefüllt ist. Wer nach Mombello kommt, erlebt einen betont einfach gekleideten jungen Mann, der erstaunlich souverän auftritt, so als sei er seit Jahren gewohnt, im Mittelpunkt zu stehen. Keinem Thema weicht er aus, zu jedem hat er etwas Geistreiches zu sagen, er scherzt und hört zu. Die Zuhörer sind verblüfft von seiner Offenheit, auch von seinem Zynismus. Er erteilt den Direktoren Zensuren und hält mit seiner politischen Ambition nicht hinter dem Berg. Bei einer Promenade im Park von Mombello hören Melzi und der Diplomat Miot de Melito aus seinem Munde: „Glauben Sie, ich triumphiere in Italien, um den Advokaten des Direktoriums (…) zur Größe zu verhelfen? Oder meinen Sie wirklich, mir läge an der Festigung der Republik? Was für ein Einfall! Eine Republik von dreißig Millionen Menschen! Mit unseren Sitten, unseren Lastern! Dies Hirngespinst wird Frankreich bald vergessen! Die Franzosen brauchen Ruhm und Befriedigung ihrer Eitelkeit, von Freiheit aber verstehen sie nichts. Sehen Sie doch die Armee. Unsere Siege haben dem französischen Soldaten seine wahre Natur bereits wiedergegeben. Ich bin ihm alles! Wollten die Direktoren mich zum Beispiel absetzen, so würden sie ja sehen, wer Herr der Armee ist.“ Und auch das sagt er: „Der Friede liegt nicht in meinem Interesse. Ist er erst da, und ich stehe nicht mehr an der Spitze der Armee, so muss ich auf Macht und Stellung verzichten, um im Luxembourg [dem Amtssitz der Direktoren, GM] den Advokaten zu huldigen. Ich verlasse Italien nur, um in Frankreich die gleiche Rolle zu spielen. Doch auch diese Frucht ist noch nicht reif, Paris ist uneinig, eine Partei ist für die Bourbonen, für die ich nicht kämpfen mag. Eines Tages will ich die republikanische Partei schwächen – allerdings nicht zugunsten der alten Dynastie.“189
Unter den vielen Wallfahrern, die es nach Mombello zieht, befindet sich auch die fast komplette Familie Napoleons. Einer nach dem anderen tauchen die Bonapartes in der Villa Pusterla auf, von Madame Mère bis zum Onkel Fesch, nur Lucien fehlt. Letizia hat die beschwerliche Reise nicht bloß aus Mutterliebe auf sich genommen. Der Sohn hat Karriere gemacht; jetzt geht es um die Karriere der Familie. Louis ist inzwischen einer von sieben Adjutanten des Generalissimus. Joseph hat die Ernennung zum Geschäftsträger in Parma in der Tasche. Zufrieden ist er damit nicht, er erwartet eine ranghöhere Verwendung, die sich auch bald in Gestalt des Botschafterpostens in Rom findet. Für die Schwestern können die „Advokaten im Luxembourg“, die sichtlich bemüht sind, Napoleon bei Laune zu halten, leider nichts tun. Bei ihnen geht es um Heiratspolitik. Napoleon muss feststellen, dass es einfacher ist, eine Schlacht zu gewinnen, als die Vorstellungen seiner Schwestern zu erfüllen. Die Damen haben ihren Kopf. Elisa will den Hauptmann Felice Bacchiocci heiraten. Er ist Korse, was für Letizia ein erstrangiges Argument ist. Nicht so für Napoleon, der erfahren hat, dass dieser Bacchiocci gut Freund mit Pozzo di Borgo sein soll. Indessen, Madame Mère drängt und drängt, bis Napoleon schließlich sein Amen spricht, allerdings nur unter der Bedingung, dass die 17-jährige Pauline ihre Liaison mit dem „Königsmörder“ Fréron aufgibt. Stanislas Louis Marie Fréron war in der Schreckenszeit ein schlimmer Schlächter. Nach der Einnahme von Toulon brüstete er sich damit, die Erschießung von täglich 200 Aufständischen angeordnet zu haben. Selbst Robespierre war angewidert von seiner Brutalität. Napoleon setzt durch, dass Pauline Fréron den Laufpass gibt und stattdessen den General Charles Leclerc heiratet.
Als Korse käme es Napoleon nicht in den Sinn, sich von der Sorge für den Clan zu dispensieren. Auf die Dauer wird ihm die Pflicht allerdings hart. Die Geschichtsschreibung stellt dem Bonaparte-Anhang kein gutes Zeugnis aus. Die Geschwister wissen mit einer erstaunlichen Selbstverständlichkeit zu nehmen. Dank für die vielen Vorteile, Titel und Ämter, die ihnen der Clansführer verschafft, kennen sie nicht. Erstaunlich ist Napoleons Nachsicht. Er ist nicht blind für die Schwächen der Familie. Die Schwestern sind kapriziös, die Brüder egoistisch, die Mutter raffgierig. Napoleon sieht sie ungeschminkt, häufig hält er ihnen vor, sie vergnügten sich, während er arbeite. Und doch lässt er niemanden fallen. Gerechterweise muss man sagen, dass die Geschwister kaum eine Chance haben, sich neben dem Übermächtigen zu profilieren. Die Bonaparte-Kinder sind allesamt intelligent. Bloß haben sie das Pech, stets an ihrem Bruder gemessen zu werden. Schneidend urteilt der Historiker Frédéric Masson über sie. „Sie besaßen alle Attribute des Genies, ausgenommen das Genie.“190
Joséphine hat bei den Bonapartes von Anfang an einen schweren Stand. Sie müsste wohl aus Korsika stammen, um vor den Augen ihrer Schwiegermutter zu bestehen. Stattdessen figuriert sie als „Pariserin“, und in diesem Wort ist alles enthalten, was Letizia missfällt. Joséphine sei zu alt für ihren Sohn, stichelt sie. Man werde ja sehen, ob sie ihm noch Kinder schenken könne. Ein Dorn im Auge sind den Bonapartes die beiden Kinder Joséphines aus erster Ehe, Eugène und Hortense, die Napoleon wie seine eigenen Kinder behandelt.
Der Schwachpunkt Joséphines ist ihr Leichtsinn. Sie kommt nach Mailand mit einem ganzen Tross, in dem sich auch ihr Liebhaber befindet. Wenn sie schon das schöne Frankreich verlassen muss, möchte sie wenigstens einen Trostspender um sich haben. Im November, als Napoleon früher als erwartet von einer Bataille nach Mailand zurückkehrt, findet er den Palazzo verlassen vor. Joséphine macht einen Ausflug in die Nähe von Genua und hat Hippolyte Charles mitgenommen. Napoleon, obwohl er seiner Sache nicht sicher ist, reagiert aufgebracht. Er glaubt, ein Anrecht darauf zu haben, von seiner Frau erwartet zu werden, wenn er aus dem Krieg heimkommt, und schreibt ihr einen wütenden Brief, in dem er sie bezeichnenderweise siezt. „Wer mag der wunderbare und neue Liebhaber sein, der Sie so vollkommen in Anspruch nimmt?“, fragt er und droht mit gespielter Ironie: „Joséphine, nehmen Sie sich in acht, eines nachts werden die Türen eingeschlagen sein und ich bin in Ihrem Bett. Sie wissen schon, der kleine Dolch Othellos!“191
Am 5. April wird in Judenburg Waffenstillstand geschlossen. Zehn Tage später beginnen die Friedensverhandlungen im steierischen Leoben. Das Direktorium hat aus Paris General Clarke geschickt, um dem Armeechef auf die Finger zu sehen. Doch Napoleon ist am Verhandlungstisch genauso schnell wie auf dem Schlachtfeld, und so kommt der Aufpasser zu spät. Am 18. April wird der Präliminarfrieden von Leoben geschlossen. Er trägt zwei Unterschriften, die des österreichischen Generals von Merveld und die Napoleons. Die Schlüsselfrage bei den Verhandlungen ist, was Österreich für welche Gebietsverluste bekommen soll. Nach wie vor sind die Regierung in Paris und ihr Generalissimus in dieser Frage nicht auf einer Linie.
Für das Direktorium haben die Sicherung Belgiens und die Anerkennung der Rheingrenze Priorität. Napoleon hingegen will die Lombardei nicht preisgeben, auch nicht im Tausch gegen Belgien. Eine Blockade droht, da von Österreich niemand erwartet, dass es beides abtritt, die Lombardei und Belgien. Napoleon führt die Lösung mit einem überraschenden Zug herbei. Er offeriert Österreich als Ausgleich für den Doppelverzicht Teile Venedigs. Der Haken bei der Sache ist, dass die Serenissima zwar ihre alte Machtstellung längst eingebüßt hat, aber noch existiert und keineswegs gewillt ist, die Unabhängigkeit aufzugeben. Napoleon hat keine Skrupel, einen Vertrag zulasten eines Dritten abzuschließen, handelte es sich dabei auch um die älteste Republik der Welt. In diesem Punkt ist er ganz Revolutionär. Die Kaufherren und Patrizier, die vom Dogenpalast aus Stadt und Terra ferma beherrschen, verdienen doch nicht deshalb Schonung, weil sie dies schon seit Ewigkeit getan haben! Ça ira! Aber was ist mit Österreich? Kann der Habsburgerstaat, der sonst immer den revolutionären Luzifer mit dem Kreuz der Legitimität in den Bann zu schlagen sucht, der Zerschlagung eines zwölfhundert Jahre alten Staates zustimmen? Aber wie das mit den hehren Grundsätzen so ist: Venedig ist mehr wert als die Lombardei. Es würde Österreich den Zugang zur Adria öffnen. Das legitimistische Gewissen wird mit Rabulistik beschwichtigt. Es sei ja nicht Österreich, das Venedig zur Schlachtbank führe, sondern Frankreich. In einer Instruktion gibt der Wiener Minister Thugut seiner Verhandlungsdelegation auf, von den Franzosen vollendete Tatsachen zu verlangen. „Bieten sie, wie angedeutet wurde, Teile des venezianischen Gebietes, so muss man ihnen vorstellen, dass der Kaiser Entschädigungen dieser Art unmöglich annehmen könne, ehe sie wirklich Frankreich gehören.“192
Es bietet sich Napoleon schon bald ein Vorwand, die Vorbehalte von Kaiser Franz zu zerstreuen. In einigen Städten der venezianischen Terra ferma lehnen sich Giacobini gegen die Obrigkeit auf. Die Fernsteuerung lässt sich nicht beweisen, aber das Cui bono weist ziemlich eindeutig auf Napoleon. Ostern kommt es in Verona zu einer gegenrevolutionären Bewegung, die einige Giacobini und Franzosen das Leben kostet. Als wenig später bei einem Scharmützel im Hafen von Venedig der Kapitän eines französischen Kriegsschiffes getötet wird, sind die Voraussetzungen für eine Intervention beisammen. Am 3. Mai 1797 erklärt Napoleon der Republik den Krieg. Dass er dazu nicht befugt ist, kümmert ihn wenig. Zwei Wochen später rücken die Franzosen unter General Baraguey in die Stadt ein. Vergebens hat der Doge zuvor versucht, Napoleon durch Bestechung zum Stillhalten zu bewegen. Eine Marionettenregierung wird installiert, die Kontributionen werden auf 15 Millionen Francs festgesetzt. Handwerker bauen die berühmte Quadriga marciana, die vier bronzenen Pferde, die Konstantin der Große einst für das Hippodrom von Byzanz schaffen ließ, ab und machen sie fertig für den Transport nach Paris.* Das Ende der zwölfhundertjährigen Serenissima ist gekommen. Bei der Übergabe der Stadt bricht der 90-jährige Ludovico Manin, der 120. und letzte Doge, tot zusammen. Der Handel mit Kaiser Franz kann zustande kommen.
Die Pariser Regierung zögert noch mit der Ratifizierung des Leobener Vertrags. Wie meist gehen die Meinungen der Direktoren auseinander. Reubell, der für die Außenpolitik zuständige Direktor, grollt. Sogar von der Absetzung Napoleons ist die Rede. Carnot ist für den Abschluss, Barras laviert. Er hat vom venezianischen Gesandten Quirini einen hübschen pot-de-vin von 600 000 Francs erhalten, um die Serenissima vor dem ruchlosen General zu schützen. Erst als Napoleon von dem Bestechungsgeschenk erfährt und damit droht, sein Wissen publik zu machen, dreht Barras bei.193 Von anderer Art sind Reubells Störmanöver. Reubell wirft Napoleon vor, er lasse Österreich zu billig davonkommen und opfere das linke Rheinufer seinem „privaten“ Interesse an Italien. Tatsächlich kämpft Napoleon in Leoben nicht mit letzter Härte für die Rheingrenze. Wichtiger ist ihm, Österreichs Zustimmung für die Cisalpinische Republik zu erhalten, die neben der Lombardei jetzt auch das Herzogtum Modena umfassen soll. Dennoch wird die Rheingrenze in Leoben nicht abgeschrieben. Frankreich kann die deutschen Territorien links des Rheins vorerst besetzt halten. Über die endgültige Grenzziehung soll ein Kongress befinden. Den Vorwurf, er habe mit der Leobener Vereinbarung seine Zuständigkeit überschritten, lässt er nicht gelten. Die Vereinbarung sei nur ein Vorvertrag, der nach vielen Seiten Spielraum lasse. Als die Kritik nicht abreißt, bietet er gleichmütig seine Demission an. Zugleich listet er Punkt für Punkt die Millionensummen auf, die die Italienarmee seit Beginn der letzten Kampagne „eingespielt“ hat. Für die objets de Rome, gemeint sind die vom Papst abzuliefernden Kunstobjekte, möge der Marineminister drei bis vier Fregatten nach Livorno schicken, wo man die Schätze gelagert habe. Nach langem Hin und Her gibt die Regierung ihren Widerstand gegen die Präliminarien von Leoben auf. Kein Wort mehr von einer möglichen Absetzung Napoleons. Die öffentliche Meinung verlangt den Frieden, die Verstoßung des Friedensbringers würde sie nicht hinnehmen. Die Theater von Paris begeistern ihr Publikum mit der Brücke von Lodi. Im Moment ist Napoleon der Liebling Frankreichs.