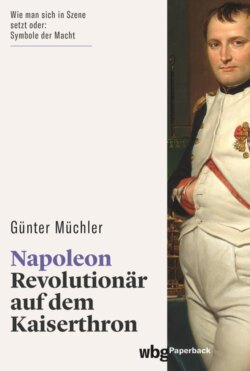Читать книгу Napoleon - Günter Müchler - Страница 28
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Gegen England in Ägypten
ОглавлениеUnterdessen hat das Direktorium Napoleon zum Chef der Englandarmee ernannt. „Geh’ und greife den gigantischen Korsaren, der die Meere überschwemmt, geh’ und kette den gigantischen Freibeuter, der die Ozeane unterdrückt, geh’ und strafe London für die Rechtsverletzungen, die zu lange ungestraft geblieben sind!“ Mit diesem pathetischen Appell218 entlässt Barras Napoleon in seine neue Aufgabe. Es sind starke Worte, bedenkt man, dass Barras Mitglied einer Regierung ist, die noch bis vor Kurzem mit der „Freibeuter“-Regierung Friedensgespräche geführt hat. Die Gespräche haben in Lille stattgefunden, die Initiative ging von England aus. England befindet sich ökonomisch und politisch in einer schwierigen Phase. Pitt muss im Unterhaus um eine Kreditaufnahme von 20 Millionen Pfund Sterling betteln, damit er das gewaltige Haushaltsdefizit ausgleichen kann. Auch Irland ist beunruhigt. Die irischen Autonomisten warten auf ein Zeichen Frankreichs, um den Freiheitskampf gegen die englische Krone zu entfachen. Meutereien in der Royal Navy bringen an den Tag, dass auch England nicht gänzlich gegen den revolutionären Bazillus gefeit ist. Das sind für Pitt Gründe genug, die französische Friedensbereitschaft zu erkunden. Aber die Gespräche verlaufen im Sand, weil Paris sich strikt weigert, einen Verzicht auf Belgien auch nur in Erwägung zu ziehen.
Das Weltmachtringen Frankreichs mit England tritt in eine neue Phase ein. Der Konflikt reicht zurück in die Zeit Ludwigs XIV. Zwischen 1688 und 1815 führen die Rivalen nicht weniger als sieben große Kriege. Von den 126 Jahren sind 64 Kriegsjahre.219 Die Wende zugunsten Englands findet im Siebenjährigen Krieg statt, der eigentlich ein Weltkrieg ist und in dem Frankreich den Fehler macht, auf Österreich statt auf Preußen zu setzen, den Traditionsverbündeten. 1763, im Frieden von Paris, muss Frankreich ganz Kanada und Louisiana östlich des Mississippi abtreten. In Ostindien bleiben ihm vom einstigen Kolonialbesitz nur noch ein paar Stützpunkte. Die Schmach von 1763 auszulöschen, ist seither Dreh- und Angelpunkt der französischen Außenpolitik. Im Unterricht in Brienne und dann in Paris lernt Napoleon, dass alle militärischen Anstrengungen dem einen Ziel zu dienen haben, England die Weltherrschaft streitig zu machen. Die Republik übernimmt diese Priorität. Mehr noch: Sie will ihre historische Überlegenheit dadurch beweisen, dass sie wiederherstellt, was die Monarchie verspielt hat – die französische Hegemonie. Es ist ein Kampf auf Leben und Tod. „Was ist unser Ziel?“, fragt Hoche und gibt die Antwort: „Der Frieden – Resultat der Zerstörung Englands.“220 Napoleon denkt ganz auf dieser Linie. In dem oben erwähnten Schreiben an Talleyrand vom 18. Oktober lauten die Schlusssätze: „Konzentrieren wir unsere Aktivitäten auf die Marine und zerstören wir England. Dann liegt uns Europa zu Füßen.“221
Also England! Nur, wie soll das Bollwerk des Meeres überwunden werden? Cäsar und Wilhelm der Eroberer haben das Kunststück geschafft. Aber zu ihrer Zeit existierte auch noch keine Royal Navy. In den Pariser Stäben werden zahlreiche Pläne erdacht und verworfen. Die verwegene Idee, einen Tunnel zu graben und trockenen Fußes den Kanal zu überqueren, ruht ebenso auf dem Friedhof geplatzter Träume wie die, mittels eines riesigen Ballons die erforderlichen Soldaten durch die Luft zu befördern.222 Hoche begnügt sich nicht mit Gedankenspielen. Er will Irland, die „Vendée Englands“, als Sprungbrett benutzen. Im Dezember 1796 sticht eine Flotte von Brest aus in See. Allerdings gerät sie in einen Sturm, nur ein paar Schiffen gelingt die Rückkehr in den Heimathafen. Auch der zweite Anlauf, diesmal von Texel ausgehend, scheitert. Die holländische Flotte wird am 11. Oktober 1797 von Admiral Duncan überrascht. Einen Aufstand unter Führung Wolfe Tones, der zur selben Zeit in Irland stattfindet, schlagen die Engländer blutig nieder. Hoche erlebt den Rückschlag nicht mehr. Er ist wenige Wochen vorher in Wetzlar einer Bronchialerkrankung erlegen.
Die vielen Fehlversuche sind Napoleon bekannt, als er im Februar 1798 die Kanalküste bereist. Der Abschied von Paris ist ihm leichtgefallen. Er muss nicht mehr fürchten, sein frischer Lorbeer könne durch anhaltende Untätigkeit verwelken. „Man vergisst in Paris alles“, sagt er zu Bourienne. „Wenn ich noch lange hier bleibe, ohne etwas zu tun, bin ich verloren!“223 Allerdings beurteilt er den neuen Auftrag skeptisch. Eine Invasion Englands setzt Bedingungen voraus, die nur langfristig hergestellt werden können. Die französische Marine befindet sich in einem unzulänglichen Zustand. Noch unter Ludwig XVI. konnte sie sich mit der britischen messen. Dann kam die Revolution. Tausende Seeoffiziere flohen, und anders als im Feldheer war der Aderlass bei der Marine aufgrund der höheren Anforderungen nicht so einfach wettzumachen. Besonders nachteilig wirkt sich aus, dass Frankreich seit Jahren nicht mehr in den Ausbau der Flotte investiert hat, was in England seit den 80er-Jahren kontinuierlich geschehen ist. Kein Wunder, dass die französische Flotte nach Umfang und Qualität der britischen selbst dann unterlegen ist, wenn sie von Marineeinheiten der verbündeten Niederländer und Spanier unterstützt wird.
Zwölf Tage reichen dem Chef der Englandarmee, um sich durch Besichtigungen in Boulogne, Dünkirchen, Ostende und Antwerpen mit der Realität vertraut zu machen. Sein Urteil steht fest. Für eine Landungsoperation im Kanal fehlt es an allem. In einer umfangreichen Denkschrift vom 23. Februar empfiehlt er dem Direktorium, das Projekt auf Eis zu legen. „So sehr wir uns auch anstrengen mögen, wir werden in den nächsten Jahren nicht in der Lage sein, die Vorherrschaft zur See zu gewinnen. Eine Landung in England, ohne Herr der Meere zu sein, wäre die kühnste und schwierigste Operation, die je unternommen wurde.“ Aktuell sei England besser durch die Besetzung Hamburgs oder Hannovers beizukommen. „Oder man macht eine Expedition in die Levante, um den [britischen] Handel mit Indien zu bedrohen.“224 Die Regierung besinnt sich nicht lange. Sie bläst das Invasions-Unternehmen ab und erteilt am 5. März die Ermächtigung für eine Militärexpedition nach Ägypten.
Bis heute haftet der Ägypten-Expedition etwas Exzentrisches an. Genehmigt sich Napoleon einfach eine Traumreise? Oder wird er von eifersüchtigen Direktoren buchstäblich in die Wüste geschickt? Zuzutrauen wäre es der Regierung. In der angespannten innenpolitischen Lage wäre sie den Mann, der so bedrohlich zu einer messianischen Figur heranwächst, gern los, zumal er in Ägypten gute Werke verrichten kann. Gegen diese Sicht der Dinge spricht allerdings die Entwicklung in Europa. Der Frieden mit Österreich ist brüchig. Jederzeit kann der Kontinentalkrieg wiederaufflammen. In dieser Situation den besten General und eine ganze Armee ins Land der Pharaonen zu expedieren, ist zumindest riskant. Bei Napoleon liegt die Sache einfacher. Paris hat seinem Ehrgeiz im Moment nichts zu bieten. Außerdem wimmelt es dort von Fallstricken. Dagegen das märchenhafte Ägypten! Das 18. Jahrhundert ist die Zeit der großen Entdeckungsreisen. Schon als Junge hat Napoleon Bücher über den Orient verschlungen, darunter Volneys Voyage en Égypte et en Syrie, das eine Aufforderung an Frankreich ist, nicht zu warten, bis andere den als unvermeidlich dargestellten Zerfall des Osmanischen Reiches ausbeuten. Die Aussicht, die Geheimnisse Ägyptens zu entschlüsseln und ungeahnte Reichtümer aufzuspüren, reizt seine Fantasie. Kann man Alexander und Cäsar näher sein als in Ägypten? Hier lässt sich Großes tun. Was ist schon Europa? „Ein Maulwurfshaufen“, findet er.225
Auch handfeste realpolitische Erwägungen lassen sich für die Expedition ins Feld führen. Man trifft England empfindlich, wenn man es schafft, den Isthmus von Suez zu durchstechen und die alte Handelsroute durch das Rote Meer nach Indien zu erneuern, die so viel kürzer ist als die beschwerliche Kaproute. Man kann eine reiche Kolonie gründen, wo Zuckerrohr gedeiht und Wolle zu gewinnen ist. Auf lange Sicht eignet sich Ägypten als Basislager für einen späteren Zug nach Indien. Schon Leibniz hatte in einer Denkschrift für Ludwig XIV. ein Ausgreifen nach Ägypten empfohlen. Choiseul, Außenminister Ludwigs XV., dachte in dieselbe Richtung. Jetzt ist die Gelegenheit da. Das Osmanische Reich, zu dem Ägypten wenigstens auf dem Papier gehört, ist ein taumelnder Riese. Mamelucken-Beys herrschen über Kairo und die Pyramiden. Es werde ein Leichtes sein, die Mamelucken zu besiegen, behauptet ein Kenner wie Charles Magallon. Eine gut geführte europäische Armee brauche nicht mehr als neun Monate, um das Land unter Kontrolle zu bringen. Der Kaufmann, der seit 30 Jahren in Ägypten lebt und französischer Generalkonsul in Alexandria ist, legt seine Ansichten in einem Memorandum nieder, das er am 9. Februar 1798 Talleyrand zuleitet. Der Außenminister ist angetan. Er schickt das Memorandum befürwortend weiter, nicht ohne den Ehrgeiz der Regierung zu kitzeln. Sie stehe vor der einmaligen Chance, sich ins Buch der Geschichte einzuschreiben. Das Ancien Régime sei unfähig gewesen, Ägypten für Frankreich zu gewinnen. „Diese Aufgabe“, behauptet er, „ist für das Direktorium reserviert.“226
Eine Stegreifidee ist die Expedition also nicht. Sie ist eine mögliche Variante im Dauerkampf gegen England. Napoleon geht der Gedanke schon eine Weile im Kopf herum. Im letzten Italien-Sommer, in Passariano, hat er das Thema lange Abende mit Monge erörtert. Mit Ägypten hat auch die von ihm betriebene und auf den ersten Blick unverständliche Inbesitznahme der Ionischen Inseln zu tun. Das stark befestigte Korfu bietet sich als Sprungbrett für die Eroberung Ägyptens an. Die Inseln seien für Frankreich „wichtiger als ganz Italien zusammen“, rechtfertigt Napoleon am 16. August 1797 die Okkupation gegenüber dem Direktorium. „Die Zeit ist nicht mehr fern, da wird uns klar sein, dass wir Ägypten erobern müssen, um England wirklich zu zerstören.“227 In dem schon mehrfach erwähnten Brief vom 21. September an Talleyrand legt er nach: „Sollten wir England am Kap lassen, so müssen wir uns Ägypten nehmen. Mit 25 000 Mann und acht bis zehn Linienschiffen ist die Expedition zu wagen.“228
Am 5. März wird die Großunternehmung von der Regierung beschlossen, schon am 19. Mai sticht die Flotte in See. Weil eine maritime Operation dieser Größenordnung unmöglich aus dem Stand heraus gemacht werden kann, liegt der Verdacht nahe, dass die Inspektion der Kanalküste im Februar nur ein Manöver war, um die Briten irrezuführen. Die Zurüstungen laufen verdeckt ab, was nicht einfach ist angesichts der Notwendigkeit, an die 50 000 Mann und eine gewaltige Anzahl von Schiffen zu bewegen. Napoleon speist Neugierige, die ihn nach seinen nächsten Vorhaben fragen, mit der Auskunft ab, er plane eine Bildungsreise nach Deutschland, zusammen mit Joséphine und Berthier!229 Monge gerät in Verlegenheit, weil Madame Monge fragt, weshalb er seine Wäsche zusammenlege. Schiffskapitäne erfahren ihre Koordinaten erst, als sie sich auf hoher See befinden. Keine Kleinigkeit ist die Zusammenstellung einer wissenschaftlichen Begleitmannschaft. Am Ende ist das personelle Aufgebot imponierend. Unter den Zivilisten befinden sich neben dem Physiker Monge der Chemiker Berthollet, der Naturwissenschaftler Geoffroy Saint-Hilaire, der Archäologe Jomard, der Orientalist Jaubert sowie der Zeichner und spätere Gründungsdirektor des Louvre, Denon. Mit von der Partie sind ferner ein Blumenmaler und ein Pianist. Die Gesamtliste umfasst 21 Mathematiker, drei Astronomen, 17 Ingenieure, 13 Naturwissenschaftler, 13 Geografen, zehn Schriftsteller – Napoleon verliert den Nachruhm nie aus dem Auge –, acht Zeichner und einen Bildhauer, dazu 23 Drucker, ausgestattet mit einem Vorrat an arabischen und griechischen Lettern. Napoleon denkt wirklich an alles. Wenn man in Kairo ist, muss man sich den Menschen verständlich machen können. Dazu braucht man nicht nur Dolmetscher (15 gehen mit an Bord), man muss auch in der Lage sein, Flugblätter und Bekanntmachungen zu drucken, und zwar in der Landessprache. Der Direktor der Staatsdruckerei hat die gewünschten Lettern, will sie aber nicht herausrücken. Wütend wendet sich Napoleon am 26. März an Innenminister Letourneux: „Ich fordere Sie auf, alle aktuell verfügbaren arabischen Lettern auf der Stelle zu verpacken. (…) Ich befehle Ihnen, gleichfalls die griechischen Lettern zu verpacken, es gibt solche.“230
Bei der Auswahl der „Weisen“ lässt sich Napoleon von dem Wirtschaftswissenschaftler Jean-Baptiste Say beraten, der auch die Reisebibliothek zusammenstellt. Sie enthält die Bibel und den Koran, dazu an die 100 Geschichtswerke, 39 geografische Werke und Reiseberichte, Kunstbücher und politische Bücher. In der schöngeistigen Abteilung befindet sich auch ein Exemplar des Werther. Goethe erfährt das viele Jahre später, als er in den Erinnerungen Bouriennes auf die Bibliotheksliste stößt. Stolz berichtet er Eckermann von seinem Fund: „Das Merkwürdigste an dieser Liste (…) ist, wie die Bücher unter verschiedenen Rubriken klassifiziert werden. Unter der Aufschrift ‚Politique‘ z. B. finden wir aufgeführt: ‚Le vieux testament‘, ‚Le nouveau testament‘, ‚Le Coran‘; woraus man denn sieht, aus welchem Gesichtspunkt Napoleon die religiösen Dinge angesehen.“231
Napoleon hat bei der Vorbereitung der Expedition alle Fäden in der Hand. Er benennt die Verbände, die er braucht, und steuert ihre Dislozierung. Er sorgt dafür, dass die erforderliche Schiffskapazität zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist. Er kümmert sich um die Bevorratung, nicht zuletzt um den Wein. 4800 Flaschen, hauptsächlich roter Burgunder, werden mitgenommen. Natürlich wählt er auch das militärische Spitzenpersonal aus, u. a. die Generäle Berthier, Desaix, Kléber, Menou, Reynier, die Brigadegeneräle Lannes, Davout, Murat und die Obersten Marmont, Junot, Lefebvre und Bessières. Mit dabei ist auch Thomas-Alexandre Dumas, auf Haiti geborener Sohn eines französischen Adligen und einer schwarzen Sklavin. Dumas ist der erste farbige Armeegeneral Frankreichs. Napoleon kennt ihn aus den Tagen des Italienfeldzugs. Da gaben ihm die Österreicher wegen seines Aussehens und seiner ungeheuren Körperkraft den Beinamen „Schwarzer Teufel“. Sein Sohn Alexandre wird ihn an Bekanntheit übertreffen. Mit Romanen wie Die drei Musketiere und Der Graf von Monte Christo wird er einer der meistgelesenen Schriftsteller des 19. Jahrhunderts sein.
Die politische Vorbereitung der Expedition läuft weniger perfekt ab. Ägypten soll französische Kolonie, die Soldaten sollen Siedler werden. Jedem vespricht Napoleon einen Hektar Land. Das Ziel steht insoweit fest. Aber genügt es, die Herrschaft der Mamelucken zu brechen? Wie soll eine Übereinkunft mit den Türken erzielt werden? Eine Kriegserklärung an die Hohe Pforte unterbleibt, sie wird noch nicht einmal in Erwägung gezogen. Talleyrand verspricht, persönlich nach Konstantinopel zu reisen und den Sultan versöhnlich zu stimmen. Das Versprechen vergisst er. Napoleon erlebt zum ersten Mal, dass dem Ex-Bischof nicht unbedingt zu trauen ist. Die unterlassene Kriegserklärung stellt zweifellos einen Rechtsbruch dar, außerdem ist das Osmanische Reich Frankreichs ältester Alliierter, ihm verbunden seit den Tagen Franz’ I. und Suleiman des Prächtigen. Aber das stört in Paris niemanden. Verträge und Konventionen haben die Republik in ihrem Vorwärtsdrang noch nie bremsen können. Bedenkenlos hat man das 1000-jährige Venedig über die Klinge springen lassen. Genauso bedenkenlos ist man gerade dabei, die in Ehren ergraute Eidgenossenschaft in den Schraubstock zu nehmen. Im März marschiert General Brune in Bern ein. Die Umwandlung der Schweiz in die Helvetische Republik erfolgt zum passenden Zeitpunkt. Mit den 30 Millionen, die Bern abgeknöpft werden, ist die Finanzierung der Ägypten-Expedition gesichert.232
L’Orient heißt das Admiralsschiff, auf dem Napoleon am 19. Mai in Toulon Frankreich verlässt. Weitere Konvois begeben sich von Marseille, Genua und Civitavecchia auf den Weg. Zusammen ergeben sie die größte Armada, die das Mittelmeer je gesehen hat. Sie besteht aus 15 Linienschiffen, 15 Fregatten, acht Korvetten, einer Reihe kleinerer Kriegsschiffe sowie 300 Transportfahrzeugen. Sie befördern 38 000 Soldaten und 16 000 Seeleute. Flottenkommandant ist Admiral Brueys. Der letzte Franzosenkönig, der auszog, Ägypten zu erobern, war Ludwig XI., der Heilige, gewesen. Sein Kreuzzug wurde 1250 von den Sarazenen gestoppt. Jetzt, 548 Jahre danach, verspricht der Sohn eines korsischen Rechtsanwalts, es besser zu machen als der heilige König. „Soldaten! Ganz Europa schaut auf Euch!“, deklamiert er vor der Abreise von Toulon.
Erstes Ziel ist Malta. Die für die Beherrschung des Mittelmeers bedeutsame Insel befindet sich seit Karl V. im Besitz des Malteserordens. Zum Glück für Napoleon sind die Verteidiger untereinander zerstritten. Mutlos übergibt der Großmeister von Hompesch nach nur drei Tagen das befestigte La Valetta, das 1565 den Türken so ruhmvoll standgehalten hatte. Hätte Hompesch gewusst, dass sich eine englische Flotte in der Nähe befindet, hätten sich die Franzosen an der mächtigen Bastion wohl die Zähne ausgebissen. So aber zieht Napoleon nahezu kampflos in La Valetta ein, die Ritter werden ausgewiesen, Kunstschätze requiriert. Und wie von Italien gewohnt, schlüpft Napoleon in die Toga des Gesetzgebers. Die Insel bekommt eine neue Verwaltung, die Straßen sollen gepflastert und beleuchtet werden, politische Gefangene werden befreit, die Juden dürfen eine Synagoge bauen und die Sklaverei wird verboten. Die klerikal geführte Universität muss künftig auch naturwissenschaftliche Lehrangebote machen. Sogar die Bezahlung der Professoren legt Napoleon fest. Binnen einer Woche ist das mittelalterliche Malta umgekrempelt.
Kurz nachdem er Malta verlassen hat, erfährt Napoleon, dass seine Armada von einem englischen Geschwader verfolgt wird. Die ganze Geheimhaltung hat am Ende nichts genützt. Einem englischen Leutnant namens William Day sind in Genua die zahlreichen Transportschiffe aufgefallen. Day unterrichtet seine Regierung. Die mag an eine französische Großoperation im Mittelmeer zwar nicht glauben, schickt aber sicherheitshalber ihren Admiral Nelson mit zehn Schlachtschiffen der Kanalflotte zur Verstärkung. Bei der Verfolgungsjagd, die nun beginnt, kommt Nelson den Franzosen mehrfach bedenklich nahe. Mit einem Mal wird deutlich, wie dünn der Faden ist, an dem die ganze Expedition hängt. Besonders kritisch wird es zum Schluss. Nelson nimmt richtigerweise an, dass die Franzosen die ägyptische Hafenstadt Alexandria ansteuern, und will sie dort stellen. Seine Kalkulation hat nur einen Fehler: Bei der Verfolgung durch das östliche Mittelmeer haben die Engländer, ohne es zu wissen, die französische Flotte überholt. Als Nelson vor Alexandria anlangt, und weit und breit kein Franzose zu sehen ist, lässt er Kurs auf die syrische Küste* nehmen, wo er den Feind jetzt vermutet. Einen Tag später, am 2. Juli, erreicht die französische Flotte den Hafen von Alexandria. Napoleon hat unglaubliches Glück gehabt.
„Le général Bonaparte donne un sabre au chef militaire d’Alexandrie“: Juli 1798, neben Napoleon General J. Murat und D.-V. Denon. Gemälde (1808) von François-Henri Mulard.
Die armée d’Orient nimmt Alexandria am 3. Juli ein. Die durch die Klassiker-Lektüre geschulten Eroberer sind von der Stadt Alexanders tief enttäuscht. Das einstige Zentrum der hellenistischen Welt ist zu einem ärmlichen Provinznest heruntergekommen. Die Einnahme ist kein Kunststück. Überrascht sind die Franzosen allerdings vom Fanatismus der Einwohner, die jedes Haus und jede Straße verteidigen. Napoleon hat es eilig, Alexandria hinter sich zu lassen. Er drängt Richtung Kairo. Ludwig der Heilige ist seinerzeit viel zu langsam vorgestoßen, die Sarazenen konnten ihren Widerstand aufbauen. Den Fehler will Napoleon nicht wiederholen. Am 13. Juli schlagen die Franzosen bei Shubrakhît eine Vorhut der Mamelucken. Die morgenländischen Reiter mit ihren prächtigen Pferden und blitzenden Säbeln sehen furchterregend aus, sie kämpfen aber ungeordnet und werden von der französischen Infanterie zusammengeschossen. Die Mamelucken-Führer sind zum Rückzug genötigt.
Am 21. Juli ist Kairo in Sichtweite. Hinter den Soldaten liegen furchtbare Marschtage. Mit der sengenden Hitze und der niederdrückenden Eintönigkeit der Wüste haben sie nicht gerechnet. Einige Soldaten verlieren den Verstand, andere nehmen sich das Leben. Aber jetzt dieses Schauspiel! Zur Rechten zeichnen sich die Umrisse der Pyramide von Gizeh ab, zur Linken recken sich die Minarette von Kairo. Weiter entfernt, an den Ufern des Nil, ist wie ein goldglänzendes Band die Kavallerie der Mamelucken zu erkennen. Der Anblick ist überwältigend. Napoleon deutet auf die Pyramiden: „Soldaten, vierzig Jahrhunderte schauen auf Euch herab …“ Die Authentizität der Ansprache ist ungesichert. In Napoleons Bericht an das Direktorium wird sie mit keinem Wort erwähnt. Vorstellbar ist sie als biografisches Selbstgespräch: Auge in Auge mit dem Monument der Monumente durchströmt den Jünger der Klio die Gewissheit, dass seine Arena die Weltgeschichte ist.
Die „Schlacht unter den Pyramiden“ ist ein ungleiches Duell. Die von Murad-Bey geführten Mamelucken und ihre arabischen Hilfskräfte haben außer ihrem wilden Mut den „Ungläubigen“ wenig entgegenzusetzen. Die französische Infanterie ist, wie schon bei Shubrakhît, zu carrés formiert. An diesen beweglichen Festungen zerschellen die stundenlangen blindwütigen Angriffe. Nach schweren Verlusten muss Murad-Bey fliehen. Am 22. Juli rücken die Franzosen in Kairo ein. Der erste Eindruck ist deprimierend. Ein zügelloser Mob plündert die Hinterlassenschaft der verhassten Mamelucken und massakriert ihren schutzlosen Anhang. Der Zivilisationsschock kuriert Napoleon endgültig von seinem philosophischen Jugendidol: „Ich bin angeekelt von Rousseau, seit ich den Orient gesehen habe; der Naturmensch ist ein Hund.“233 Indessen verstehen auch die Franzosen zu plündern. Am Nil haben die Mamelucken ein Lager mit reicher Beute hinterlassen. Ihrer Gewohnheit nach sind sie mit allem, was sie besitzen, in den Kampf gezogen. Die Sieger fleddern die Toten, man fischt die Leichen aus dem Nil und entkleidet sie, rafft Geld, Teppiche, Silber und Porzellan zusammen, so viel man tragen kann. Auf diese Weise entschädigen sich die Soldaten dafür, dass ihr Abenteuer nicht hält, was sich die meisten von ihm versprochen haben. Ein Land von Milch und Honig, eine zweite, märchenhaft verzierte Lombardei, ist Ägypten nicht. Auch Napoleon ist enttäuscht. An Joseph schreibt er: „Die menschliche Natur verdrießt mich. Ich wünsche mir Einsamkeit und Zurückgezogenheit. Die großen Dinge langweilen mich, jedes Gefühl ist verdorrt. Mit 29 Jahren ist der Ruhm fade geworden; ich bin ganz und gar erschöpft.“234
Zu seiner depressiven Stimmung tragen Neuigkeiten über Joséphines Untreue bei. Noch in Paris war es zu einem schweren ehelichen Gewitter gekommen. Der ältere Bruder hatte Napoleon davon in Kenntnis gesetzt, dass Joséphine ihn betrüge und außerdem in einen Bestechungsskandal verwickelt sei.235 Mit den Vorwürfen konfrontiert, zeigte sie keine Spur von Reue. Im Gegenteil: Bei ihrem Liebhaber, dem sie „tausend heiße Küsse“ versprach, beschwerte sie sich über die Familie ihres Gatten, die sie nicht leiden könne: „Ja, mein Hippolyte, ich hasse sie allesamt; nur du hast meine Zärtlichkeit, meine Liebe.“236 In Ägypten ist es nun Junot, der Napoleon ein Licht aufsteckt. Alle Anschuldigungen seien leider wahr. Joséphine setze ihm Hörner auf und mache ihn in Paris lächerlich. Napoleon explodiert. Er wolle die Scheidung, schreit er, beruhigt sich dann aber wieder.237 Was kann er tun? Er ist 600 Meilen fern des heimischen Herdes, zu weit, um den „Dolch des Othello“ zu zücken. Also hält er sich mit einer Retourkutsche schadlos. Die 17-jährigen Pauline Bellisle, Modistin aus Carcassonne, ist als Mann verkleidet einem gewissen Fourès, Leutnant bei den 22. berittenen Jägern, nach Ägypten gefolgt. Napoleon macht sie zu seiner Mätresse. Er ist bezaubert von „Bellilote“, schenkt ihr Schmuck und ein arabisches Pferd, und da das Verhältnis nicht geheim bleibt, heißt die hübsche Pauline Bellisle bei den Soldaten bald „die neue Kleopatra“.