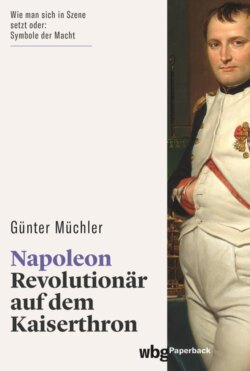Читать книгу Napoleon - Günter Müchler - Страница 26
Der Erfinder der politischen PR
ОглавлениеMilitärische Erfolge hat die Republik schon vor Napoleon errungen. Aber was sind Valmy, Jemappes und Fleurus verglichen mit Montenotte, Millesimo, Mondovi, Lodi, Castiglione, Arcole, Rivoli? Die Italien-Kampagne besitzt eine theatralische Magie, die durch die Konzentration von Ort, Zeit und Handlung entsteht. Montenotte, Millesimo, Mondovi: drei Namen, drei Tage, drei Siege. Den Franzosen, die zu Hause die Kriegsbulletins verschlingen, verschlägt es den Atem. Zwei Jahre lang hat sich die armée d’Italie nur zentimeterweise voranbewegt. Jetzt hat ein Monat genügt, und die ganze Lombardei ist erobert. Viermal haben die Österreicher, die wahrhaftig kein leichter Gegner gewesen sind, versucht, Mantua zu entsetzen. Viermal sind sie gescheitert. Muss hier nicht ein Genie am Werke sein?
Der Kult vom Kriegsgott Bonaparte kommt im ersten Italienfeldzug auf. Napoleon lässt ihn sich gern gefallen. Natürlich weiß er, dass er nicht unbesiegbar ist. Er weiß aber auch, dass der Ruf, unbesiegbar zu sein, durch nichts aufgewogen werden kann. Er selbst erklärt seine Erfolge damit, dass er mehr arbeite als andere. „Es ist nicht Genie, das mir plötzlich und auf geheimnisvolle Weise eingibt, was ich in Umständen, die andere überraschen, zu sagen oder zu tun habe: es ist Nachdenken, Meditation.“198 Vor allem ist es gute Aufklärung und präzise Kenntnis des Terrains. Napoleon besitzt ein fotografisches Gedächtnis. Was er einmal gesehen hat, real oder auf der Karte, kann er jederzeit abrufen. Dadurch ist er imstande, auf dem Schlachtfeld rasch und entschieden zu agieren. Genie? Napoleon erfindet die Kriegskunst nicht neu. Was die Waffentechnik anbelangt, ist er sogar erstaunlich gleichgültig, wenn es nicht gerade um die Artillerie geht. Seine Überlegenheit beruht auf der Anwendung recht einfacher Regeln. Eine der wichtigsten ist: Man muss schneller sein, als der Gegner denken kann. Deshalb zwingt er seine Leute immer wieder zu unerhörten Gewaltmärschen. Schnelligkeit überrascht und übervorteilt den Feind. Sie schafft die Voraussetzung für das, wonach gemäß einer unübertrefflich einfachen Formulierung Stendhals jeder Feldherr streben muss, nämlich, „dass sich seine Soldaten auf dem Schlachtfeld zu zweit gegen einen befinden“.199
Selbstverständlich müssen die Soldaten nicht bloß gut zu Fuß sein. Genauso wichtig sind psychologische Faktoren. „Im Krieg ist die Moral dreiviertel von allem, das Material ist einviertel“, doziert Napoleon.200 In puncto Moral sind die Revolutionssoldaten den Söldnern der Gegenseite überlegen. Sie sehen sich als Kämpfer für Werte wie Vaterland und Freiheit. Ihrem Kreuzritterelan haben die alten Mächte wenig entgegenzusetzen. Allerdings braucht der Idealismus eine Grundlage. Es ist keine Nörgelei, wenn Napoleon immer wieder eine bessere Versorgung und zuverlässige Soldzahlungen verlangt. Bei Truppenschauen, den sogenannten Revuen, fragt er die fantassins, die Fußsoldaten, immer zuerst nach dem Schuhwerk. Es kommt vor, dass er Soldaten auffordert, sich zu beschweren, wenn es Anlass gibt, auch über Vorgesetzte. „Ich bin hier, damit gerecht gegen alle gehandelt wird, und die Schwächeren haben einen besonderen Anspruch auf meinen Schutz.“201 Er vermittelt den Soldaten das Gefühl, dass sie ernst genommen werden. Er verlangt Leistungen, die er selbst erbringt. Er lobt großzügig, weil das den Ehrgeiz anstachelt. Umgekehrt straft er unnachsichtig, wenn nicht alles gegeben wird. Die Männer der Division Vaubois haben in einer Situation panisch reagiert und ihre Stellungen verlassen: „Ihr seid keine Franzosen!“, prangert er sie bei einer Parade an und befiehlt Berthier, auf die Divisionsfahne zu schreiben: „Sie gehören nicht mehr zur italienischen Armee!“202 Einheiten, die mehr als das Soll verrichtet haben, dürfen sich „die Unvergleichlichen“ nennen oder „Einer gegen zehn“. Das erzeugt Korpsgeist und ist Leistungsdoping. Wer zur 57. Halbbrigade gehört, auf deren Fahne steht: „Die furchteinflößende 57. Halbbrigade, die nichts aufhält“, wird stets bemüht sein, dem Ruf zu entsprechen.
Den Soldaten will er nah sein, die Generäle hält er auf Distanz. Er schätzt keine Vertraulichkeiten, den revolutionären Duz-Komment macht er nicht mit. Nur Duroc erlaubt er das familiäre tu. Nie vergisst er in seinen Rapporten, diejenigen zu erwähnen, die sich hervorgetan haben. In einer Zeugnisliste, die er am 14. August dem Direktorium schickt, heißt es über Berthier, den Generalstabschef: „Talent, Initiative, Mut, Charakter: alles für ihn.“ Augereau ist ihm als Mensch unsympathisch. Trotzdem bescheinigt er ihm, „kriegserfahren, beliebt beim Soldaten, glücklich in seinen Operationen“ zu sein. Mitleidlos fällt sein Urteil über andere aus. Über Abbatucchi: „Kann nicht 50 Mann kommandieren.“ Über Gaultier: „Gut für die Schreibstube.“203
Die Generäle ordnen sich dem Armeechef unter. Seine Befehle werden nicht angefochten; Anschwärzereien, sonst in politisierten Armeen an der Tagesordnung, sind Fehlanzeige. Napoleon ist ein Vorgesetzter wie die Generäle noch keinen kennengelernt haben. Er hat sonderbare Angewohnheiten, zum Beispiel die, dass er jede freie Minute zum Lesen nutzt. Ungewöhnlich ist auch, dass er sich nicht damit begnügt, Siege zu sammeln. Er empfängt Abgesandte von „Tyrannen“ und schließt Verträge, als wäre er Diplomat und die Regierung in einer Person. In großem Stil betreibt er Öffentlichkeitsarbeit, ein Fach, das auf keiner Offiziersschule gelehrt wird. „Seit Cäsar ist Bonaparte vielleicht der erste General, der die Bedeutung der Propaganda erkannt hat“, urteilt Jean Tulard.204 Im Juli 1797 gründet er eine eigene Zeitung, Le courrier de l’armée d’Italie („Der Kurier der Italienarmee“). Im August folgt die zweite, La France vue de l’armée d’Italie („Frankreich, gesehen mit den Augen der Italienarmee“), wenig später die dritte, das Journal de Bonaparte et des hommes vertueux („Zeitung Bonapartes und tugendhafter Männer“). Wozu braucht ein General eigene Zeitungen? Es gibt nur eine Antwort: Napoleon will im politischen Spiel bleiben. Er denkt über den Tag hinaus. Sein Kommando wird nicht ewig dauern. Die Zeitungen sollen seinen Bekanntheitsgrad steigern und ihn zeigen, wie er gesehen werden will. Er stilisiert sich als l’homme vertueux, als Mann, der die republikanischen Tugenden bewahrt. In La France vue de l’armée d’Italie kann man lesen, dass dieser General, der „fliegt wie ein Blitz und zuschlägt wie der Donner“, trotz seiner einsamen Größe bescheiden geblieben ist. Das Blatt zitiert den Selbstlosen. „Ich habe Könige zu meinen Füßen liegen sehen, ich hätte 50 Millionen mit nach Hause bringen können, ich hätte noch ganz anderes verlangen können. Aber ich bin ein französischer Bürger, ich bin der erste General der Großen Nation, ich weiß, dass mir die Nachwelt Gerechtigkeit widerfahren lassen wird.“205 Das ist frontal gegen die Pariser „Advokaten“ gerichtet, denen man nachsagt, dass sie viel von Tugend reden, in Wirklichkeit aber damit beschäftigt sind, sich zu bereichern, während das Volk darbt.
Die eigenen Zeitungen sind nur ein Ausschnitt von Napoleons Öffentlichkeitsarbeit in eigener Sache. Auch seine Tagesbefehle und Bulletins sollen in Frankreich gelesen werden. Und wenn er Schriftsteller und Gelehrte einlädt oder sich malen lässt, geschieht das in der Absicht, die Nachricht vom aufgehenden Stern der Italienarmee und ihres genialen Chefs in alle Windrichtungen zu verbreiten. Napoleon ist der Erfinder der politischen PR. Er hat das Wesentliche der Revolution begriffen. Das neue Phänomen der öffentlichen Meinung regelt den Zugang zur Macht. Früher genügte eine gute Position im Geburtskataster, um in die politischen Befehlsstäbe vorzurücken, jetzt muss man das Volk erobern. Napoleon hat Macchiavellis Discorsi gelesen: „Republiken sind Staaten, in denen das Volk Fürst ist.“ Er selbst sagt: „Was ist die Regierung? Nichts, wenn sie nicht die Öffentlichkeit hinter sich hat.“206 Den Fürsten Volk gewinnen und sich sodann vom Volk zum Fürsten machen lassen – das ist die Kunst der modernen Politik, die er erlernt und schließlich in Vollendung praktiziert. Natürlich benutzen auch Mirabeau, Danton, Marat oder Robespierre die Presse, um ihre Standpunkte unter die Leute zu bringen. Bei Napoleon sind die Mittel vielfältiger, und der Zweck ist weiter gefasst. Ihm geht es nicht bloß um die Verbreitung von Standpunkten und Ideen, es geht ihm darüber hinaus um Imagination, um die Bilder in den Köpfen. „Ich wirke nur auf die Einbildungskraft, sollte mir dieses Mittel fehlen, werde ich nichts mehr sein“, sagt er 1800 dem Schriftsteller Constantine de Volney.207
Einem Künstler gleich formt er das Bild des Generals Bonaparte und kreiert, was heutige Kommunikationsstrategen „Wiedererkennbarkeit“ nennen. Wie er sich kleidet, mit der schlichten Uniform der Gardejäger, dem Zweispitz (petit chapeau) aus schwarzem Filz sowie dem langen Staubmantel (redingote), wie er posiert (mit der unter die Weste geschobenen Hand) – nichts ist dem Zufall überlassen, alles ist Teil eines subtilen Image-Managements. Es funktioniert so nachhaltig, dass der 14-jährige Heinrich Heine Napoleon, als dieser 1811 durch den Hofgarten von Düsseldorf reitet, sofort an bestimmten Accessoires erkennt: „Der Kaiser trug seine scheinlose grüne Uniform und das welthistorische Hütchen.“208