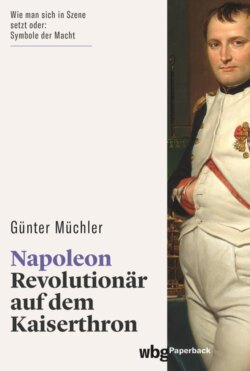Читать книгу Napoleon - Günter Müchler - Страница 29
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Erster Auftritt Nelson: Aboukir
ОглавлениеDer 1. August ist für Napoleon ein Arbeitstag wie jeder andere. Er plant, weist an und hält seine Kommandeure auf Trab. Das Korrespondenzregister des Tages umfasst 17 Befehle, jeder hat ein eigenes Sujet. Sucy, der verantwortliche Kommissar für die Versorgung der armée d’Orient, erhält einen Rüffel, weil die Brotöfen nicht die nötigen Rationen liefern. Berthier soll die 4. Halbbrigade der Leichten Infanterie beruhigen; der Sold sei unterwegs. Rosetti, ein venezianischer Kaufmann mit Ägypten-Erfahrung, jetzt Agent der Franzosen, bekommt schriftlich den Vier-Punkte-Entwurf eines Friedensabkommens, den er dem nach Oberägypten geflohenen Murad-Bey vorlegen soll.238
Die Katastrophe des Tages findet viele Meilen entfernt vom Kairoer Hauptquartier statt. Nelson hat nach langer Suchfahrt endlich die französische Flotte entdeckt. Sie liegt in der Bucht von Aboukir, östlich von Alexandria, vor Anker. Ohne einen Augenblick zu verlieren, greift Nelson an. Bei Beendigung des Seegefechts sind elf französische Kriegsschiffe versenkt, gekapert oder kampfunfähig gemacht. Die l’Orient explodiert, Admiral Brueys findet den Tod. Mit in die Tiefe nimmt das Flaggschiff 60 Millionen Franken, die den Maltesern abgepresst worden waren. Nur vier Schiffe unter Vizeadmiral de Villeneuve können entkommen.
Aboukir markiert für die scheinbar auf Erfolg abonnierten Franzosen mehr als einen nur temporären Rücksetzer. Sie haben keine Flotte mehr, was bedeutet: Die Expedition ist von der Heimat abgeschnitten, Verstärkung oder Truppenaustausch sind unmöglich, von der Rückführung ganz zu schweigen. In seinem Rapport vom 19. August – die Schreckensmeldung ist am 13. im Hauptquartier eingetroffen – gibt Napoleon Brueys die Schuld. „Er hat Fehler begangen; er hat sie mit seinem Tode gebüßt.“239 Der Admiral kann sich nicht mehr wehren. Später wird er Verteidiger finden, die eine unklare Befehlslage zu seinen Gunsten anführen.240 Unverständlich bleibt, weshalb Brueys, statt wie von Napoleon empfohlen, im alten Hafen von Alexandria oder in Korfu Schutz zu suchen, sich den Briten in der offenen Bucht als Angriffsziel geradezu aufdrängt. Womöglich glaubt er, den Briten, mit deren Auftauchen er nicht wirklich rechnet, im Fall des Falles gewachsen zu sein. Tatsächlich ist die französische Flotte der britischen an Feuerkraft leicht überlegen. Ausschlaggebend für das Desaster sind wohl mehrere Faktoren, an erster Stelle der unbedingte Angriffswille Nelsons, dann der bessere Zustand der englischen Schiffe und schließlich das eingewurzelte Inferioritätsbewusstsein der französischen Marine. Wie auch immer: Ägypten ist zur Falle geworden.
Drei Monate nach der Katastrophe von Aboukir, am 21. Oktober, bricht in Kairo eine Revolte aus. Die Initiative geht von den Studenten der al-Azhar-Moschee und von Bewohnern der Armenviertel aus. Ein französischer General, Dupuy, wird ermordet. Überall in der Stadt wird geschossen. Am 22. Oktober holen die Franzosen zum Gegenschlag aus. Von der Höhe der Zitadelle aus starten ihre Batterien ein mehrstündiges Bombardement, Truppen überrennen die Widerstandsnester. Das Innere der al-Azhar-Moschee wird verwüstet. Selbst vor der Schändung sakraler Gegenstände schrecken die Soldaten nicht zurück. Für die Ermordung von rund 300 Franzosen – die Verluste der Rebellen liegen um ein Vielfaches höher – werden Dutzende Aufständische exekutiert. Das Erschrecken der Franzosen über den unerwarteten Hassausbruch ist so groß, dass manch einem die Rache noch zu milde ausfällt. Sogar in der gelehrten Begleitmannschaft werden Stimmen laut, die ein härteres Strafgericht fordern. Im Courrier de l’Égypte, einer nach italienischem Muster gegründeten Zeitung, mahnt Napoleon zur Besonnenheit: „Die Franzosen gehen gegen ihre Feinde mit aller Kraft vor, aber sie gehorchen nicht der blinden Wut. Sie handeln unter den Augen der Geschichte und wissen, wie diese die Grausamkeiten, die Spanier und Engländer in Amerika und in Indien begangen haben, bestraft hat.“241
Die Invasoren reagieren auch deshalb so brutal, weil sie sich verkannt fühlen. Sie hatten geglaubt, die Ägypter würden ihnen dankbar sein für die Befreiung vom mameluckischen Joch und warteten nur darauf, von den „Franken“ das Geschenk der Zivilisation zu empfangen. Bemühungen, das Land voranzubringen, sind den Franzosen nicht abzusprechen. Damit die Ägypter lernen, für sich selbst einzustehen, richtet Napoleon unmittelbar nach dem Sieg von Gizeh eine Art nationale Selbstverwaltung ein. Dem „Diwan“ gehören Vertreter aus allen Landesteilen an. Er soll Steuern festsetzen, Recht sprechen und für die öffentliche Ordnung sorgen – natürlich unter französischer Aufsicht. Religiöse Befürchtungen versucht Napoleon zu zerstreuen. „Man wird euch sagen, dass ich gekommen bin, um eure Religion zu zerstören. Glaubt ihnen nicht! Antwortet ihnen, dass ich euch eure Rechte wieder gegeben, eure Drangsalierer bestraft habe und dass ich mehr als die Mamelucken Gott, seinen Propheten und den Koran respektiere“, versichert er in einer Botschaft an die Bürger von Alexandria.242 Die Muftis und Imame werden umworben, der islamische Feiertagskalender bleibt unangetastet. Ende August, zum Fest des Propheten, spielt eine französische Militärkapelle auf. Die Spitzenleistung der Anpassung liefert General Menou. Er tritt zum Islam über, heiratet eine Ägypterin, von der er behauptet, sie stamme von Mohammed ab, und fügt seinem Vornamen Jacques ein Abdallah hinzu.
Der fremden Religion Respekt zu zollen, ist ein ernsthaftes Anliegen Napoleons. Schon auf der Orient hat er seine Soldaten entsprechend eingestimmt. „Begegnet den Zeremonien, die der Koran vorschreibt, und den Moscheen mit derselben Duldsamkeit, wie ihr sie gegenüber den Klöstern, den Synagogen, der Religion des Mose und der Jesu Christi übt.“243 Die tolerante Haltung der neuen Kreuzfahrer spricht sich in Europa herum, kommt aber nicht überall gut an. In Wien zum Beispiel sieht man darin nur einen weiteren Beleg für den Abfall der Franzosen vom wahren Glauben. Bei Hofe lernt die kleine Erzherzogin Marie Louise, die noch nicht ahnt, dass sie einmal mit Napoleon das Ehebett teilen wird, dieser sei in Ägypten „Türke“ geworden.244 Das ist üble Nachrede und auch so gemeint, doch würde Napoleon nicht dementieren, dass sein Umgang mit den Religionen stark gebrauchsorientiert ist. Der Zweck heiligt die Mittel. Stolz erklärt er später einem Vertrauten: „Ich machte mich katholisch und beendete den Krieg in der Vendée; ich wurde zum Mohammedaner und etablierte mich in Ägypten; ich verwandelte mich in einen Ultramontanen und gewann die Italiener. Wenn ich eines Tages ein jüdisches Volk regieren sollte, würde ich den Tempel Salomons wieder aufbauen.“245
Napoleon will in Ägypten keine Proselyten machen. Sein Ehrgeiz ist, das Land zu modernisieren. Er stellt eine regelmäßige Kutschenverbindung zwischen Alexandria und Kairo auf die Beine und lässt Seuchenhospitäler einrichten. Ein Postsystem wird aufgebaut. Straßen werden beleuchtet, die Straßenreinigung wird eingeführt. Krone des zivilisatorischen Aufbauwerks ist die Gründung des mit einer eigenen Zeitung (La décade égyptienne) ausgestatteten „Ägyptischen Instituts“. Die Einrichtung, die 36 Mitglieder hat und in mehrere Sektionen gegliedert ist, soll drei Ziele verfolgen:
„1. Fortschritt und Verbreitung der Aufklärung in Ägypten.
2. Forschung, Studium und Publikation der natürlichen, gewerblichen und historischen Gegebenheiten Ägyptens.
3. Erledigung der Auskunftswünsche der Regierung.“246
Die Auskunftswünsche formuliert er gleich selbst: Kann das Nilwasser trinkbar gemacht werden? Sind für Kairo Wassermühlen geeigneter als Windmühlen? Wie ist der Stand des ägyptischen Schul- und Rechtswesens? Auch in alltagspraktischen Fragen sollen die Gelehrten den „Sultan Bonaparte“ beraten: Kann beim Bierbrauen der Hopfen durch einen anderen Stoff ersetzt werden? Und wie lässt sich die Brotproduktion für die Armee verbessern?
Zu ihrem Leidwesen erfahren die Aufklärer, dass die örtlichen Eliten, auf die sie ihre Bemühungen konzentrieren, in Passivität verharren. Führt man den „Eingeborenen“ Landkarten und astronomische Instrumente vor oder erklärt ihnen den Nutzen von Chemielaboratorien und Apotheken, reagieren sie skeptisch oder halten das Gesehene für Zauberei. Nebenbei, nicht jedes Unterrichts-Experiment funktioniert. Kurz nach der Ankunft, im November, fängt eine Mongolfiere Feuer und stürzt ab. „Es war klar“, notiert der ägyptische Chronist Al-Dschabarti nicht ohne Häme, „dass dieses Objekt den Drachen ähnelt, die die Sklaven für Hochzeiten und andere Feste basteln.“247 Die Weisen aus dem Abendland sind schnell entnervt: „Diese Wilden verdienen die Mühen nicht, die wir uns machen“, zürnt der Physiker Monge.248 In Wahrheit sind die „Wilden“ nicht davon überzeugt, dass die Eroberer ausschließlich von guten Absichten beseelt sind. Sie behalten ihr Misstrauen bei, gehorchen, weil sie es müssen, oder begehren auf. Die Insurrektion von Kairo unterstreicht in drastischer Weise, dass die Franzosen die kulturellen und zivilisatorischen Hürden unterschätzt haben. Die Gelehrten sind ernüchtert, die Soldaten langweilen sich. Je länger sie von der Heimat entfernt sind, desto vernehmlicher stellen sie die Sinnfrage. Wie geht es weiter? Wann geht es zurück? Weil man nicht den ganzen Tag Karten spielen kann, wendet man sich den Künsten der Ägypterinnen zu. Junot ist einer von denen, deren Forscherdrang nicht folgenlos bleibt. Den Sohn, den er zusammen mit einer „Wilden“ hat, nennt er Othello.
Nach und nach kontrollieren die Franzosen fast ganz Ägypten. Desaix hat in Oberägypten die verbliebenen Kräfte Murad-Beys weitgehend ausgeschaltet. Aber das Gefühl der Sicherheit trügt. Gefahr droht von der Türkei. Napoleon täuscht sich, wenn er, von Talleyrand darin bestärkt, annimmt, die Hohe Pforte werde die Einnahme der ägyptischen Provinz stillschweigend hinnehmen. Beeindruckt durch Nelsons Sieg bei Aboukir lässt sich die Türkei von England zu einer Kriegserklärung überreden. Der russische Zar Paul I., der als selbst ernannter Schutzherr Maltas über die Vertreibung der Ordensritter empört ist, verspricht Unterstützung. Im Oktober erfährt Napoleon, dass sich in Syrien ein osmanisches Heer sammelt. Am 10. Februar bricht er mit 13 000 Mann, einem Drittel der Armeestärke, in Richtung Norden auf. Die Ziele des Syrienfeldzugs sind begrenzt. Napoleon will einem türkischen Angriff auf Ägypten zuvorkommen. Außerdem sollen der Royal Navy die Basen in der Levante entzogen werden. Für weiter gehende Absichten, zum Beispiel für einen Vorstoß auf Istanbul, reicht die 13 000-Mann-Armee nicht aus.
Beim Aufbruch von Kairo schmettern die Soldaten, froh, dass die Zeit der Untätigkeit vorbei ist, den Chant du départ. Zuerst muss der Sinai überquert werden. Weil Winter herrscht, ist das Klima erträglich, trotzdem ist schon bald niemandem mehr nach Singen zumute. Der Krieg ernährt den Krieg – im kargen Palästina klingt die Devise wie ein schlechter Scherz. „Wir haben Hunde gegessen, Esel und Kamele“, schreibt Napoleon Desaix.249 Am 20. Februar wird El-Arish, 170 Meilen von Kairo entfernt, genommen. Napoleon gewährt den Unterlegenen freien Abzug gegen das Versprechen, nie mehr auf Franzosen zu schießen. Auf größeren Widerstand trifft die Armee in Jaffa. Die wegen ihres Hafens wichtige Stadt wird von der osmanischen Besatzung leidenschaftlich verteidigt. Einen von Napoleon geschickten Parlamentär lässt der Kommandant der Zitadelle enthaupten. Als die Franzosen schließlich in die Stadt eindringen, metzeln sie nieder, was sich ihnen in den Weg stellt. Sie machen 2400 Gefangene. Napoleon gibt den Befehl, die Gefangenen an den Strand zu treiben und zu erschießen, was auch geschieht. Der Sachverhalt der berüchtigten Gefangenen-Erschießung von Jaffa ist nicht umstritten, wohl aber die Bewertung. Ein Teil der Historiker beurteilt die Tat als kriegsnotwendig, ein anderer Teil als Verbrechen. Für die Seite Napoleons wird geltend gemacht, die Franzosen hätten sich der ihnen ungewohnten Brutalität der Kriegführung einfach angepasst. Dagegen entdeckt der englische Napoleon-Forscher Andrew Roberts in der Massen-Erschießung ein rassistisches Element. „Napoleon würde europäische Kriegsgefangene nicht exekutiert haben.250 Für die Zeitgenossen ist „Jaffa“ bald – wie später „Enghien“* – ein Reizwort, das über die Haltung pro oder contra Napoleon entscheidet. Goethe räsoniert noch 1829 über den Fall: „Dass er die achthundert [sic!] türkischen Gefangenen hat erschießen lassen, ist wahr; aber es erscheint als reifer Beschluss eines langen Kriegsrates, indem nach Erwägung aller Umstände kein Mittel gewesen ist, sie zu retten.“251
Ohne Zweifel befindet sich Napoleon in einem Dilemma. Die Gefangenen zu erschießen, verbietet das Kriegsrecht. Auf der anderen Seite kann er sie nicht einfach laufen lassen. Sie könnten kehrtmachen und sich der nächstbesten feindlichen Einheit anschließen, beispielsweise in Akko. Genau das haben die Verteidiger von El-Arisch getan; viele von ihnen hat man in Jaffa wiedergetroffen. Die Gefangenen nach Ägypten schicken? Das würde eine umfangreiche Eskorte erfordern und die Armee schwächen. Sie repatriieren? Das kommt schon wegen des Mangels an Schiffen nicht infrage. Das Gros der gefangenen osmanischen Kämpfer sind Albaner. Kann man die Gefangenen auf dem Vormarsch nach Norden mitschleppen? Das wäre riskant; außerdem, wie sollen sie ernährt werden, wo schon die Versorgung der eigenen Leute schwerfällt? Noch komplizierter wird die Lage dadurch, dass in Jaffa die Pest ausgebrochen ist. Schon sind die ersten Franzosen betroffen. Eine „schreckliche Notwendigkeit“ wird Napoleon später seine Entscheidung nennen, und die meisten Militärhistoriker haben ihm recht gegeben.252
Die Pest ist aus dem Nildelta eingeschleppt worden. Man hat die Infizierten, die jeden Tag mehr werden, in einem armenischen Kloster untergebracht. Am 11. März erscheint Napoleon in Begleitung von Ärzten in dem Nothospital. Er spricht mit den Soldaten und muntert sie auf. „Moralischer Mut“ sei das beste Mittel gegen die Ansteckungsgefahr, behauptet er. Nach einer Weile drängt ihn der Chefarzt Desgenettes zu gehen. Es sei gefährlich, länger an dem verseuchten Ort zu bleiben. Aber Napoleon lässt sich nicht beirren. Mehr als eineinhalb Stunden verbringt er bei den Kranken, allen Ermahnungen zum Trotz. „Diejenigen kennen ihn schlecht, die glauben, es sei leicht, seine Entschlüsse zu ändern oder ihn durch den Hinweis auf eine Gefahr zu verunsichern“, schreibt Desgenettes resigniert in seinen Erinnerungen.253 Die Geste spricht sich natürlich herum. Der Chef steht zu seinen Soldaten, selbst bei Gefahr für das eigene Leben. Später erhält Antoine Gros den Auftrag, die Szene im Kloster von Jaffa zu malen. Gros war nicht mit in Ägypten, er lässt sich die Einzelheiten von Denon schildern. Auf dem Bild berührt Napoleon die Wundmale eines Kranken. Die Darstellung ist eine Allegorie auf die wunderbare Heilkraft der französischen Könige, die nach der Krönung Skrofulösen die Hand auflegten. Gros’ Bonaparte visitant les pestiférés de Jaffa wird beim Kunstsalon von 1804 ein großer Erfolg.
Am 19. März erreicht die Armee das am nördlichen Ausgang der Bucht von Haifa gelegene Akko (französisch: Saint Jean d’Acre). Man befindet sich in Galiläa. Der Ortswechsel bringt es mit sich, dass Napoleon das Gewand des „Sultans Bonaparte“ abstreift. Er beabsichtigt, Drusen und christliche Maroniten gegen die moslemischen Osmanen in Stellung zu bringen. Die Christen in der Region haben einen schweren Stand. Gerade erst hat der Pascha von Akko, genannt Djezzar („der Schlächter“), den Heiligen Krieg ausgerufen und 400 Christen ins Meer werfen lassen, damit sie nicht mit den Franzosen kollaborieren. Akko ist noch immer umgürtet von den zweieinhalb Meter dicken Mauern, die der Kreuzfahrer Balduin von Boulogne Anfang des 12. Jahrhunderts errichten ließ. Trotzdem glauben die Angreifer des Jahres 1799, leichten Stand zu haben.