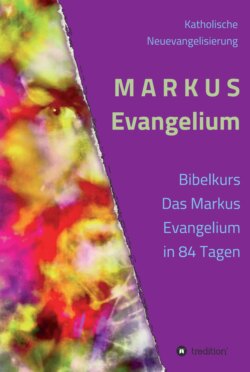Читать книгу MARKUS Evangelium - Günther Gerhard - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление9. Tag: 2,1-12
Die Heilung eines Gelähmten
Als er einige Tage später nach Kafarnaum zurückkam, wurde bekannt, dass er (wieder) zu Hause war. Und es versammelten sich so viele Menschen, dass nicht einmal mehr vor der Tür Platz war; und er verkündete ihnen das Wort. Da brachte man einen Gelähmten zu ihm; er wurde von vier Männern getragen. Weil sie ihn aber wegen der vielen Leute nicht bis zu Jesus bringen konnten, deckten sie dort, wo Jesus war, das Dach ab, schlugen (die Decke) durch und ließen den Gelähmten auf seiner Tragbahre durch die Öffnung hinab. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben! Einige Schriftgelehrte aber, die dort saßen, dachten im Stillen: Wie kann dieser Mensch so reden? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben außer dem einen Gott? Jesus erkannte sofort, was sie dachten, und sagte zu ihnen: Was für Gedanken habt ihr im Herzen? Ist es leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Deine Sünden sind dir vergeben!, oder zu sagen: Steh auf, nimm deine Tragbahre und geh umher? Ihr sollt aber erkennen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er sagte zu dem Gelähmten: Ich sage dir: Steh auf, nimm deine Tragbahre, und geh nach Hause! Der Mann stand sofort auf, nahm seine Tragbahre und ging vor aller Augen weg. Da gerieten alle außer sich; sie priesen Gott und sagten: So etwas haben wir noch nie gesehen.
Diese Geschichte zeigt uns, wie im Wirken Jesu "Leib-Sorge" und "Seel-Sorge" zusammengehören. Darüber hinaus ist sie aber auch ein kleines Kabinettstück der Erzählkunst in den Evangelien. Deshalb wollen wir zuerst beobachten, wie uns hier in wenigen Strichen eine Szene voll drastischer Anschaulichkeit und berührender Menschlichkeit geboten wird, die auch mit einer feinen Prise Humor gewürzt ist. Gerade so bezeugt und erschließt uns der Evangelist, was Menschen in der Begegnung mit Jesus damals wie heute erfahren können.
Unser erster Blick fällt auf ein berstend volles Haus. So viele Menschen wollen Jesus hören, als er "ihnen das Wort verkündete" (V. 2), dass nicht einmal mehr vor der Tür Platz ist. Wer jetzt erst kommt, hat keine Chance, zu ihm vorzudringen. – Ein zweiter Blick: Einige Leute, die offensichtlich von Jesu heilenden Taten gehört hatten, bringen einen Mann herbei, dessen Krankheit ihn vollkommen bewegungsunfähig gemacht hat: Er kann nicht einmal sitzen, sondern ist nur auf einer Trage liegend transportfähig. Sie wollen ihn unbedingt vor Jesus hinbringen, doch der Menschenauflauf blokkiert sie. Sie sehen keine Möglichkeit, sich mit dem Gelähmten auf der Bahre durch die Menge hindurch zu drängen. Sollen sie ihn wieder zurückbringen? Oder warten, bis sich die Versammlung aufgelöst hat und Jesus aus dem Haus kommt? Da tun sie etwas, das uns Leser fast schmunzeln macht und uns gleichzeitig tief berührt: Sie befördern den Mann samt seiner Trage auf das Hausdach. (Man will sich gar nicht vorstellen, wie sie ihre sperrige Last etwa über eine enge Außentreppe nach oben hieven, ohne dass der Behinderte dabei herunterfällt!) Sie beginnen das Dach abzudecken und die Decke durchzuschlagen. (Ob Jesus bei diesem Lärm und inmitten herabfallender Baumaterialien wohl weiter predigen konnte? Und die Hausbesitzer, haben die etwa gar nicht reagiert? Einerlei: Der Evangelist zeigt uns Leute, die buchstäblich alles daransetzen, um zu Jesus zu kommen!) Als die Öffnung groß genug ist, lassen sie die Trage (hoffentlich vorsichtig genug!) nach unten, dorthin "wo Jesus war" (V. 4). – Nun lässt uns der Erzähler einen dritten Blick tun. Es ist der Blick auf den Gelähmten selbst: Bisher konnten wir Leser ihn ja eigentlich noch gar nicht betrachten, weil wir damit beschäftigt waren, den Leuten, die ihn gebracht hatten (und die jetzt von oben durch das Loch herunter schauen?) bei ihren schweißtreibenden Bemühungen zuzusehen. Aber jetzt ist er da. Er liegt vor Jesus. Der sieht ihn an und weiß, welche Glaubenshoffnung "sie" (vgl. V. 5) – d.h. die Träger, der Gelähmte selbst ist ja offensichtlich zu keiner Initiative fähig! – angetrieben hatte.
Nun redet Jesus den Mann an: "Kind". (So heißt es im Urtext wörtlich). An diesem Wort hängt viel: Es drückt zunächst einmal Jesu freundliche Zuwendung und Sympathie aus, aber es liegt noch mehr darin. Als ein "Kind" hat diesen Mann wohl schon lange Zeit niemand mehr angesprochen. Ein Kind hat Zukunft, Entfaltungsräume und ein Leben voller Chancen vor sich, ein Kind wächst und ist voller Bewegungsdrang. Aber all dies trifft für diesen armen Menschen nicht zu. Er ist erstarrt und gelähmt, eingemauert in seiner Bewegungsunfähigkeit! Und doch sagt Jesus (ganz sicher nicht zynisch): Kind! Vielleicht dürfen wir schon in dieser Anrede eine Verheißung mithören: Menschen, die Jesus begegnen und von seiner Botschaft erstmals berührt werden, machen die Erfahrung, dass ihr Leben jung wird und voller Zukunft. Sie wissen sich beschützt und spüren Neugierde, wie es für Kinder typisch ist. Wie versteinert und bewegungsunfähig Menschen in ihrem bisherigen Leben auch geworden sein mögen, an Jesu Hand werden Menschen wieder Kinder: Menschenkinder, Gotteskinder.
Was Jesus dann zu dem Mann, der wortlos vor ihm liegt, sagt, macht hellhörig. Leser, die mit "Wundererzählungen" halbwegs vertraut sind, erwarten ja unwillkürlich, dass Jesus, der "ihren Glauben sah", nun von sich aus Worte der Heilung und Aufrichtung spricht, etwa "Steh auf, nimm deine Trage und geh!" Aber Jesus sagt: "Deine Sünden sind dir vergeben" (V. 5). Warum sagt Jesus das? Meint er, dass das zuvor vielleicht sündhafte Leben des Mannes von Gott mit Lähmung bestraft wurde, sodass eine Heilung des Leibes erst nach der Vergebung dieser Sünden möglich wäre? Das wohl kaum, denn der Evangelist schildert uns den Mann keineswegs als "bestraften Sünder". Und überhaupt sehen wir in den Evangelien nie, dass Jesus einen solchen unmittelbaren Zusammenhang herstellen würde oder dass er Kranken auf den Kopf zugesagt hätte, ihr Leiden sei die Folge ihrer Sünden. (In Joh 9,2 weist er die Jünger, die dem Blindgeborenen gegenüber solche Gedanken hegen, sogar ausdrücklich zurecht.) Oder meint Jesus etwa, der Mann habe so sehr mit seinem Schicksal gehadert, dass er an allem irre geworden ist und womöglich sich selbst und Gott verfluchte? Hätte Jesus ihn also von einer solchen "Sünde der Verzweiflung" freigesprochen? Auch dies trifft wohl kaum zu, denn der Evangelist gibt keinen Hinweis in diese Richtung.
Betrachten wir Jesu Worte also noch einmal näher. Die ganz wortgenaue Übersetzung ist: „Erlassen sind deine Sünden". Gemäß der Grundbedeutung des verwendeten Zeitwortes im Urtext (aphíemi) bedeutet das: Deine Sünden sind losgelassen und weggeschickt, sodass sie nicht mehr belasten und behindern. Jesus sagt dabei übrigens nicht "Ich erlasse dir deine Sünden" oder "Gott erlässt dir deine Sünden", sondern er stellt in feierlichpassiver Formulierung fest: "Deine Sünden sind erlassen". Er sagt nicht, worin diese Sünden bestanden, ob sie "groß" oder "klein" seien und nicht, ob sie etwas mit dem Zustand des Gelähmten zu tun haben. Er fordert den Mann nicht zur Reue auf, wobei er für den Fall einer nachhaltigen Umkehr dann Hoffnung auf Heilung machen würde. Vielmehr sagt er dem gelähmten Menschen, der da stumm vor ihm am Boden liegt, einfach und bedingungslos zu: "Kind, erlassen sind deine Sünden". – Wieder stehen wir vor der Erfahrung, die gemäß dem Zeugnis der Evangelien viele Menschen machten, wenn sie Jesus begegneten: Wo er ist, da fallen Lasten ab. Das, was uns festhält und niederdrückt, was krank und bitter macht, was daran hindert, gut zu den Menschen und fröhlich vor Gott zu sein, all das löst sich in Jesu Gegenwart irgendwie auf: Wo er ist, da ist die Macht der Sünde gebrochen und da sind unsere Sündentaten erlassen. Der erste hoheitliche Akt in der anbrechenden Königsherrschaft Gottes, in die Jesus die Menschen einlädt, ist immer: "Erlassen sind deine Sünden!" Kind, du bist frei. Freigelassen zum Gotteskind.
Der Evangelist erzählt uns keine Reaktion des Mannes, der immer noch am Boden liegt. Er lässt uns vielmehr in einem vierten Blick auf die Zuhörer schauen, unter denen auch einige Schriftgelehrte sind: Sie sitzen da, sind schockiert und denken: Wie kann dieser Mensch so reden? Er lästert Gott. Wer kann Sünden nachlassen außer dem Einen: Gott? (vgl. V. 6-7) Jesus bleibt ihre Reaktion nicht verborgen, er wendet sich ihnen zu und stellt ihnen eine Art "Rätselfrage". Vergleichbares kommt in vielen antiken Texten vor: Weise bringen mit Rätseln ihre Gegner zum Verstummen und demonstrieren ihre überlegene Einsicht, weil normalerweise die Gefragten keine Antwort wissen. In unserer Erzählung geht es mit der "Rätselfrage" aber weniger um die Zurückweisung der Schriftgelehrten oder die bloße Demonstration der Überlegenheit Jesu. In der Frage deutet sich vielmehr schon an, was Jesus gleich tun wird. Und gleichzeitig gibt die Erzählung uns Lesern Anlass zum Innehalten, zum Mit- und zum Nachdenken. Es ist ja nicht irgendein beliebiges Rätsel, das hier aufgeben wäre, Jesu Frage führt vielmehr in die Mitte und Tiefe seiner Sendung hinein, die für den gelähmten Mann konkret und erfahrbar werden soll. Wie ist das also? Was ist leichter: Zu einem Gelähmten sagen: Erlassen sind deine Sünden – oder: Steh auf, nimm deine Tragbahre und geh umher? (vgl. V. 9)
Unter dem äußeren Gesichtspunkt der "Kontrollierbarkeit" mag es leichter erscheinen, Sündenerlass auszusprechen: Wer könnte denn feststellen, ob solchen Worten auch eine tatsächliche Kompetenz entspricht? Sünden markieren den Sünder ja nicht mit einem sichtbaren Mal und das Freiwerden von Sünden ist ebenso kein äußerlich feststellbarer Vorgang. Und auf der anderen Seite gilt: Wer mit so souverän formulierten Heilungsworten einen Gelähmten öffentlich auffordert, aufzustehen, herumzugehen und seine Trage selbst zu tragen, der setzt sich hinsichtlich der Wirkung und des Erfolgs seiner Worte der unmittelbaren Überprüfbarkeit durch die Zuseher aus. Sündenerlass wäre so gesehen also leichter ausgesprochen als Heilung. – Unter dem tieferen Gesichtspunkt der wirklichen "Kompetenz" wird man die Sache allerdings wohl umgekehrt beantworten müssen: Wunderbare Heilungen mögen zwar selten sein, aber es gibt doch immer wieder Menschen, die solche Erfahrungen bezeugen und jede Zeit und Gesellschaft hat ihre außergewöhnlich begabten Therapeuten. Einen Gelähmten durch Zuspruch zu heilen, ist also nicht gerade "leicht", denkbar ist es aber. Hingegen: Allen Ernstes Sünden zu erlassen, d.h. die Verstrickung in Schuld wirksam auflösen, frei machen von dem, was uns Menschen wie ein Schatten begleitet, welcher Mensch wollte dies tun können? Die Schriftgelehrten haben in der Sache ja völlig recht: Sünden nachlassen, das überfordert Menschen grundsätzlich. Sünde ist keine Sache, die sich die Menschen unter sich ausmachen könnten. Sünde kommt daher, dass sich die Menschen insgesamt von Gott, dem Grund ihrer Existenz getrennt hatten. Sie wollten selber "wie Gott sein" und sich ihr "gut und böse" selbst festlegen (vgl. Gen 3,5). Doch dieser Versuch führte ins Bodenlosen und nur durch Gott kann der Mensch aus seiner Sünde herausfinden und wieder Stand gewinnen. Es ist also nicht bloß unendlich schwer, Sünden zu erlassen. Es ist Menschen überhaupt unmöglich. Nur Gott kann das wirken.
Jesus wartet nun eine Antwort der Schriftgelehrten nicht ab und der Evangelist wartet auch nicht, bis wir Leser mit der "Rätselfrage" auf den letzten Grund gekommen sind. Es geht gleich weiter (in ganz wörtlicher Übersetzung): "‚Damit ihr aber erkennt, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu erlassen auf Erden‘ – sagt er zum Gelähmten – ‚Ich sage dir: Steh auf, nimm deine Tragbahre und geh weg in dein Haus‘." (V. 10-11) Der Erzähler konstatiert, dass es so (und zwar genau nach Jesu Worten!) geschah: Der Mann stand auf, nahm sogleich seine Tragbahre und ging vor aller Augen hinaus (vgl. V. 12a). Den Schluss bildet, wie in vielen Heilungserzählungen, der kurze Hinweis auf die Reaktion der Anwesenden: Alle gerieten außer sich, priesen Gott und sagten: So etwas haben wir noch nie gesehen (vgl. V. 12b).
Im Rückblick auf die ganze Perikope drängen sich folgenden drei Überlegungen auf:
a. "Sündenerlass" und "Heilung" sind für Jesus keine Alternativen. Sie gehören zusammen. Dabei stehen sie aber nicht bloß unverbunden nebeneinander. Jesus tut nicht einfach das eine und dann das andere. Vielmehr verweist eines auf das jeweils andere: Unter Jesu Worten und Taten haben sich niedergedrückte Menschen buchstäblich aufgerichtet, sind an ihrem Leib heil und gesund geworden. Und Jesus hat real Arme, Ausgegrenzte und Unterdrückte in die Mitte der Menschen zurückgeholt. Dabei hat er diese konkreten Erfahrungen leiblicher und sozialer Heilung immer als Ereignisse der Königsherrschaft Gottes verstanden, die dort, wo er sie verkündet, auch wirklich anbricht. Wo er ‚im Finger Gottes‘ die Dämonen austreibt, da ist das Reich Gottes bereits angekommen (vgl. Lk 11,20). Und wenn dieser gelähmte Menschen sich erhebt, dann sieht man, wie es unter Gottes guter Herrschaft zugeht. Solche wunderbaren Erfahrungen geschehen bei Menschen, die an Jesu Evangelium zu glauben beginnen (V. 5!) und sie geschehen auch, damit die Menschen erkennen und glauben können (V. 10!), dass Gott es ist, der uns in Jesus begegnet und anrührt. Jesu Heilungen und Befreiungen lassen erkennen, dass und wie Gottes Königtum mitten unter uns anfängt. Bei den Menschen, zu denen es kommt, ist sein erster Hoheitsakt: Der Erlass von Sünde und ein neuer Anfang als aufrechte "Bürger" und "Kinder" der Gottesherrschaft.
Ohne damit konkrete Kranke und Leidende zu beleidigen oder zurückzustoßen (im Gegenteil!), weiß Jesus im Innersten: Krankheit, Unfreiheit, Ausgrenzung sind die Ausweiszeichen der Herrschaft der Sünde über die Menschen. Und Heilung, Befreiung und das Hereinkommen der Ausgeschlossenen sind die Ausweiszeichen der Herrschaft Gottes.
Darum gehören Erlass der Sünden und Heilung des Leibes im Tiefsten zusammen. Nicht immer wird die in dieser Erzählung so drastisch gezogene Verbindung sogleich unmittelbar und augenscheinlich erfahrbar werden. Vielleicht war dies auch im Wirken Jesu nicht in jedem einzelnen Fall gegeben, im Wirken seiner Nachfolgegemeinde, der Kirche, ist es jedenfalls so. Aber auch heute gilt: Wo immer Christen das Evangelium verkünden, mühen sie sich gleichzeitig darum, in Jesu Namen Erfahrungen von Heilung, Aufrichtung und Befreiung von Menschen anzustoßen und freizusetzen. Wenn sie Kranke pflegen, Betrübte trösten, Verirrten einen neuen Weg anbieten und um Gerechtigkeit für die Armen ringen, dann tun sie dies nicht nur aus einer allgemeinen ethischen Verpflichtung (und schon gar nicht als billige Propaganda!), sondern weil sie für sich selbst und für die Menschen, die in vielerlei Hinsicht niedergedrückt sind, nach Hinweisen und Ausweiszeichen für jenes Reich suchen, das schon "(mitten) unter uns" (vgl. Lk 17,21) ist. Es gibt keinen besseren "Gottes-Hinweis" als heil und frei gewordene Menschen, um derentwillen Gott gepriesen wird (V. 12).
b. Wer ist Jesus, dass er es wagen darf, einem Menschen den Erlass seiner Sünden zuzusprechen? Damit nimmt er ja – wie die Schriftgelehrten ganz richtig erkannt haben – nichts weniger als ein Hoheitsrecht Gottes in Anspruch. Die Alternative ist klar: Entweder Jesus ist ein blasphemischer Lügner oder er tut es in göttlicher Vollmacht (exusía). Die Erzählung führt uns also in die Mitte dessen, was man "Christologie" nennt: Wer ist Jesus, dass er so spricht und handelt?
Der Evangelist Markus hat sein Buch eröffnet mit jenem Bekenntniswort, das die ersten Christen immer wieder sagten, wenn sie ihre Glaubensgewissheit ausdrückten, wer Jesus ist: "Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes" (Mk 1,1). Und er hat uns in der ersten Erzählung seines Buches, der Taufe im Jordan, eine Stimme aus dem Himmel hören lassen, die Jesus als "meinen geliebten Sohn" anspricht (1,9-11). Antike Kulturen dachten beim prägnant gesetzten Wort "Sohn", insbesondere wenn es sich um den erstgeborenen Sohn handelt, nicht nur oder primär an biologische oder emotionale Aspekte, sondern vor allem an (familien)rechtliche: Der Sohn ist der legitime Handlungsbeauftragte; sein Vater vertraut ihm die Verantwortung für das ganze Hauswesen an; der Sohn hat die Vollmacht, im Namen seines Vaters zu handeln; seinen Handlungen kommt die gleiche Rechtswirkung zu wie jenen des Vaters. Das Johannesevangelium wird diese Aspekte mit seiner "Christologie vom bevollmächtigen Sohn" ausloten: in ihrer Breite (hinsichtlich der göttlichen Werke Jesu, z.B. Joh 5,19-47) und in ihrer Tiefe (hinsichtlich der "Herkunft" Jesu und seiner Einheit mit Gott, dem Vater, z.B. 1,18; 14,8-11). Aber auch schon das Markusevangelium ist von einer Sohn-Gottes-Christologie durchdrungen: Sie umspannt den Beginn des Wirkens Jesu (Mk 1,1.11), seine Mitte (9,7) und sein Ende (15,39).
Die allerersten Christen hatten die Bezeichnung Jesu als Sohn Gottes vor allem mit seiner Auferweckung verbunden, in der er als der universal vollmächtige Sohn Gottes eingesetzt und bestätigt wurde (vgl. Röm 1,3-4). Der Evangelist Markus macht seinen Lesern nun einen weiteren Schritt offenbar: Nicht erst "seit" seiner Auferweckung und Verherrlichung handelt Jesus als Gottes vollmächtiger Sohn. Schon vom ersten Anfang seines Wirkens (1,1) an zeigt und vollzieht sich das, was der österliche Herr dann für alle Menschen und Zeiten ist: Damals schon, als er in Vollmacht lehrte (1,22), als man "alle Kranken und Besessenen zu Jesus brachte … und er viele heilte" (1,32), trat uns in Jesus der entgegen, der im Namen und Auftrag Gottes die nahe gekommene Königsherrschaft Gottes ansagt (1,15): Gottes geliebter Sohn, beauftragt und bevollmächtigt zum Heiland der Menschen. Sein ganzer weiterer Weg und paradoxerweise auch noch sein Tod am Kreuz, da er "sein Leben hingibt als Lösegeld für viele" (10,45), wird ihn als solchen erweisen.
Auffälligerweise bezeichnet sich Jesus im Markusevangelium aber nie von sich aus als "Sohn Gottes". Es sind vielmehr die anderen, die ihn so nennen und damit ausdrücken, was in seinem Wirken geschieht: der Evangelist (1,1); die offenbarende Stimme vom Himmel (1,11; 9,7); die Dämonen, die damit den überlegenen Herrn anerkennen müssen (3,11; 5,7); der Hohepriester, der Jesus damit einen Strick drehen will (15,39); und schließlich der Hauptmann des Exekutionstrupps, der Jesus "auf diese Weise sterben sah" (15,39). Wenn hingegen Jesus selbst in Worte fasst, was seine Sendung ist und was seine Vollmacht ausmacht, dann spricht er von sich als dem "Menschensohn". Das ist nicht bloße Bescheidenheit. Es drückt vielmehr aus, woraufhin Jesu Wirken und Vollmacht zielt, was seine ganze Existenz ausmacht: Bei den Menschen, unter den Menschen, mit den Menschen zu sein und ihnen so – und nicht etwa von außen oder von "oben herab" – Gottes gute Herrschaft nahe zu bringen und erfahren zu lassen. Der Evangelist bietet uns also an, beides zusammen zu denken und zu bekennen: Er, der als Menschensohn und Menschenkind unter uns Menschen ist, er ist es, der Gottes gutes Herr-Sein wirklich nahe bringt: Wo Jesus ist, handelt Gott selbst. Jesus ist der bevollmächtigte Sohn.
Der Evangelist erzählt uns, wie Jesus Sünden erlässt und Menschen aufrichtet. Damit lädt er uns ein zu erkennen: Jesus, der Menschensohn ist Gottes Sohn. Kein anderer als der Menschensohn Jesus ist befähigt, als Gottes vollmächtiger Sohn zu handeln. Er stiftet unter uns Menschen eine neue Gottesfreundschaft und Gotteskindschaft.
c. Zuletzt noch ein Blick darauf, wie der Evangelist von dem gelähmten Mann spricht. Auf den ersten Blick mag es verwunderlich erscheinen: Er, um den sich doch eigentlich alles dreht, bleibt in der Erzählung selbst völlig blass und passiv. Wir erfahren nichts über die Umstände seines Leidens, er selbst spricht kein einziges Wort und setzt keine Initiative. Andere handeln an ihm. Er liegt einfach nur da. Und auch als er auf Jesu Wort hin dann aufsteht, seine Trage nimmt und hinausgeht, erfahren wir nichts über ihn selbst: Wie er reagierte und was aus ihm wurde – all das bleibt im Dunkel. Wir hören nur vom Außer-sich-sein und vom Gotteslob der Menge.
Auch wenn hinter dieser Geschichte ein konkreter Mensch mit seiner einzigartigen Erfahrung steht, die Erzählung hat ihn gewissermaßen anonymisiert. Das kann kein Zufall sein. Wenn ein Erzähler vom Kaliber des Evangelisten Markus die Hauptgestalt seiner Perikope so unscharf "zeichnet", dann bietet er seinen Lesern an, sich im Hören der Geschichte mit diesem Mann zu identifizieren, sozusagen an seine Seite zu treten und an seiner Erfahrung teilzuhaben. Viele von uns kennen in irgendeiner Form ja diese Situation: Eingemauert in sich selbst zu sein, unfähig zu Bewegung und Initiative, Objekt der anderen, ob sie nun tragen und helfen wollen oder ob sie bloß dasitzen und kritisch zuschauen. Aber dann hören wir diese Erzählung und es kann sein, als lägen wir vor Jesus. Er sieht und spricht uns an: Kind, erlassen sind deine Sünden. Steh auf, nimm deine Bahre und geh.
JESUS, stärke meinen Glauben und vergib meine Sünden.