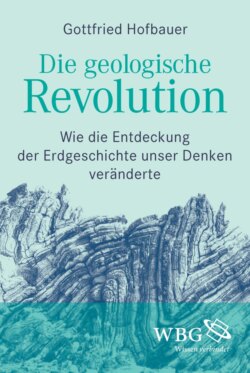Читать книгу Die geologische Revolution - Gottfried Hofbauer - Страница 11
Newton und das „Bier–Modell“ zur Entstehung der Erdoberfläche
ОглавлениеDie Zeit Newtons war auch die Zeit der ersten großen erdgeschichtlichen Entwürfe. Ein erster Ansatz in Descartes Prinzipien der Philosophie (1644) versucht, die Entstehung der Erde, ihrer Kruste, der Meere und der Atmosphäre durch ein mechanisches Modell zu erklären. Auf diesen Ansatz werden wir später noch etwas genauer zurückkommen.
Der eigentliche Startschuss für eine anhaltende Diskussion über eine natürliche Entstehung der Erde und der natürlichen Ursachen der Sintflut wurde allerdings durch Thomas Burnett gesetzt. In seiner Heiligen Theorie der Erde (ab 1681) wird die ganze Schöpfungsgeschichte bis zum Ende der Erde am Jüngsten Tag als eine natürliche Entwicklung skizziert.15
Ein erhaltener Briefwechsel dokumentiert die Diskussion zwischen Burnet und Newton über die Frage, wie wörtlich der biblische Schöpfungsbericht wohl zu verstehen sei.16 Newton plädiert für eine wörtliche Interpretation, wobei er die Überlegung vorbringt, die im Schöpfungsbericht genannten sechs Tage könnten möglicherweise doch länger als heutige Tage gewesen sein, wenn die Rotation der Erde langsamer verlaufen wäre.
Burnet hält dem entgegen, dass die sechs Tage unmöglich die Schöpfung des ganzen Universums betreffen können, denn Sonne und Sterne könnten doch wohl nicht nach der Erde, also erst am dritten Tag, entstanden sein. Auch eine Verlängerung der Tage würde schließlich nicht hinreichen, die Erde aus dem ursprünglichen Chaos in natürlicher Weise in einen bewohnbaren Planeten zu transformieren. Burnet bringt seine prinzipielle Skepsis an der wörtlichen Interpretation des Schöpfungsberichts prägnant zum Ausdruck: „Und wenn der Schöpfungsbericht in einem Teil ein Idealbild ist, dann kann er dies in einem gewissen Maß in jedem Teil sein“.17
Newtons Festhalten am mosaischen Schöpfungsbericht bedeutet auch, dass er – im Gegensatz zu Burnet – die gegenwärtige Form der Erde tatsächlich als von Anfang an gegeben ansieht. Während Burnet hier sein auf Naturgründe bauendes Sintflut-Modell entwickelt, vermag Newton dazu nur eine aus dem Stehgreif gefasste Hypothese vorzubringen:
„Während ich schreibe, fällt mir eine andere Illustration zur oben vorgeschlagenen Erschaffung der Berge ein. Milch ist eine gleichförmige Flüssigkeit wie das Chaos. Wenn man Bier hinein gießt und die Mischung eintrocknen läßt, wird die Oberfläche dieser geronnenen Substanz rauh und gebirgig erscheinen wie die Erde es überall ist. Ich verzichte darauf, andere Gründe für Berge zu beschreiben, wie das Ausbrechen von Dämpfen aus der Tiefe, bevor die Erde richtig fest geworden war, das Absetzen und Schrumpfen der ganzen Erdkugel, nachdem die oberen Bereiche oder die Oberfläche hart zu werden begannen […].“18
Burnet ist insofern „moderner“ als Newton, als er sich eine von der buchstäblichen Interpretation der Bibel losgelöste Erdgeschichte vorstellen kann. Sein Modell ist deistisch, das heißt, Gott braucht nach der Schöpfung nicht mehr in den Lauf der Dinge einzugreifen. Damit gewinnt der Autor die Freiheit, sich eine natürliche Entwicklungsgeschichte zurecht zu legen, so hypothetisch der Entwurf auch sein mag.
Newton hält hingegen am biblischen Zeitmaßstab fest. In dem Briefwechsel wird deutlich, dass er sich bis zu diesem Zeitpunkt zu dieser Frage offenbar noch keine Gedanken gemacht hatte. Eine Geschichte der Erdoberfläche im Sinne einer mehrfachen oder gar andauernden Umgestaltung kommt ihm jedenfalls nicht in den Sinn: Die Oberfläche ist schon am Beginn der Geschichte, unmittelbar im Anschluss an die Entstehung der Erde, in einem einzigen Akt entstanden.
Für den Wissenschaftshistoriker bleibt so nur noch die Frage: Bier in Milch gegossen – war das nur ein Missgeschick an einem unordentlichen Schreibtisch oder hat Newton das vielleicht öfter getrunken? Ein gezieltes Experiment zur Geschichte der Erde ist das jedenfalls nicht gewesen.