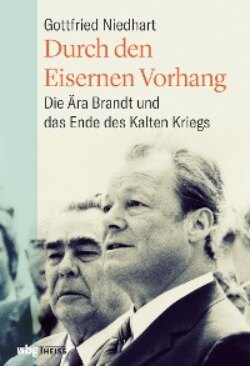Читать книгу Durch den Eisernen Vorhang - Gottfried Niedhart - Страница 10
Jenseits des Kalten Kriegs
ОглавлениеIn besonderer Weise profitierte Europa vom Zwang zum Nicht-Krieg, denn hier standen sich die Nuklearmächte unmittelbar gegenüber, ohne ihr militärisches Potenzial zum Einsatz bringen zu können. Auch in anderen Weltteilen, etwa auf der Koreanischen Halbinsel, wurde entgegen der Empfehlung des Oberbefehlshabers, General Douglas MacArthur, im Koreakrieg nicht auf Atomwaffen zurückgegriffen. Aber Kriege wurden unter direkter oder verdeckter Beteiligung der Weltmächte sehr wohl geführt. In Europa blieb es bei der Angst vor einem Krieg. Dort herrschte die Ungewissheit, ob die Friedlosigkeit des Kalten Kriegs womöglich doch in einen heißen Krieg überginge. Abhilfe konnte nur geschaffen werden, wenn die Denkstile und Politikformen des Kalten Kriegs überwunden und die zentralen Probleme europäischer Sicherheit, das Wettrüsten und die deutsche Frage, angegangen wurden. Tatsächlich gelang es, im Laufe der 1960er-Jahre einen Prozess des Wandels einzuleiten, sodass das Ost-West-Verhältnis allmählich auch als interaktive ost-westliche Beziehungsgeschichte wahrgenommen werden konnte. Beide Seiten betonten die Unterschiede ihrer Weltsicht, erklärten aber zugleich ihre Bereitschaft, die Angst voreinander ab- und Vertrauen aufzubauen. Krieg war auch bisher keine Option gewesen, jetzt aber sollte Frieden „nochmals eine Idee möglicher“ werden.12 Der Ost-West-Konflikt dauerte an, aber die Terminologie, mit der er beschrieben wurde, begann sich zu ändern. Einen deutlichen Hinweis gab der amerikanische Politikwissenschaftler Marshall Shulman 1966 mit einem Buch, das den programmatischen Titel Beyond the Cold War trug. Die Gegenwart entziehe sich jeglicher Schwarz-Weiß-Malerei und dem Denken in Freund-Feind-Kategorien. „Jenseits des Kalten Kriegs“ zu sein bedeute nicht, die Augen vor den amerikanisch-sowjetischen Spannungen zu verschließen. Aber Shulman säte deutliche Zweifel, ob der Konflikt mit einem aus der Anfangsphase dieser Spannungen stammenden Begriff angemessen beschrieben werden könne. Seit den Zeiten des Kalten Kriegs unter Stalin habe sich die Sowjetunion verändert, woraus Möglichkeiten erwüchsen, die Beziehungen zur östlichen Supermacht neu zu gestalten. Neben den Konflikt träten Ansätze zur Kooperation. Dies zu erkennen sei das Gebot der Stunde. Der Terminus Kalter Krieg habe ausgedient. Als zeitgeschichtlich belasteter Begriff trübe er den Blick für Chancen der Annäherung in der Zukunft.
Konsequenzen hatte diese Sichtweise nicht zuletzt dort, wo die Trennung zwischen Ost und West besonders stark zu spüren war. In der Bundesrepublik Deutschland, die ebenso wie die Deutsche Demokratische Republik ein Produkt des Kalten Kriegs war, fiel die Anpassung an den globalen Trend der Ost-West-Entspannung keineswegs leicht, zog sie doch die Zurückstellung der deutschen Frage gegenüber der Priorität der Entspannung in Europa nach sich. Die Ende 1966 ins Amt gelangte Regierung der Großen Koalition verfügte über den erforderlichen Rückhalt, um diesen Schritt gehen zu können. Bundeskanzler Kiesinger nutzte den Staatsakt zum „Tag der deutschen Einheit“ am 17. Juni 1967, um den Blick auf die „gegenwärtige Struktur“ im geteilten Europa zu lenken. Angesichts einer „kritischen Größenordnung“ Gesamtdeutschlands könne man „das Zusammenwachsen der getrennten Teile Deutschlands nur eingebettet sehen in den Prozess der Überwindung des Ost-West-Konflikts in Europa“. Angezeigt sei daher eine „Entspannungspolitik mit langem Atem“, wie Außenminister Brandt wenig später im August 1967 schrieb. Sie sollte nicht von „Fortschritten in der Deutschland-Frage abhängig“ sein. Die Rede war jetzt von einer Auflockerung der „erstarrten politischen Fronten“. Darin liege ein „großer Fortschritt gegenüber der Zeit des Kalten Kriegs“. Vom Kalten Krieg sprach Brandt auch deshalb in der Vergangenheitsform, weil die „revolutionären Ziele in der sowjetischen Europapolitik zurückgetreten“ seien. Die Sowjetunion sei nicht auf „Krisen in unserem Kontinent“ aus.13 Selbst nach der sowjetischen Intervention in der Tschechoslowakei, die 1968 für Zweifel und Verunsicherung sorgte, wollte die Bundesregierung nicht zu einer „Politik des Kalten Kriegs“ aufrufen. Sie sah keinen Anlass, „unsere Ostpolitik prinzipiell zu ändern“.14
Auch der französische Außenminister Michel Debré nannte am 29. August 1968 vor dem Außenpolitischen Ausschuss der Nationalversammlung die gewaltsame Unterdrückung der Reformbewegung in der Tschechoslowakei nicht etwa einen Rückfall in den Kalten Krieg, sondern einen „Verkehrsunfall auf der Straße der Entspannung“.15 Immerhin votierte er bei den politischen Beziehungen mit der Sowjetunion vorübergehend für eine „gewisse Distanzierung“.16
Von der Reduzierung der Kontakte waren auch Überlegungen des amerikanischen Präsidenten Lyndon B. Johnson betroffen. Er konnte den Gedanken eines Gipfeltreffens mit dem sowjetischen Parteichef Breschnew nicht weiterverfolgen. Johnsons Nachfolger Richard Nixon wurde wenig später für seine Bereitschaft gelobt, in eine „Ära der Verhandlungen“ einzutreten.17 Wichtiger als eine Liberalisierung im osteuropäischen Herrschaftsbereich der Sowjetunion erschien die Stabilisierung bestehender Kräfteverhältnisse als Voraussetzung für Annäherung und Entspannung. Analog dazu sah Breschnew im Mai 1972, als er Nixon in Moskau empfing, über die soeben erfolgte Ausweitung der amerikanischen Kriegführung gegen Nordvietnam hinweg, bei dessen kurz zuvor gestarteter Osteroffensive gegen den Süden sowjetische Panzer zum Einsatz kamen. Für Breschnew war ein Erfolg des sowjetisch-amerikanischen Gipfeltreffens entscheidender als die Unterstützung für das kommunistische Nordvietnam. Zurück in Washington verkündete der amerikanische Präsident den Beginn eines ost-westlichen Entspannungsprozesses, der zu einem „dauerhaften Frieden“ führen könne. Die Wortwahl ließ aufhorchen und erinnerte an Brandts Diktum aus dem Jahr 1967. Auch Nixon wollte nicht mehr vom Kalten Krieg sprechen und stellte sein Treffen mit der sowjetischen Führung als einen Neubeginn gegenüber der „Gipfeldiplomatie in der Ära des Kalten Kriegs“ dar.18 In einer Grundsatzerklärung hatten beide Seiten ihren Willen bekundet, „militärische Konfrontationen“ zu vermeiden und Differenzen mit „friedlichen Mitteln“ beizulegen.19 In Moskau notierte Anatoli Tschernjajew, stellvertretender Leiter der Abteilung für internationale Angelegenheiten beim ZK der KPdSU und später Berater von Michail Gorbatschow, man habe den Rubikon überschritten – den „großen Rubikon der Weltgeschichte“.20